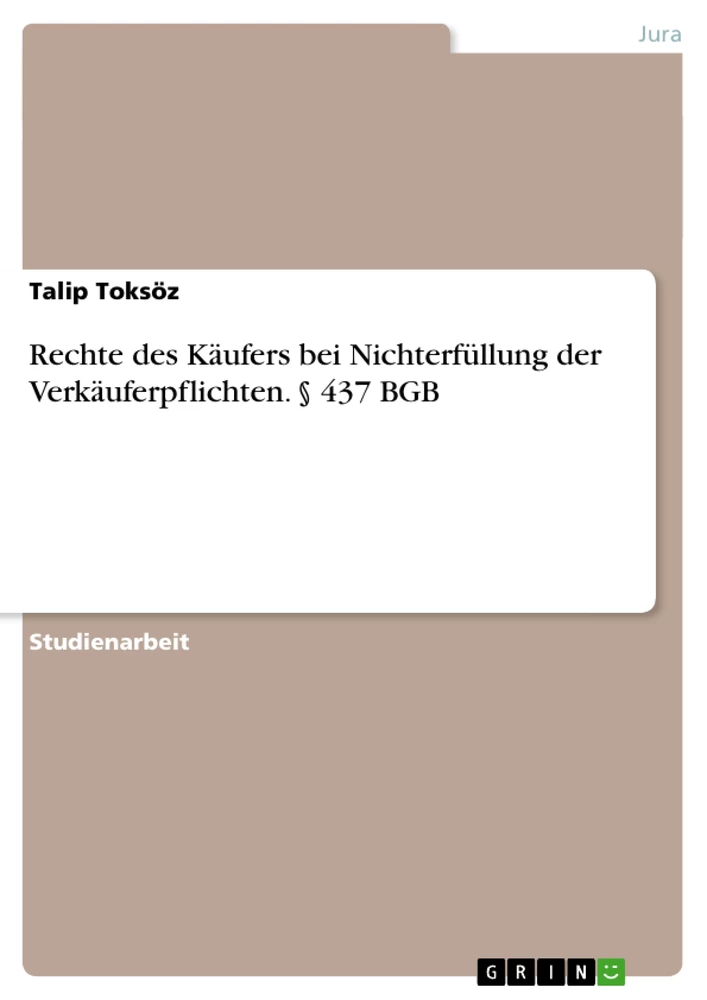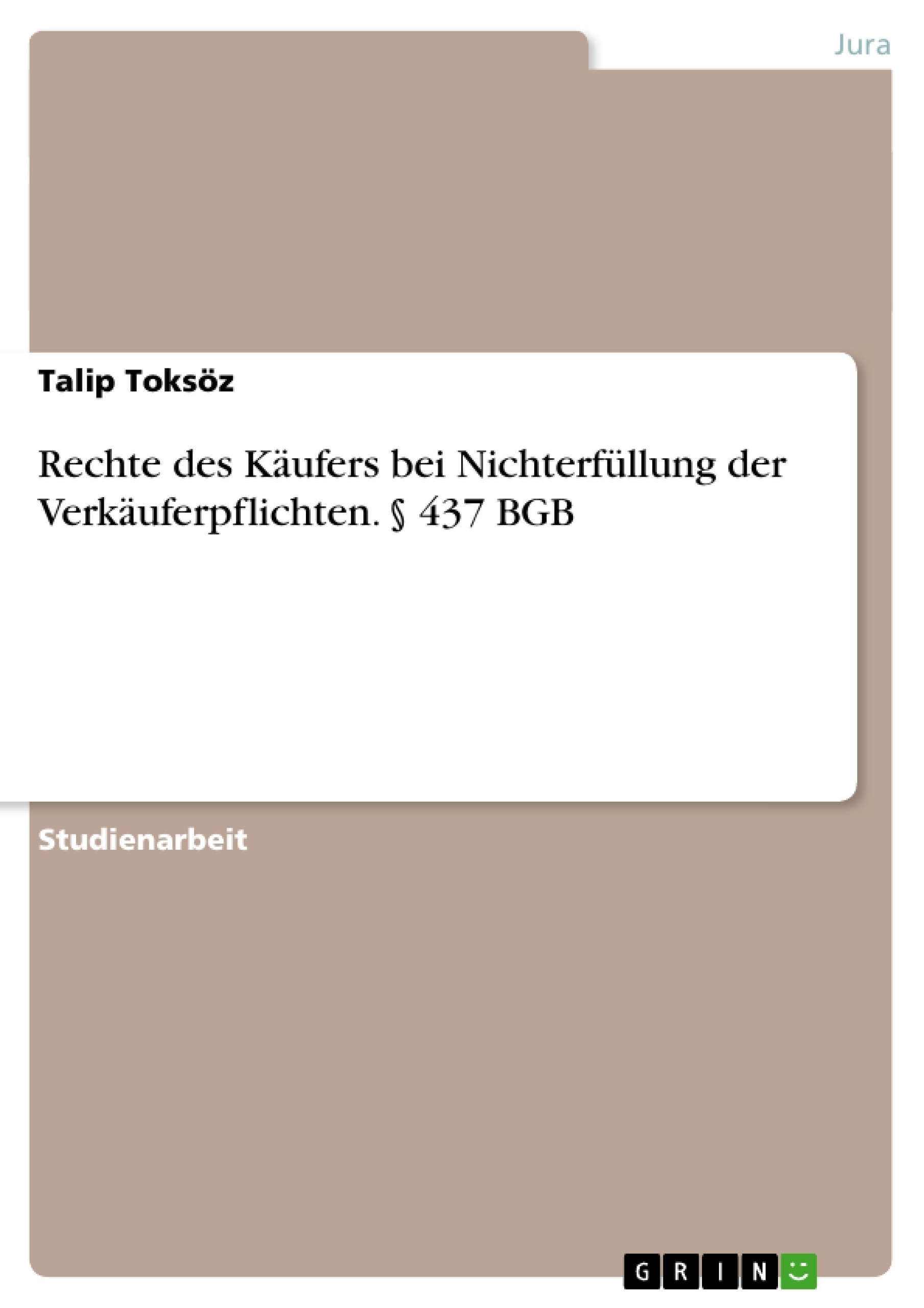Sowohl Käufer als auch Verkäufer verfolgen bei der Abwicklung von Kaufverträgen unterschiedliche Interessen. Im Interesse des Käufers liegt es, die gekaufte, mangelfreie Ware zu erhalten. Unter Umständen möchte er neben dieser Leistung den Ersatz von aufgetretenen Schäden erhalten. Sofern der Verkäufer überhaupt nicht liefert, hat der Käufer darüber hinaus das Interesse, sich von dem V ertrag zu lösen um möglicherweise mit einem anderen Verkäufer ein Geschäft abschließen zu können. Vor allem wird es dem Käufer wohl darauf ankommen, den Vertrag zügig abzuwickeln.
Dagegen liegt es vor allem im Interesse des Verkäufers, den Kaufpreis zu erhalten und für den Fall, dass Mängel auftreten, bevor der Kaufvertrag rückabgewickelt wird, diese Mängel zunächst selber beseitigen zu können. Schließlich möchte der Verkäufer nach vollständiger Abwicklung des Kaufvertrages sicher sein, dass die Mängelhaftung zeitlich begrenzt ist und er so einige Zeit n ach Erbringung seiner Leistung keinen Ansprüchen des Käufers mehr ausgesetzt ist.
Diesen umfassenden Interessen der beiden Vertragsparteien trägt das Gesetz in § 437 BGB Rechnung. Dort finden sich Regelungen über die Rechte des Käufers bei Schlechterfüllung durch den Verkäufer. Dabei ist § 437 BGB in erster Linie eine Verweisungsnorm und stellt keine eigenständige
Anspruchsgrundlage dar. Vielmehr fungiert § 437 BGB als Rechtsgrundverweisung, indem die Rechtsbehelfe des Käufers, dem eine mangelhafte Sache geliefert worden ist, aufgezählt werden und von ihnen bestimmt wird, dass sie geltend gemacht werden können, „wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen“. Damit verweist § 437 BGB sowohl auf die im Zusammenhang mit dem Kauf geregelten Rechtsbehelfe wie die Nacherfüllung (§§ 439, 440 BGB) und die Minderung (§ 441 BGB), als auch auf die im Rahmen des allgemeinen Schuldrechts geregelten Rechtsbehelfe wie Rücktritt und Schadensersatz (§§ 323, 280, 281, 311a Abs. 2, 284 BGB). Damit sind explizit die wichtigsten dieser Rechtsbehelfe aufgezählt, es fehlen allerdings Verweise auf § 282 und § 285 BGB.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einführung
- Übersicht
- Anwendungsvoraussetzungen
- Besonderheit beim Verbrauchsgüterkauf
- Verhältnis der Gewährleistungsansprüche zueinander
- Nacherfüllung
- Verhältnismäßigkeit der Nacherfüllung
- Unentgeltlichkeit der Nacherfüllung
- Rücktritt, § 437 Nr. 2 BGB
- Fristsetzung
- Entbehrlichkeit der Fristsetzung
- Ausschluss des Rücktrittsrechts
- Rücktrittserklärung
- Rechtsfolge
- Minderung
- Schadensersatz
- Schadensersatz statt der Leistung wegen eines behebbaren Mangels: §§ 437 Nr. 3, 440, 281 Abs. 1 S. 1 Alt. 2
- Schadensersatz statt der Leistung wegen bereits bei Vertragsschluss mangelhafter Kaufsache: §§ 437 Nr. 3, 311 a Abs. 2 S. 1 BGB
- Schadensersatz statt der Leistung wegen nachträglich unbehebbar mangelhaft gewordener Kaufsache: § 437 Nr. 3, 283, 280 Abs. 1 BGB
- Schadensersatz neben der Leistung: §§ 437 Nr. 3, 280 I BGB
- Aufwendungsersatz
- Gewährleistungsausschluss
- Verjährung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bietet einen Überblick über die Rechte des Käufers bei Mängeln der Kaufsache im Rahmen des Gewährleistungsrechts (§ 437 BGB). Aufgrund des Umfangs des Themas konzentriert sich die Arbeit auf die Vermittlung eines umfassenden Verständnisses der Käuferrechte.
- Gewährleistungsansprüche des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln
- Die verschiedenen Rechtsbehelfe des Käufers (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz)
- Das Verhältnis der Gewährleistungsansprüche zueinander
- Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf
- Beweislastverteilung beim Vorliegen eines Mangels
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Diese Arbeit befasst sich mit den Rechten des Käufers bei Nichterfüllung der Verkäuferpflichten gemäß § 437 BGB, wobei der Fokus auf einem Überblick über das Gewährleistungsrecht liegt.
Einführung: Die Einführung beschreibt die gegensätzlichen Interessen von Käufer und Verkäufer bei Kaufverträgen. Der Käufer möchte mangelfreie Ware und gegebenenfalls Schadensersatz. Der Verkäufer möchte den Kaufpreis erhalten und Mängel beheben bevor der Vertrag rückabgewickelt wird. § 437 BGB regelt diese Interessen, indem er auf verschiedene Rechtsbehelfe verweist.
Übersicht: Dieser Abschnitt erläutert die Grundvoraussetzungen für die Anwendung von § 437 BGB: einen bestehenden Kaufvertrag und einen Mangel (Sach- oder Rechtsmangel). Es wird auf die Definitionen von Sach- und Rechtsmängeln eingegangen und der Zeitpunkt des Gefahrübergangs als entscheidend für das Vorliegen des Mangels hervorgehoben. Die Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf mit Beweislastumkehr gemäß § 476 BGB werden erklärt.
Verhältnis der Gewährleistungsansprüche zueinander: Die Gewährleistungsansprüche aus § 437 BGB sind grundsätzlich unabhängig voneinander. Jedoch muss in der Regel zunächst Nacherfüllung verlangt werden, bevor Rücktritt oder Minderung in Anspruch genommen werden können.
Schlüsselwörter
Gewährleistungsrecht, Kaufvertrag, Sachmangel, Rechtsmangel, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, Verbrauchsgüterkauf, Gefahrübergang, Beweislast, § 437 BGB, § 434 BGB, § 435 BGB, § 476 BGB
Häufig gestellte Fragen zum Gewährleistungsrecht (§ 437 BGB)
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Gewährleistungsrecht (§ 437 BGB) aus Käufersicht. Sie behandelt die verschiedenen Gewährleistungsansprüche (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz), deren Verhältnis zueinander und Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Gewährleistungsansprüche hat der Käufer bei Sach- und Rechtsmängeln?
Der Käufer hat verschiedene Gewährleistungsansprüche bei Mängeln der Kaufsache, darunter Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung), Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises und Schadensersatz. Die Arbeit beschreibt detailliert die Voraussetzungen und Rechtsfolgen jedes Anspruchs.
Wie verhält sich der Käufer, wenn der Verkäufer die Kaufsache nicht ordnungsgemäß liefert?
Zunächst muss der Käufer in der Regel die Nacherfüllung verlangen (§ 437 Nr. 1 BGB). Erst wenn diese fehlschlägt oder unverhältnismäßig ist, kann er von anderen Ansprüchen wie Rücktritt (§ 437 Nr. 2 BGB) oder Minderung Gebrauch machen. Auch Schadensersatzansprüche sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Welche Besonderheiten gibt es beim Verbrauchsgüterkauf?
Beim Verbrauchsgüterkauf gelten besondere Regeln, insbesondere hinsichtlich der Beweislastumkehr gemäß § 476 BGB. Der Verkäufer muss in diesem Fall beweisen, dass ein Mangel zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht vorgelegen hat. Die Arbeit erläutert diese wichtige Ausnahme vom Grundsatz der Beweislastverteilung.
Welche Bedeutung hat der Gefahrübergang im Gewährleistungsrecht?
Der Gefahrübergang ist entscheidend für die Frage, wer die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels trägt. Erst ab dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Kaufsache auf den Käufer über. Vorher trägt der Verkäufer das Risiko.
Welche Schlüsselwörter sind im Zusammenhang mit dem Gewährleistungsrecht relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind Gewährleistungsrecht, Kaufvertrag, Sachmangel, Rechtsmangel, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, Verbrauchsgüterkauf, Gefahrübergang, Beweislast, § 437 BGB, § 434 BGB, § 435 BGB, § 476 BGB.
Wie sind die Gewährleistungsansprüche im Verhältnis zueinander?
Die Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich unabhängig voneinander. Es besteht jedoch eine Reihenfolge der Geltendmachung. In der Regel muss zunächst die Nacherfüllung verlangt werden, bevor andere Ansprüche geltend gemacht werden können.
Was wird in den einzelnen Kapiteln der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Vorbemerkung, Einführung, Übersicht (inkl. Anwendungsvoraussetzungen und Besonderheiten beim Verbrauchsgüterkauf), Verhältnis der Gewährleistungsansprüche, Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz (inkl. verschiedener Schadensersatzarten), Aufwendungsersatz, Gewährleistungsausschluss und Verjährung. Jedes Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über den jeweiligen Aspekt des Gewährleistungsrechts.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Käuferrechte im Gewährleistungsrecht (§ 437 BGB) zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der verschiedenen Rechtsbehelfe und deren Anwendung.
- Quote paper
- Talip Toksöz (Author), 2005, Rechte des Käufers bei Nichterfüllung der Verkäuferpflichten. § 437 BGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/44322