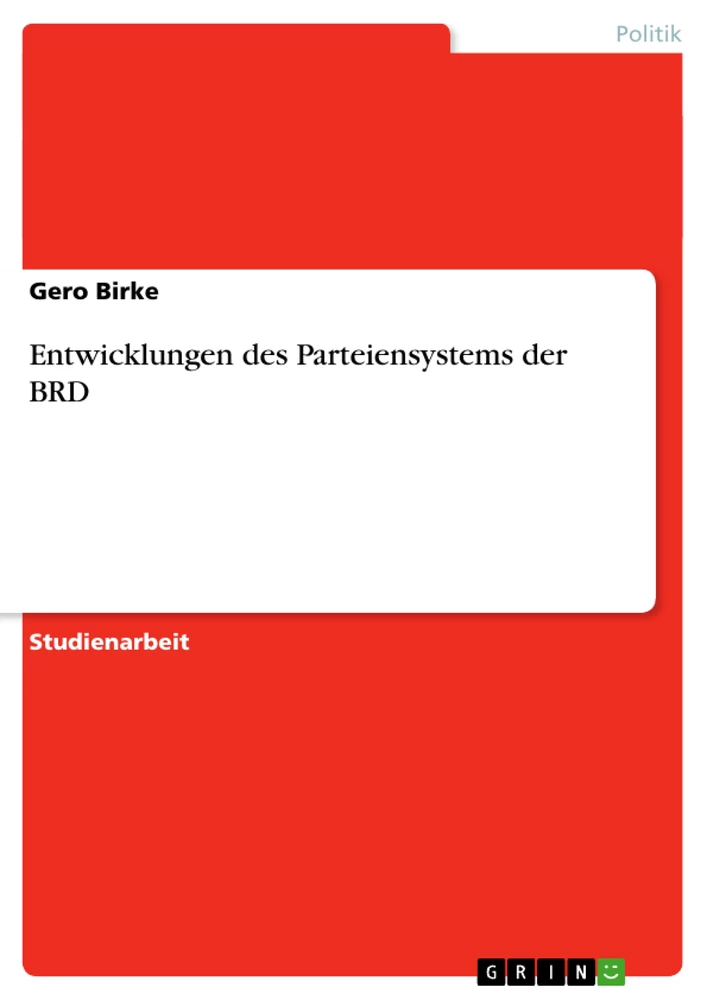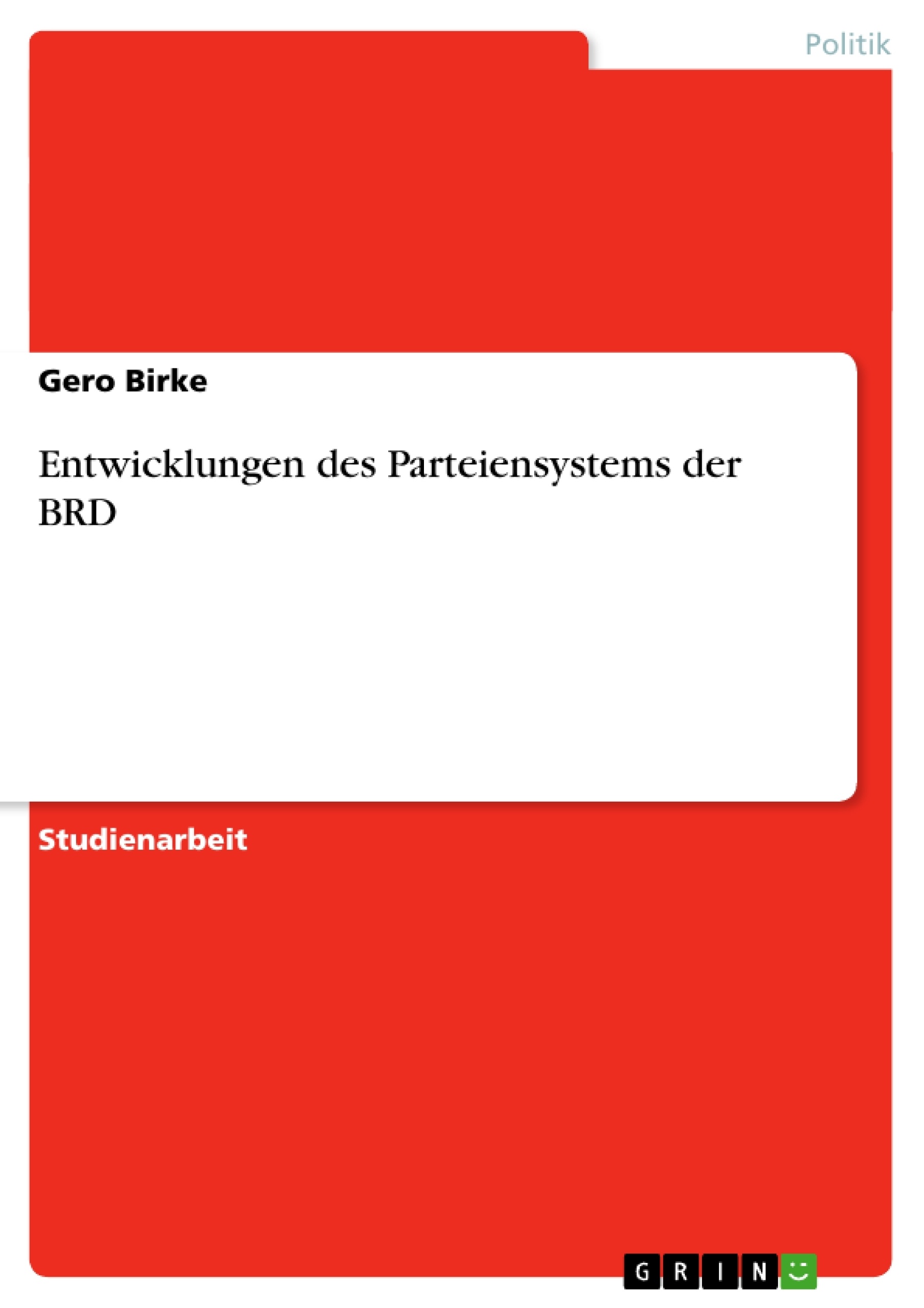„Die Geschichte der ganzen bisherigen Gesellschaft bewegte sich in Klassengegensätzen, die in den verschiedenen Epochen verschieden gestaltet waren.“ (Karl Marx)
Haben die jeweiligen gesellschaftlichen Konfliktlinien Auswirkungen auf das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland gehabt und wenn ja, welche Tendenzen kann man daraus für die Zukunft ableiten?
Punkte, deren Klärung zum allgemein besseren Verständnis der Problematik beitragen, sind Rolle und Aufgaben von Parteien sowie ihre verfassungsrechtliche Stellung. Zudem erscheint eine nähere Betrachtung ihrer Funktionen in Bezug auf die Ge¬sellschaft sowie die von ihr erbrachten Leistungen für das demokratisch-pluralistische System sinnvoll. Letztendlich sind noch die Funktionsgegensätze, also Probleme denen sich Parteien gegenübersehen, bedeutsam.
Die eigentliche Untersuchung erfolgt in Anlehnung an Oskar Niedermayers zeitliche Unterteilung der „Entwicklungen des Parteiensystems“, der mittels ausgewählter Systemeigenschaften eine reine Funktionsanalyse des Parteiensystems durch¬führt. Dieses Konzept wird allerdings um die historischen Zusammenhänge zu verdeutlichen, um eben diese Variante erweitert, sodass der vorab ein historischer Rück¬blick beginnend im Kaiserreich über die Weimarer Republik sowie die NS-Zeit hin zur Zeit nach dem 2. Weltkrieg und der Gründung der BRD erfolgt. Darauf aufbauend schließt sich die eigentliche Analyse des Parteiensystems der BRD an, wobei es nicht allein bei einer reinen Funktionsanalyse bleibt, sondern zudem auf die gesellschaftlichen Konfliktlinien und deren Auswirkungen auf das Parteiensystem eingegangen wird. Denn letztlich ist es die Bevölkerung, die den Parteien und somit folglich auch dem Parteiensystem ihre Legitimation erteilt. Folglich ist das Parteiensystem stark mit den Konflikten innerhalb der Gesellschaft verbunden. Diese gesellschaftlichen Konfliktlinien und ihre Wirkung auf die Parteien und deren ideologische Flügel sowie daraus resultierend auf das Parteiensystem werden abschleißend betrachtet. Hieraus lassen sich dann auch möglichen zukünftige Entwicklungen des Parteiensystems ableiten.
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Rolle und Aufgaben von Parteien
1.2.1. Gesetzliche Grundlagen
1.2.2. Hauptfunktionen von Parteien
2. Entwicklungen des Parteiensystems
2.1. Systemeigenschaften
2.2. Das Parteiensystem der BRD
2.2.1. 1945-1950
2.2.2. Die Konsolidierungsphase der 50er Jahre
2.2.3. Die Phase des stabilen „Zweieinhalbparteiensystems“ der 60er und 70er Jahre
2.2.4. Die Pluralisierungsphase der 80er Jahre
2.2.5. Das gesamtdeutsche Parteiensystem
2.2.5.1. Die DDR in den Jahren 1989/1990
2.2.5.2. Die 90er Jahre
3. Fazit
Quellenverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Gesetzesauszüge
Parteienstammbaum – Kaiserreich und Weimarer Republik
Parteienstammbaum – Bundesrepublik Deutschland
Bundestagswahlen 1949-1998
Regierungen und Koalitionen
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den „Entwicklungen des Parteiensystems“ der Bundesrepublik Deutschland auseinander. Um den Zugang zum eigentlichen Thema zu erleichtern, werden vorab „Rolle und Aufgaben von Parteien“ dargestellt.
Es hat sich die Zentrale Fragestellung ergeben, ob die jeweiligen gesellschaftlichen Konfliktlinien Auswirkungen auf das Parteiensystem haben und wenn ja, welche Tendenzen man daraus für die Zukunft ableiten kann?
Ein Blick in die gesetzlichen Grundlagen soll die verfassungsrechtliche Stellung von Parteien zeigen. Darauf folgt eine nähere Betrachtung ihrer Funktionen in Bezug auf die Gesellschaft sowie die von ihr erbrachten Leistungen für das demokratisch-pluralistische System.
Nach diesen einleitenden Überlegungen soll die Analyse des eigentlichen Themas aufgenommen werden.
Erst einmal stellte sich das Problem nach einer sinnvollen zeitlichen Unterteilung der „Entwicklungen des Parteiensystems“, um der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit gerecht zu werden. Hierzu findet man in der Literatur unterschiedliche Ansätze:
Einige Autoren bevorzugen die Einteilung des bundesrepublikanischen Parteiensystems nach den Bundestagswahlen, den Bundeskanzlern oder den jeweiligen Koalitionen. Hier werden jedoch nur einzelne Aspekte betrachtet: z.B. Personen oder Parteien, die unbestreitbar Bestandteile des Parteiensystems sind, aber eine funktionsausgerichtete, ganzheitliche Betrachtung unterbleibt. Eine Alternative schlägt Ulrich von Alemann vor, der auf „[...] die Dynamik der Parteien [...]“[1]eingeht. Doch auch diese Untersuchungsmethode scheint kein erfolgsversprechender Ansatz im Sinne der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Fragestellung zu sein, da auch sie sich eher mit den Parteien und nicht mit dem System befasst. So scheint hier letztlich die Variante von Oskar Niedermayer am geeignetsten, der mittels ausgewählter Systemeigenschaften eine reine Funktionsanalyse des Parteiensystems durchführt.[2]Um die historischen Zusammenhänge zu verdeutlichen, wird dieses Konzept um eben diese Variante erweitert.
Doch soll nicht allein eine reine Funktionsanalyse vollführt, sondern zudem, wie bereits in der leitenden Fragestellung angesprochen, auf die gesellschaftlichen Konfliktlinien und deren Auswirkungen auf das Parteiensystem eingegangen werden. Denn letztlich ist es die Bevölkerung, die den Parteien und somit folglich auch dem Parteiensystem ihre Legitimation erteilt. Folglich ist das Parteiensystem stark mit den Konflikten innerhalb der Gesellschaft verbunden.
Abschließend soll eine Bestandsaufnahme vor allem in Hinblick auf die gesellschaftlichen Konfliktlinien und ihre Wirkung auf die Parteien und deren ideologische Flügel sowie daraus resultierend auf das Parteiensystem gemacht werden.
Im Anhang befinden sich ergänzende, das Angesprochenen verdeutlichendere Materialien: ein Parteienstammbaum, ein Diagramm der Bundestagswahlen, eine Auflistung der Regierungen und deren Koalitionen u.a.
1.2. Rolle und Aufgaben von Parteien
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Partei“ wie folgt verwandt. „Partei (P.; von lat. pars= Teil, Abteilung) meint im allgemeinsten Begriffsverständnis eine Gruppe gleichgesinnter Bürger, die sich die Durchsetzung gemeinsamer polit. Vorstellungen zum Ziel gesetzt haben.“[3]
1.2.1. Gesetzliche Grundlagen
Die Legitimation demokratischer Parteien für die politische Willensbildung wurde erst mit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24.05.1949 verfassungsrechtlich verankert. In der Verfassung von 1871 wurden sie überhaupt nicht und in der Weimarer Reichsverfassung nur im negativen Kontext erwähnt.[4]
Die auch weiterhin konservative Staats- und Verfassungslehre der Weimarer Republik sah in den Parteien mehr den Einbruch partikularistisch-ideologischer Interessen in die Staatsorganisation als notwendige Elemente zur politischen Willensbildung.[5]
Die verfassungsrechtliche Legitimation der politischen Parteien ist vor allem darauf zurückzuführen, dass man die Wiederholung von in der Vergangenheit begangener Fehler möglichst ausschließen wollte. Zum einen sollte im Gegensatz zur Weimarer Verfassung die Möglichkeit eines Verbots von Parteien, die gegen die demokratische Grundordnung verstoßen, gegeben sein. Zum anderen erschien es den Vätern der Verfassung notwendig, Parteien als Organe der politischen Willensbildung verfassungsrechtlich zu legitimieren.
Jedoch ist Art. 21 GG, der die Parteien betrifft bis dato noch nicht endgültig, da der Parlamentarische Rat eine spätere Ausgestaltung durch den Bundesgesetzgeber vorsah. So wurden am 24.07.1967 mit dem Parteiengesetz erstmals in der deutschen Geschichte alle Aspekte des Parteienlebens in eine rechtlich verbindliche Form gegossen.[6]Das Parteiengesetz gesteht den Parteien zu, ein„verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil“der parlamentarischen Demokratie zu sein und eine vom Grundgesetz„verbürgte öffentliche Aufgabe“wahrzunehmen.[7]Die wichtigsten Abschnitte des Parteiengesetzes betreffen die innere Ordnung und die finanzielle Rechenschaftslegung der Parteien.
1.2.2. Hauptfunktionen von Parteien
Das Parteiengesetz formuliert in § 1 wie die Parteien an der politischen Willensbildung mitzuwirken haben.
Über die gesetzliche Vorgabe hinaus hat sich die Parteienforschung ausführlich mit den Funktionen der Parteien beschäftigt. Die wissenschaftliche Untersuchung ist nicht auf die Handlungsformen der einzelnen Mitglieder, ob an Basis oder Spitze, eingegangen, vielmehr befasst sich die Parteienforschung mit den Systemleistungen.
Zahlreiche Parteienforscher haben die unterschiedlichsten Funktionen, deren Anzahl erheblich divergiert, herausgearbeitet. Diese Arbeit verwendet die von Ulrich von Alemann herausgearbeitete Unterteilung.[8]Er wählt „[e]ine Verknüpfung der verschiedenen Funktionskataloge [...]“[9], sodass am Ende sieben Funktionen stehen, die politische Parteien zu erfüllen haben: Partizipation, Transmission, Selektion, Integration, Sozialisation, Selbstregulation sowie Legitimation.
Im Folgenden soll kurz auf die Begriffe eingegangen werden.
Partizipation– Sie erfolgt zum einen durch den regelmäßigen Wahlakt, zum anderen, und das ist der gewichtigere Punkt, durch Mitwirkung in Parteien. Letztere eröffnet dem Bürger die Möglichkeit an allen übrigen Funktionen zu partizipieren – vor allem bei der Interessenumsetzung in Programme, Ziele sowie Aktionen. Des weiteren hat er die Möglichkeit Mandatsträger zu nominieren und bei der Aufstellung einer Kandidatenliste mitzubestimmen.[10]
Die Umformung gesellschaftlicher Interessen, seien sie ökonomischer, sozialer, ökologischer und ideeller Art, in politisches Handeln, wird alsTransmissionbezeichnet.[11]
Selektionverfolgt zwei unterschiedliche Ziele: Einerseits die Rekrutierung von Personal, andererseits die Auswahl von Alternativen aus dem gesamtgesellschaftlichen Interessenspektrum.[12]
Die Verknüpfung der Interessen verschiedener sozioökonomischer Gruppen heißtIntegration. Sie gelingt besonders den größeren Parteien, die alleine oder mit Hilfe von Koalitionspartnern, eine Mehrheit im Parlament zustande bringen. Zudem führt auch Transmission durch Interessenartikulation und -bündelung zu einer Integration.[13]Eine besonders herausragende Rolle fällt in diesem Bereich derSozialisationzu. Dies liegt daran, dass das Lernen von Politik vorwiegend im alltäglichen Leben stattfindet. Diese Leistung ist zu einem Großteil den Medien zuzuschreiben, die allerdings von Parteien und Verbänden beeinflusst werden. Dieser Vorgang kann alspassive Sozialisationbezeichnet werden. Eine sogenannteaktive Sozialisationerfährt das Individuum durch eine Mitgliedschaft in Partei oder Verband.[14]
Selbstregulation– Parteien haben an sich ein sehr starkes „Interesse an sich selbst“. Sie unterhalten eigene Stiftungen, Vereine, Unternehmen u.a. Dieses Eigeninteresse macht sich auch im Wahlkampf bemerkbar. Es erfolgt eher eine Konzentration des Themas auf sich selbst als auf die Konkurrenzpartei.[15]
Aufgrund oben genannter Funktionen tragen die Parteien zurLegitimationdes politischen Systems bei – vor allem bei dysfunktionalen Erscheinungen (Verkrustung, Verstaatlichung der Parteien) durch die Möglichkeit vonexit(Parteiaustritt)and voice(Meinungsäußerung).[16]
Aufgrund dieser sieben Funktionsmerkmale von politischen Parteien ergibt sich für Ulrich von Alemann eine erweiterte Definition von Parteien. „Parteien sind auf Dauer angelegte, freiwillige Organisationen, die politische Partizipation für Wähler und Mitglieder anbieten, diese in politischen Einfluss transformieren, indem sie politisches Personal selektieren, was wiederum zur politischen Integration und zur Sozialisation beiträgt und zur Selbstregulation führen kann, um damit die gesamte Legitimation des politischen Systems zu befördern.“[17]
2. Entwicklungen des Parteiensystems
2.1. Systemeigenschaften
„Unter Parteiensystem (P.) ist das „strukturelle Gefüge der Gesamtheit der politischen Parteien in einem Staat zu verstehen“ (Nohlen³2000: 65). Merkmale von P. sind (a) die Zahl der Parteien, (b) ihre Größenverhältnisse (bzw. der Grad der Fragmentierung), (c) ihre ideologischen Entfernungsbeziehungen (bzw. der Grad der Polarisierung), (d) ihre Interaktionsmuster (beispielweise ® Koalitionen), (e) ihre Beziehung zur Gesellschaft, (f) ihre Stellung zum ® Politischen System, (g) der Grad der Institutionalisierung des Parteiensystems. [...]“[18]
Wie bereits eingangs angeführt, soll im Folgenden nach der von Oskar Niedermayer angewandten Methode vorgegangen werden.[19]Sowohl dieelektorale Dimensionmit den BegriffenFragmentierung(Grad der Zersplitterung oder Konzentration),Asymmetrie(Größenverhältnis der beiden größten Parteien),Volatilität(Ausmaß an Veränderungen der Größenverhältnisse zwischen Parteien anhand der Veränderungen der Größenverhältnisse zwischen zwei aufeinander folgenden Wahlen),Polarisierung(ideologische Distanz zwischen den systembejahenden Parteien) sowieLegitimität(Grad der Akzeptanz durch die Bürger), als auch diegouvernementale Dimension, die dieSegmentierung(Grad der Abschottung der Parteien untereinander in Bezug auf die Koalitionsfähigkeit) und dieRegierungsstabilitätbeinhaltet, sollen in die Betrachtung mit einbezogen werden. Allerdings reichen laut Oskar Niedermayer drei der angesprochenen Systemeigenschaften aus, die Grundstruktur des bundesrepublikanischen Parteiensystems zu charakterisieren: Fragmentierung, Polarisierung und Segmentierung.[20]
Erstreckt sich die Analyse der Entwicklung eines Parteiensystems über einen längeren Zeitraum, muss festgelegt werden bei welcher Art der Veränderung seiner Eigenschaften von einem Wandel des jeweiligen Parteiensystems gesprochen werden kann. Es gibt nach Oskar Niedermayer, der sich auf Gordon Smith bezieht, vier verschiedeneIntensitätsstufen der Veränderung:temporäre Fluktuationen(kurzfristige Veränderungen von Systemeigenschaften ohne längerfristigen Trend),partieller Wandel(Veränderung nur einer bzw. sehr weniger Eigenschaften),genereller Wandel(gleichzeitige oder sukzessive Veränderung vieler Eigenschaften) undTransformation(radikale Veränderung aller Eigenschaften, d.h. Entstehung eines vollkommen neuen Parteiensystems).[21]
Zur Veranschaulichung der Analyse soll der „[...] Parteienwettbewerb im Rahmen eines Parteiensystems in Analogie zum ökonomischen Marktmodell [...] [dienen.] Wie auf wirtschaftlichen Märkten, so stehen sich auf dem politischen Markt Angebot und Nachfrage gegenüber, und der Wettbewerb erfolgt unter Beachtung gewisser Spielregeln.“[22]
Zudem scheint die Definition eines weiteren Begriffes für das weitere Verständnis hilfreich. „I. Konfliktlinien (K.; engl. cleavages) trennen bei jeder polit. Streitfrage Befürworter und Gegner einer Entscheidung. In der Wahlsoziologie haben insbes. soziale K. im Sinne dauerhafter Spaltungsstrukturen (social cleavages) Beachtung gefunden. Sie trennen soziale Gruppierungen (® Klassen, Konfessionsgruppen, ethnische ® Minderheiten etc.), deren ideelle oder materielle Interessen durch verschiedene ® Parteien vertreten werden. In einer konkreten Konfliktsituation kann es zu einer Koalition zwischen einer sozialen Gruppierung bzw. ihren Repräsentanten und einer polit. Partei kommen. Diese Koalitionen sind i.d.R. dauerhaft und finden bei ® Wahlen ihren Ausdruck in der überdurchschnittlichen Entscheidung der Gruppenangehörigen zugunsten der betreffenden Partei. [...]“[23]
2.2. Das Parteiensystem der BRD
2.2.1. 1945-1950
Nachdem das NS-Regime vernichtend geschlagen war, übernahm am 30.08.1945 der Alliierten Kontrollrat, wie es die „Berliner Deklaration“ (05.06.1945) vorsah, die Administration des besetzten, geographisch-dezimierten Deutschlands.[24]Bereits am 09.06.1945 hatte der sowjetische Stadtkommandant die Verwaltung Berlins übernommen.[25]Stalinistischen Machtinteressen folgend wurden Mitte Juni 1945 in den sowjetischen Proteges KPD, SPD, CDU und LDP zur „Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien” verschmolzen.[26]Bereits Ende 1945 ließen zunehmende Eingriffe der SMAD in das Parteiengefüge befürchten, dass von Seiten der UdSSR ein demokratisches Staatswesen nicht angedacht war. Befürchtungen, die mit der Zwangsvereinigung zwischen SPD und KPD zur SED am 21.04.1946 wahr wurden.[27]
[...]
[1]Alemann, Ulrich von: Das Parteiensystem der BRD; Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2001, S. 41
[2]Siehe hierzu: Niedermayer, Oskar: Das deutsche Parteiensystem: Stabilität oder Wandel?. In: 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Anspruch – Erwartungen – Wirklichkeit; Ringvorlesung an der Technischen Universität Braunschweig im WS 1998/99, S.25-36; ders.: Das gesamtdeutsche Parteiensystem. In: Gabriel, Niedermayer, Stöss (Hrsg.): Parteiendemokratie in Deutschland; Westdeutscher Verlag 1997, S. 106-130
[3]Schultze, Rainer-Olaf: Partei. In: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik; Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2001, S. 350
[4]Vgl. Niclauß, Karlheinz: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland; Schöningh Verlag 1995, S. 15
[5]Vgl. ebd.
[6]Vgl. Lehmann, Hans Georg: Deutschland-Chronik 1945 bis 2000; Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2000, S. 162f
[7]Vgl. Anhang: Gesetzesauszüge: Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) § 1, Abs.1, S. II
[8]Alemann, Ulrich von: Das Parteiensystem der BRD, a.a.O., S. 205-213
[9]a.a.O., S. 208
[10]Vgl. a.a.O., S. 209
[11]Vgl. a.a.O., S. 209f
[12]Vgl. a.a.O., S. 210
[13]Vgl. a.a.O., S. 211
[14]Vgl. a.a.O., S. 211f
[15]Vgl. a.a.O., S. 211
[16]Vgl. a.a.O., S. 212f
[17]a.a.O., S. 213
[18]Bendel, Petra: Parteiensystem. In: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik, a.a.O., S. 358
[19]Siehe S. 1
[20]Vgl. Niedermayer, Oskar: Das deutsche Parteiensystem: Stabilität oder Wandel?, a.a.O., S. 27
[21]Vgl. a.a.O., S. 26 in Bezug auf: Smith, Gordon: A system perspective on party system change; Journal of theoretical politics, 1, 1989, S. 349-364
[22]ebd.
[23]Pappi, Franz Urban: Konfliktlinien. In: Nohlen, Dieter (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik, a.a.O., S. 251
[24]Vgl. Lehmann, Hans Georg: Deutschland-Chronik 1945 bis 2000, a.a.O., S. 19
[25]Vgl. a.a.O., S. 31
[26]Vgl. a.a.O., S. 33
[27]Vgl. a.a.O., S. 34
- Quote paper
- Gero Birke (Author), 2002, Entwicklungen des Parteiensystems der BRD, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/9976