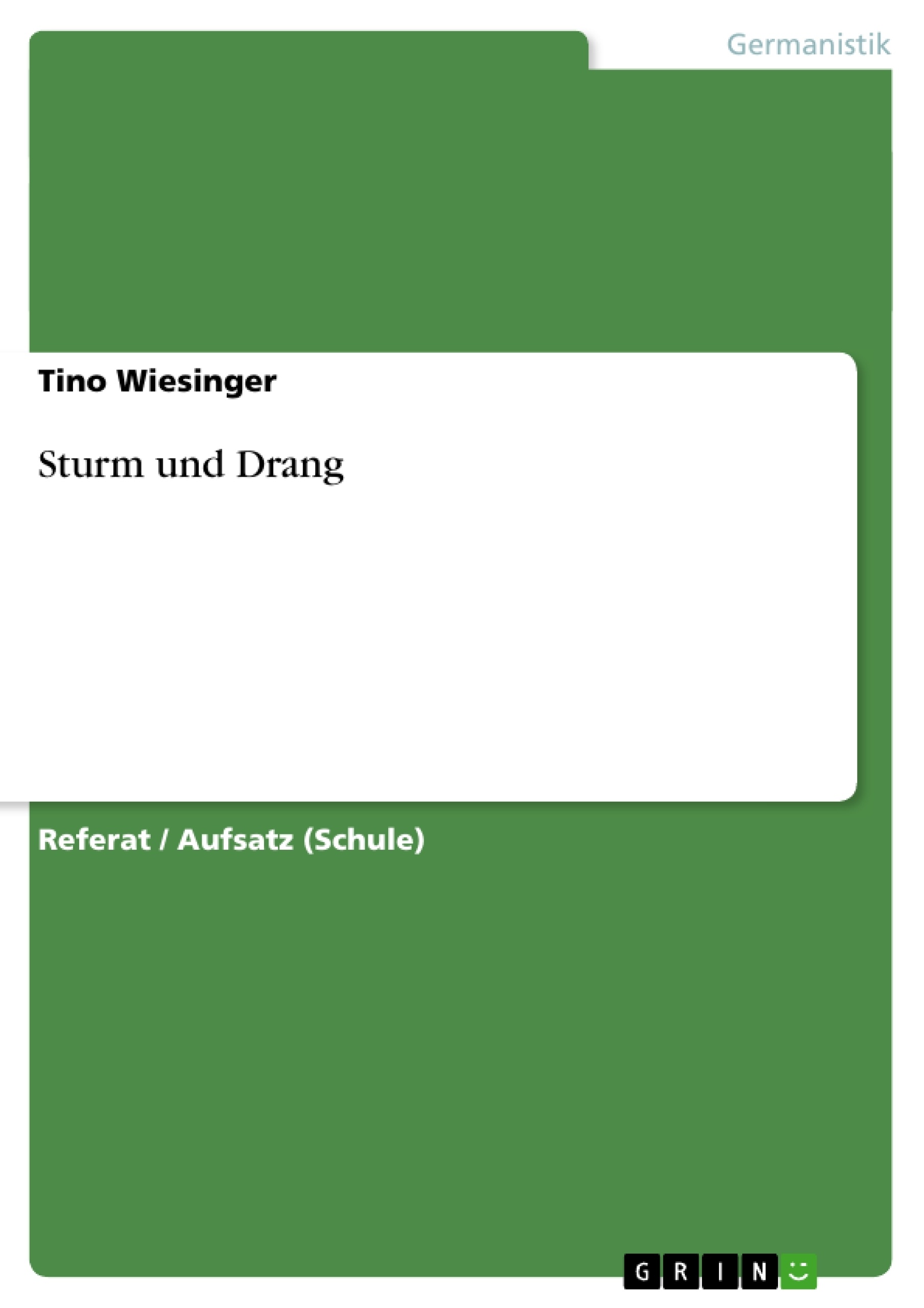Erleben Sie den Aufbruch einer Generation! Der Sturm und Drang, eine Epoche des bebenden Herzens und der leidenschaftlichen Revolte, katapultiert uns in eine Zeit des Umbruchs, in der junge, ungestüme Geister gegen die Fesseln der Aufklärung und die starre Ordnung der absolutistischen Herrschaft aufbegehren. Tauchen Sie ein in die Welt Goethes, Schillers, Herders und Klingers, deren Werke von einem unbändigen Freiheitsdrang, einer tiefen Naturverbundenheit und der leidenschaftlichen Suche nach dem individuellen Ausdruck geprägt sind. Entdecken Sie, wie diese literarische Bewegung, inspiriert von Shakespeare und Rousseau, die Bühne zur moralischen Anstalt erhob und die Lyrik von starren Konventionen befreite. Von den kraftvollen Hymnen, die Prometheus' Rebellion feiern, bis zu den ergreifenden Dramen, die die Willkür der Fürsten anprangern, offenbart sich eine Sprache, die ekstatisch, pathetisch und voller emotionaler Wucht ist. Verfolgen Sie Schillers riskante Flucht vor dem Herzog, Goethes Werthers Leiden und die Entstehung von Werken wie "Die Räuber", "Kabale und Liebe" und "Götz von Berlichingen", die bis heute nichts von ihrer Sprengkraft verloren haben. Dieser Band enthüllt die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe dieser aufregenden Epoche, analysiert die sprachlichen Besonderheiten und zeigt die nachhaltige Bedeutung des Sturm und Drang für die nachfolgenden Generationen, von der Weimarer Klassik bis hin zum Vormärz und zur Moderne. Eine fesselnde Reise in die Welt der Geniezeit, die den Leser mitreißt und die Frage aufwirft: Wie weit würden Sie für Ihre Freiheit gehen? Lassen Sie sich von der rebellischen Energie und der ungestümen Kreativität des Sturm und Drang inspirieren und entdecken Sie die Wurzeln unserer modernen Vorstellung von Individualität und Selbstbestimmung. Eine Epoche, die den Mut zur Veränderung feiert und uns daran erinnert, dass wahre Kunst aus dem Herzen kommt. Wagen Sie den Sprung in eine Zeit des Aufbruchs und der literarischen Revolution!
1. Einleitung
Der Literaturepoche ,,Sturm und Drang", auch Geniezeit oder Genieperiode, stellt eine Auflehnung junger deutscher Literaten gegen die strikt rationalen1 Gedanken der Aufklärung dar. Im gesellschaftspolitischen Sinne richtet sie sich gegen die zu dieser Zeit herrschende Ständeordnung. Die Bezeichnung geht auf ein gleichnamiges Drama Friedrich Maximilian Klingers (deutscher Dramatiker; *1752, _1831, Jugendfreund Goethes) von 1776 zurück. Begonnen hat diese Zeit mit der Herausgabe von Johann Gottfried von Herders (deutscher Philosoph und Dichter; *1744, _1803) ,,Fragmenten" (1767), als Ende wird entweder Schillers Werk ,,Kabale und Liebe" (1784) oder aber Goethes fluchtartige Abreise nach Italien (1786) hergenommen. Ausgangspunkt des Sturm und Drang als literarische Bewegung war ein Treffen zwischen Herder und Goethe in Straßburg im September 1770, wobei letzterer wichtige Gedanken von Herders individueller antirationalistischen2 Philosophie übernahm.
2. Politische und gesellschaftliche Situation
In fast allen Ländern Europas regierten absolutistische3 Herrscher. Nach Ende derösterreichischen Erbfolgekriege, die 1763 enden, ist Deutschland noch mehr in viele kleine Fürstentümer zersplittert, in denen Fürsten (fast) uneingeschränkte Macht besitzen und so ihre Willkürherrschaften ausüben können. Von dieser Herrschaftsform waren auch die Schriftsteller in großem Maße durch strenge Zensur4 betroffen. Insbesondere am württembergischen Hofe von Herzog Karl Eugen (*1728, _1793; prachtliebend und absolutistisch, gründete die Karlsschule) war die Ausbeutung des Volks und ungerechte ,,Justiz" anzutreffen. Auch Schiller war davon betroffen, als er einen 14tägigen Arrest und Publikationsverbot verordnet bekam, da er sich unerlaubt ins Ausland (Mannheim) begeben hatte (zu der zweiten Aufführung der Räuber). In dieser Zeit entstand sein bürgerliches Trauerspiel5,,Kabale und Liebe" (1784), in dem diese Probleme vertreten sind.
3. Vorbilder der Literaten
Vorbild für diese Epoche war vor allem Shakespeare und nicht mehr wie früher die französischen Dichter. Er galt als Dichtergenie und wurde insbesondere im Drama imitiert (seine natürliche Personengestaltung, keine festen Einheiten von Handlung, Ort und Zeit, Geschichtsdramen). So zeugt beispielsweise Goethes Rede ,,Zum Shäkespears-Tag" (1771) von dessen Verehrung für diesen. Auch sonst prägte die angelsächsische Literatur den Sturm und Drang. Die ,,Ossian-Dichtungen" des Schotten Macpherson, in denen auf die keltische Tradition eingegangen wird, inspirierten Herder zu seinem ,,Ossian oder die Lieder alter Völker", aber auch Goethes und Schillers Werke bedienen sich der ,,natürlichen Sprache". Jean-Jacques Rousseaus (französischer Schriftsteller und Philosoph; *1712, _1778) Lehre ,,Zurück zur Natur" war eine der wenigen französischsprachigen Vorbilder der Schriftsteller.
4.1. Beispiele für Literaten und ihre Werke
Friedrich Maximilian Klinger (1752 - 1831) Sturm und Drang (1776), Die Zwillinge (1776)
Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) Journal meiner Reise (1769), Ossian oder die Lieder alter Völker (1773)
Jakob Michael Reinhold Lenz (1751 - 1792) Der Hofmeister (1774), Die Soldaten (1776) Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) Die Leiden des jungen Werther (1774), Götz von Berlichingen (1773), Clavigo (1774), Die
Hymnen Ganymed (1774), Prometheus (1774)
Friedrich Schiller (1759 - 1805) Die Räuber (1782), Kabale und Liebe (1784),
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua (1783)
Das in der Literatur des Sturm und Drangs am häufigsten vorkommende Werk ist das Drama. Romane sind selten, und wenn, dann in Form eines Tagebuch oder Briefes, so wie in Goethes ,,Die Leiden des jungen Werther". Sie beruhen oft auf Selbstanalysen, persönlichen Erlebnissen und Gefühlen des Autors. Im Drama wendet man sich vom aristotelischen Drama ab, d.h. gegen die Einheit von Handlung, Ort und Zeit. So entstehen Fetzen- und Massenszenen, der Handlungsort wird oft gewechselt und es entstehen Nebenepisoden. Bei Friedrich Schillers Dramen ,,Kabale und Liebe" und besonders bei den ,,Räubern" werden diese Merkmale, aber auch die Schlagwörter (s.a. Folie) deutlich. Zahlreiche Nebenepisoden, die von den Erlebnissen der Räuberbande und der Liebe zu Amalie berichten, sind außerdem vorhanden. Idealismus6, Freundschaft und Freiheitsliebe sind die vorherrschenden Schlagwörter in den Räubern.
In der Lyrik, die weit verbreitet ist, löst das freie Lied das Gedicht der Aufklärung ab. Das Volkslied wird wieder entdeckt. In einfacher, natürlicher Sprache wird der Leser in gewisser Weise in das Gedicht hineinversetzt. Auch hier spielt die Natur eine wichtige Rolle, die oft für Stimmung steht (blühende Blumen, Sonnenschein für Heiterkeit und Nebel, Regen, Kälte für schlechte, düstere Stimmung).
Eine andere Art der Lyrik sind die Hymnen. Besonders Goethe war diesen Gedichten, die in freien Rhythmen und ohne Formbeschränkung geschrieben sind, sehr zugeneigt. Die beschriebenen Helden stammen hauptsächlich aus der Antike, so wie Ganymed und Prometheus. Prometheus gilt als mythische Leitfigur des Sturm und Drangs. Bei Goethe rebelliert er gegen Bevormundung und Unterdrückung durch Obrigkeit und fordert Freiheit.
4.2. Die Sprache
Die Sprache der Geniezeit ist ekstatisch7, pathetisch8, schwärmerisch, spontan, emotional, individuell9, dynamisch10 und voller Stilmittel (v.a. Ellipsen11, rhetorische Fragen12, Inversionen13, Kraftausdrücken [,,er kann mich im Arsch lecken", G. v. B.]. Oft stellt die Sprache die Rebellion gegen die Obrigkeit dar, was die vielen Fragen und Ausrufe bezeugen. Kraftausdrücke sind häufig, um dies zu unterstreichen, ob positiv oder negativ. Es herrscht keine Einheit mehr; in den Gedichten haben die Hebungen und Senkungen unterschiedliche Reihenfolgen, die Satzteile sind unterschiedlich lang. Insgesamt ist die Sprache des Sturm und Drang sehr gefühlsbetont und enthusiastisch14.
4. Bedeutung für die folgenden Epochen
Zwar war der Sturm und Drang eine sehr kurze Epoche von nur knapp 20 Jahren, doch ist seine Wirkung auch in anderen Epochen stark zu spüren. Da Goethe und Schiller bedeutende Vertreter des Sturm und Drangs aber auch der folgenden Weimarer Klassik waren, sind auch in den klassischen Werken Einflüsse der Geniezeit zu erkennen, wie in Schillers späteren Dramen ,,Don Carlos", ,,Die Jungfrau von Orleans" und ,,Wilhelm Tell". Man erkennt Herz, Freiheitsliebe und die Einzelpersönlichkeit. In seiner ,,Bürgschaft" kommt der Freundschaftsgedanke, der bis in den Tod führen könnte, voll zum Tragen. Die Romantik übernimmt neben der Aufklärung und der Liebe insbesondere das Naturgefühl, jedoch ist dieses abgeschwächter und lieblicher als im Sturm und Drang. Des weiteren lässt sich eine Verwandtschaft zu den Vormärz-Literaten wie Georg Büchner (*1813, _1837) und Friedrich Nietzsche (*1844, _1900) erkennen. Neben der ähnlichen politischen Absicht lässt sich u.a. eine Weiterentwicklung des Geniekults und antirationalistische (s. 2.) Grundtendenzen (wie im Sturm und Drang gegen die rationalistische (s. 1.) Aufklärung) feststellen.
5. Beispiel: Der junge Friedrich Schiller
1777 begann Schiller unter dem Eindruck der Aufklärung mit dem von sozialem Pathos15 getragenen Drama ,,Die Räuber". In diesem Stück thematisierte er die Ablehnung jeglicher Autorität und proklamierte16 einen absoluten17 Freiheitswillen. Schiller wurde damit zu einem zentralen Vertreter des Sturm und Drang (,,Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit").
Ende 1780 erhielt Schiller in Stuttgart eine - allerdings sozial sehr niedrig stehende Anstellung als Regimentsmedikus18 und führte dort als Reaktion auf die Entbehrungen während der Studienzeit ein ausschweifendes Leben. Nachdem er bereits zur bejubelten Uraufführung seines Dramas ,,Die Räuber" am 13. Januar 1782 nach Mannheim gereist war und damit die Landesgrenze unerlaubterweise überschritten hatte, musste er nach einem zweiten Mannheim-Aufenthalt im Mai desselben Jahres für zwei Wochen in Haft. Als der Herzog ihn außerdem mit Schreibverbot für jegliche literarische Produktionen belegte, floh Schiller unter Begleitung seines Freundes, des Klavierbauers Johann Andreas Streicher (*1761, _1833), nach Mannheim. Daraufhin reiste er als Vorsichtsmaßnahme weiter nach Frankfurt am Main und von dort nach Oggersheim, wo er sein Drama ,,Die Verschwörung des Fiesko zu Genua", in dem es um einen aufständischen Grafen und seinen Putsch gegen die Tyrannenherrschaft geht, umarbeitete.
Finanziell und psychisch angeschlagen, fand Schiller schließlich Aufnahme bei der Schriftstellerin Karoline Freifrau von Wolzogen (*1763, _1847) auf deren Gut Bauerbach bei Meiningen. Hier widmete er sich der Gattung des bürgerlichen Trauerspiels (s. 5.) mit dem Drama um die ,,verhassten Hülsen des Standes" ,,Luise Millerin" (später in ,,Kabale und Liebe" umbenannt).
Nach seiner Rückkehr nach Mannheim im Juli 1783 wurde Schiller Anfang September für ein Jahr Theaterdichter am Nationaltheater mit der Verpflichtung, jährlich drei Dramen fertig zu stellen. Anders als ,,Die Verschwörung des Fiesko zu Genua", dessen Aufführung zum Fiasko19 geriet, wurde ,,Kabale und Liebe" vom Mannheimer Publikum begeistert aufgenommen. Der Erfolg bescherte Schiller 1784 die Aufnahme in die renommierte20 Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft - das intellektuelle Zentrum der Pfalz. Seine am 26. Juni 1784 dort gehaltene Rede ,,Vom Wirken der Schaubühne auf das Volk" (bekannter unter dem Titel ,,Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet") bestimmte die Bühne als Platz menschlicher Ideale und übte auf die Entwicklung der deutschen Dramen und Theaterlandschaften bis hin zum Expressionismus und zu Bertolt Brecht (deutscher Dichter, Dramaturg; *1898, _1956) entscheidenden Einfluss aus.
6. Worterklärungen
Quellen:
Internet: www.hausarbeiten.de
Microsoft ® Encarta ® Enzyklopädie 2001
Der Brockhaus in einem Band, 1996
DUDEN - Die deutsche Rechtschreibung, 1996 DUDEN - Das Fremdwörterbuch, 1997
Hans-Dieter Gelfert: Wie interpretiert man ein Drama?, Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1998 Johann Wolfgang v. Goethe: Götz von Berlichingen, Königs Erläuterungen und Materialien, Bange, 1997
[...]
1. die Vernunft betreffend; vernünftig, aus der Vernunft stammend, von der Vernunft bestimmt
2. gegen den Rationalismus (s. 1.)
3. alle Gewalt unumschränkt in der Hand des Menschen liegend
4. Prüfung von Büchern und Theaterstücken, ggf. Verbot der Veröffentlichung
5. Zuschauer hofft auf die Bestrafung eines negativen Helden, der die moralische (das sittliche Verhalten betreffend) Schmerzgrenze überschreitet
6. philosophische Anschauung, die die Welt und das Sein von der Vernunft abhängig macht
7. schwärmerisch, rauschhaft
8. ausdrucksvoll, feierlich, gefühlvoll, empfindungsvoll
9. a) auf den einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse zugeschnitten
b) durch die Eigenart, Besonderheit u.Ä. der Einzelpersönlichkeit geprägt, je nach persönlicher Eigenart (verschieden)
10. bewegend
11. Ersparung, Auslassung von Redeteilen, die für das Verständnis entbehrlich sind
12. nur zum Schein (aus Gründen des sprachlichen Stils) gestellte Fragen, auf die keine Antwort erwartet wird
13. Umkehrung der üblichen Wortstellung Subjekt - Prädikat, d.h. die Stellung Prädikat - Subjekt
14. begeistert, schwärmerisch
15. leidenschaftlich-bewegter Ausdruck, feierliche Ergriffenheit
16. erklären, aufrufen, kundgeben
17. unbedingt, uneingeschränkt
18. Arzt einer militärischen Truppeneinheit
19. Misserfolg, Reinfall
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Literaturepoche ,,Sturm und Drang"?
Der Sturm und Drang war eine deutsche literarische Bewegung, die sich gegen die rationalen Gedanken der Aufklärung und die herrschende Ständeordnung auflehnte. Sie wird auch Geniezeit oder Genieperiode genannt.
Wann begann und endete der Sturm und Drang?
Der Beginn wird auf die Herausgabe von Johann Gottfried von Herders ,,Fragmenten" (1767) datiert, das Ende auf Schillers Werk ,,Kabale und Liebe" (1784) oder Goethes Abreise nach Italien (1786).
Was war der Ausgangspunkt des Sturm und Drang?
Ein Treffen zwischen Herder und Goethe in Straßburg im September 1770, bei dem Goethe Herders antirationalistische Philosophie übernahm.
Wie war die politische und gesellschaftliche Situation während des Sturm und Drang?
Absolutistische Herrscher regierten in Europa. Deutschland war in viele kleine Fürstentümer zersplittert, in denen Fürsten uneingeschränkte Macht ausübten. Schriftsteller waren von strenger Zensur betroffen.
Wer waren die Vorbilder der Literaten des Sturm und Drang?
Vor allem Shakespeare, aber auch die angelsächsische Literatur, insbesondere die ,,Ossian-Dichtungen". Jean-Jacques Rousseaus Lehre ,,Zurück zur Natur" war ebenfalls ein Vorbild.
Nenne Beispiele für Literaten und ihre Werke im Sturm und Drang.
- Friedrich Maximilian Klinger: Sturm und Drang, Die Zwillinge
- Johann Gottfried Herder: Journal meiner Reise, Ossian oder die Lieder alter Völker
- Jakob Michael Reinhold Lenz: Der Hofmeister, Die Soldaten
- Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Götz von Berlichingen, Clavigo, Ganymed, Prometheus
- Friedrich Schiller: Die Räuber, Kabale und Liebe, Die Verschwörung des Fiesko zu Genua
Welche literarischen Formen waren im Sturm und Drang vorherrschend?
Das Drama war am häufigsten vertreten. Romane waren selten und oft in Form von Tagebüchern oder Briefen. In der Lyrik löste das freie Lied das Gedicht der Aufklärung ab, und Volkslieder wurden wiederentdeckt.
Wie war die Sprache im Sturm und Drang?
Ekstatisch, pathetisch, schwärmerisch, spontan, emotional, individuell, dynamisch und voller Stilmittel. Oft rebellisch gegen die Obrigkeit.
Welche Bedeutung hat der Sturm und Drang für die folgenden Epochen?
Obwohl kurz, war der Sturm und Drang einflussreich. Einflüsse sind in der Weimarer Klassik, der Romantik und bei Vormärz-Literaten wie Georg Büchner und Friedrich Nietzsche erkennbar.
Wer war Friedrich Schiller im Kontext des Sturm und Drang?
Schiller war ein zentraler Vertreter des Sturm und Drang, insbesondere durch sein Drama ,,Die Räuber", in dem er die Ablehnung jeglicher Autorität und einen absoluten Freiheitswillen thematisierte.
Was sind einige Schlüsselbegriffe im Sturm und Drang?
Idealismus, Freundschaft, Freiheitsliebe, Naturgefühl, Rebellion gegen Obrigkeit.
- Quote paper
- Tino Wiesinger (Author), 2001, Sturm und Drang, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99706