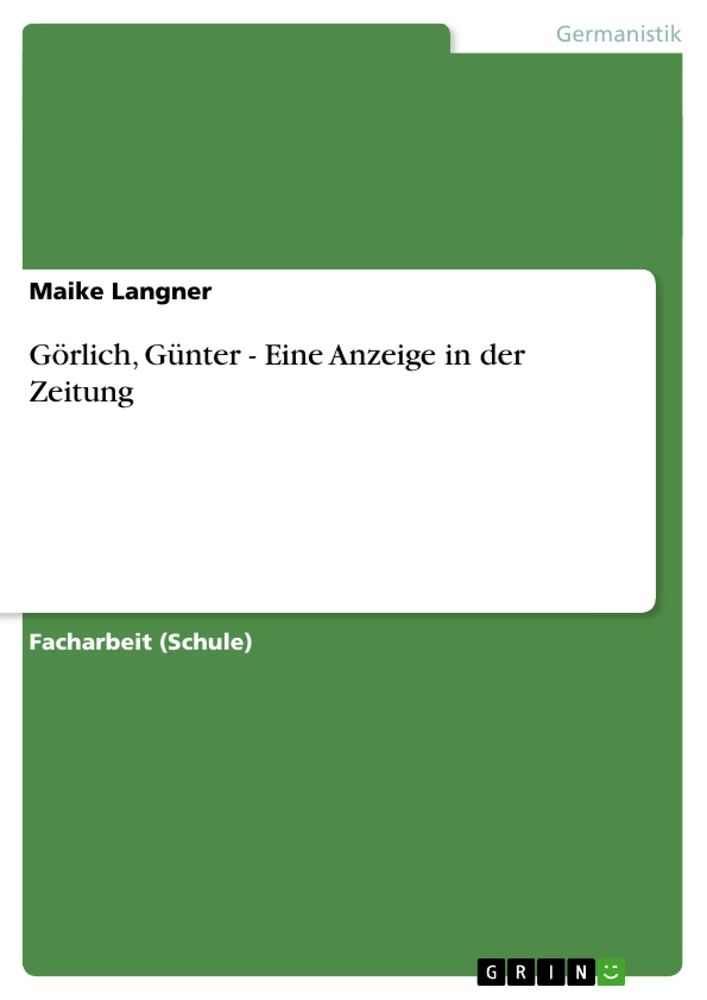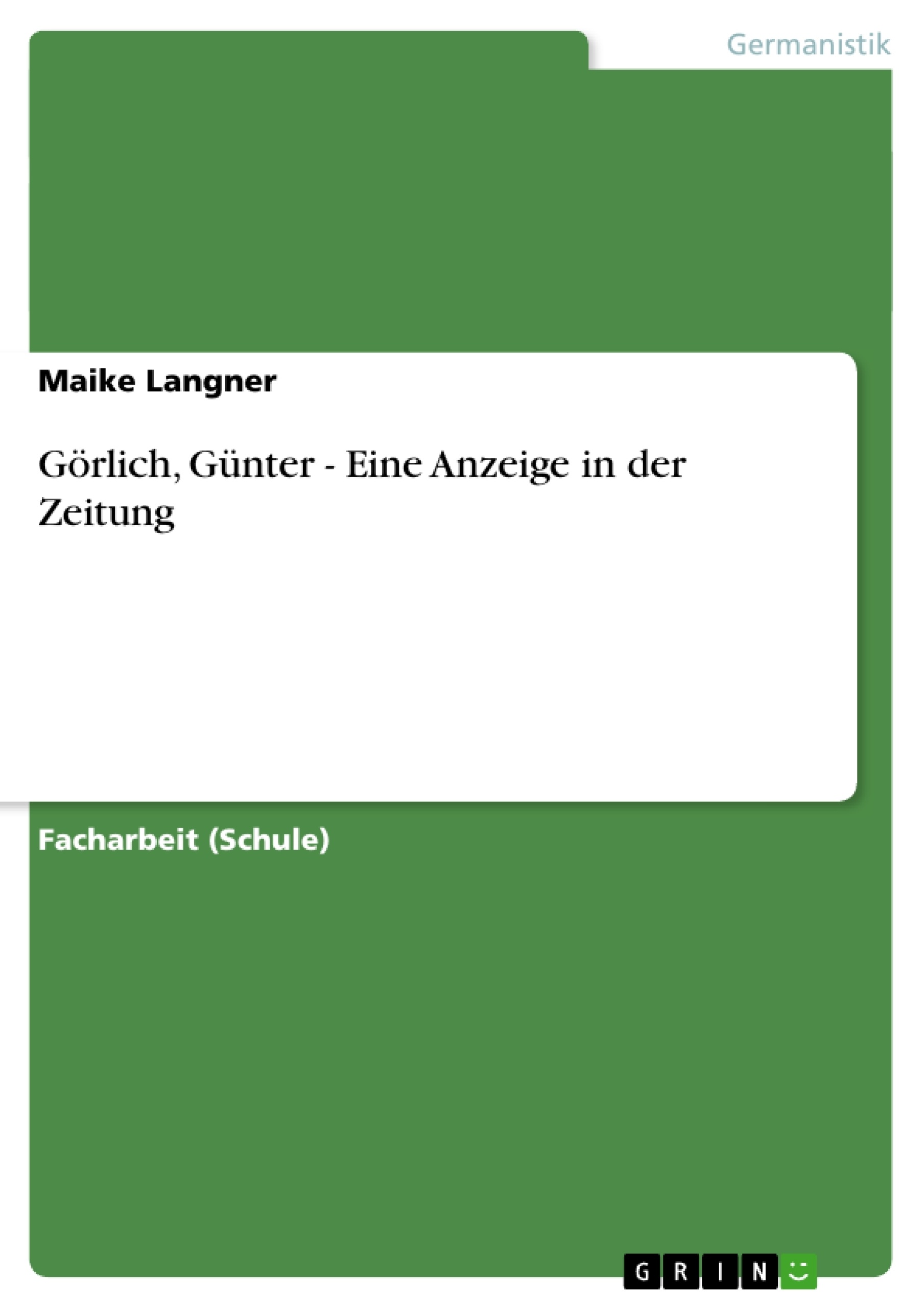Was verbirgt sich hinter einer schlichten Todesanzeige in der Zeitung? Günter Görlich entführt uns in seinem Roman „Eine Anzeige in der Zeitung“ in die DDR der 1970er Jahre, wo hinter der Fassade des sozialistischen Alltags tiefe menschliche Abgründe lauern. Als Herbert Kähne, ein stellvertretender Schuldirektor, im Urlaub die Nachricht vom plötzlichen Tod seines Kollegen Manfred Just entdeckt, beginnt er, an den offiziellen Erklärungen zu zweifeln. Getrieben von einem unstillbaren Durst nach Wahrheit, taucht Kähne immer tiefer in das Leben des Verstorbenen ein. Seine Nachforschungen führen ihn zu Anne Marshall, der Geliebten Justs, und zu den Schülern der 10b, die unter dem Verlust ihres außergewöhnlichen Klassenlehrers leiden. Doch je näher Kähne der Wahrheit kommt, desto mehr gerät er in Konflikt mit dem sturen Schuldirektor Strebelow, der die Fassade der Ordnung um jeden Preis aufrechterhalten will. War es wirklich ein tragischer Unglücksfall, wie behauptet wird, oder verbirgt sich hinter Justs Tod ein düsteres Geheimnis? „Eine Anzeige in der Zeitung“ ist nicht nur ein spannender Kriminalroman, sondern auch ein eindringliches Porträt der DDR-Gesellschaft, in der Konformität und Anpassung oft höher geschätzt werden als individuelle Freiheit und Wahrheit. Es ist eine Geschichte über Mut, Zivilcourage und die Suche nach dem Sinn des Lebens angesichts von Verlust und Enttäuschung. Görlichs Roman, ein Schlüsselwerk der DDR-Literatur, thematisiert auf subtile Weise die gesellschaftlichen Zwänge und die innere Zerrissenheit des Einzelnen im Spannungsfeld von Ideologie und Realität. Die detailreichen Schilderungen des Schulalltags und die vielschichtigen Charaktere machen dieses Buch zu einem fesselnden Leseerlebnis, das auch heute noch zum Nachdenken anregt. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Schweigen oft lauter spricht als Worte und in der die Wahrheit manchmal einen hohen Preis fordert. Eine Geschichte über Freundschaft, Verrat und die unerbittliche Suche nach der Wahrheit in einer Gesellschaft, die oft mehr Wert auf Schein als auf Sein legt.
Gliederung
1 Günter Görlich
2 Weitere Werke
3 ,,Eine Anzeige in der Zeitung" von Günter Görlich
3.1 Inhaltsangabe
3.2 Personencharakteristik
3.3 Aufbau des Buches
3.4 Personenkonstellation
3.5 Stilistik
3.6 Persönliche Auseinandersetzung
4 Autorenintention
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anlagen
Erklärung
1 Günter Görlich
Günter Görlich wurde am 06.01.1928 in Breslau geboren. In der DDR war er ein Erzähler, sowie Jugendbuch- und Fernsehspielautor. Im Alter von 17 Jahren geriet Görlich in sowjetische Kriegsgefangenschaft.
Nachdem er 1950 bei der Volkspolizei war, arbeitete er nach einem kurzen Pädagogikstudium als Heimerzieher und Berufsausbilder. Anschließend war er als Redakteur und FDJ- Funktionär tätig. 1958 bis 1961 studierte er am Institut für Literatur ,,Johannes R. Becher" in Leipzig. 1960 und 1966 erhielt er den FDGB-Literaturpreis und 1962 den Kunstpreis der FDJ.
Görlich zählt zu den bekanntesten Jugendbuchautoren der DDR. Anfang der 50er Jahre debütierte er mit Kurzgeschichten und kleineren Erzählungen. Seinem ersten erfolgreichen Jugendbuch, ,,Der schwarze Peter" (1958) folgte mit der Erzählung ,,Die Ehrgeizigen" (1959) die spannend geschriebene Geschichte eines durch Konflikte auf die Probe gestellten Lehrlingskollektivs.
Görlichs Roman ,,Das Liebste und das Sterben" (1963) erzählt die Schicksale einer durch politische Gegensätze gespaltenen Arbeiterfamilie in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Der Autor stellt die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten menschlicher Geschehnisse ins Sinnbildhaft-Allgemeingültige.
In der spannenden Kindererzählung ,,Der verschwundene Schiffskompaß" (1969) verbindet Görlich Erinnerungen an die revolutionäre Vergangenheit (Matrosenaufstand in Kiel, Kämpfe 1918 in Berlin) mit der sozialistischen Gegenwart.
Görlichs Entwicklungsroman ,,Den Wolken ein Stück näher" (1971), für den er u. a. 1971 einen Nationalpreis der DDR erhielt, greift Probleme junger Menschen auf: Ein Schülerkollektiv wird durch den plötzlichen Tod des verehrten Lehrers auf eine harte Probe gestellt. Das erwachende Bewußtsein der Mitverantwortung für alle, die Spannung zwischen der Gewißheit, kommende Aufgaben zu lösen, und der Ungewißheit, wie das geschehen wird, sind mit realistischer Kraft gestaltet.
2 Weitere Werke
Das Opfer (1958)
Feinde (1958)
Wilhelm Rochnow ärgert sich (1958) Unbequeme Liebe (1965)
Wochenendurlaub (1965)
Der Fremde aus der Albertstraße (1966) Das verlorene Jahr (1967)
Auropanne (1967)
Eine Sommergeschichte (1969) Eine Anzeige in der Zeitung (1978) Die Chance des Mannes (1982) Drei Wohnungen (1987)
Artikel in der Jugendzeitschrift der DDR ,,Junge Welt"
3 ,,Eine Anzeige in der Zeitung" von Günter Görlich
Beim Stöbern im Bücherregal fiel mir das Buch ,,Eine Anzeige in der Zeitung" von Günter Görlich auf, da es einen seltsamen Umschlag trug, und ich mir unter dem Titel nicht viel vorstellen konnte. Also las ich mir den Kurzinhalt durch und als ich bemerkte, dass dieser Titel etwas mit der Todesanzeige eines Lehrers zu tun hatte, überlegte ich mir, dass das unsere Klasse genauso betreffen könnte und begann mit dem Lesen.
3.1 Inhaltsangabe
Herbert Kähne, stellvertretender Direktor an der POS in der Stadt L., und seine Frau Eva sind im Urlaub im Kaukasus. Alles ist perfekt, bis sie drei Tage vor ihrer Abreise die Todesanzeige des Kollegen Manfred Just in der Zeitung vom 12. August entdecken. Mit dieser Nachricht war ihr Urlaub verdorben. Als die beiden wieder daheim ankommen, setzt Herbert alle Mittel ein, um die wahren Hintergründe des Todes von Just herauszufinden, da man zunächst von einem Selbstmord ausgeht, der sture Direktor aber behaupted, dass es dafür nicht die geringsten Beweise gäbe.
Herbert Kähne erinnert sich an alle Einzelheiten der letzten beiden Jahre mit dem Kollegen Just. Der durch seine Extravagansen, seine grellfarbene Kleidung, sein längeres Haar und seine bunten Seidentüchlein um den Hals etwas außergewöhnlich wirkende junge Kollege, brachte den Direktor Strebelow regelmäßig zum Zorn und deshalb macht sich dieser keine Gedanken um den plötzlichen Tod Justs. Im Gegenteil, er ist sogar froh darüber, dass nun wieder alles geregelt läuft, und es keinen gibt, der anders ist. Herbert versteht das überhaupt nicht und will jetzt erst recht wissen, was wirklich passiert ist. Er versucht sich der Geliebten Justs, Anne Marshall, eine junge Kollegin der POS, zu nähern, da er annimmt, durch sie alles zu erfahren. Denn wer weiß sonst alles über Just, wenn nicht sie? Zunächst verweigert sie Herbert ihr Wissen, entschließt sich dann aber doch die letzten Briefe, die ihr Just schrieb, preiszugeben. Und somit erfährt Kähne, warum es zu so einer Tragödie kommen konnte.
3.2 Personencharakteristik
Herbert Kähne
Er ist der stellvertretende Schulleiter in der POS der Stadt L. Er ist der Ich-Erzähler im Roman und wird als gutmütiger Mann im mittleren Alter dargestellt, der seinen Beruf als Lehrer ernst nimmt und liebt. Er lebt mit seiner Frau, die er über alles liebt, in L. und hat zwei Kinder mit ihr, Alexander und Marlis. Er will dem Tod des Kollegen Just auf den Grund gehen.
Eva Kähne
Sie ist die Gattin Herberts und arbeitet als Angestellte in einem Literatur-Verlag.
Sie wird als schlanke, zierliche und sensible Person dargestellt, die Spaß am Leben hat. Sie ist stark erschüttert über den Tod Justs, da sie eine starke Verbindung mit ihm hatte. Sie diskutiert tagelang mit Herbert über ihn.
Manfred Just
Es handelt sich um einen jungen Mann, mitte dreißig, der die Hauptrolle im Roman spielt. Er kommt aus der EOS in der Stadt P. nach L. an die POS. Am ersten Schultag fällt er durch seine weißen Flanellhosen, sein zitronengelbes Hemd mit offenem Kragen und sein buntes Seidentüchlein auf. Er wird als selbstsicher, extravagant, ironisch, lustig und seine Arbeit liebend dargestellt. Doch dieses ,,anders sein" gefällt dem Direktor gar nicht. Er wird der Klassenlehrer der damaligen 8b.
Anne Marshall
Sie ist die Auserwählte Justs, eine schlanke, blondhaarige junge Frau, die zehn Jahre jünger ist als er. Sie hat den meisten Kontakt zu ihm, und ist die einzige, die weiß, wie es um ihn steht. Nach dem Tod war sie die einzige, die die Schüler der 10b aufklärt, was mit Just geschah, dass es kein Tod ,,auf tragische Weise" war, wie es Strebelow beteuerte, sondern ein Selbstmord. Da sie der Weisung des Direktors keine Folge geleistet hat, bedroht er sie schließlich mit einem Disziplinarverfahren.
Mark Hübner
Er ist ein Schüler der damaligen 8b (jetzt 10b), dem der Kollege Just einmal geholfen hat, als er sich betrank, weil sein Vater seine Mutter geschlagen hatte. Er hat den Tod Justs am schlechtesten verkraftet und sucht Rat bei Herbert Kähne.
Sportlehrer Tetzlaff
Er ist der neue Klassenlehrer der 10b, da er nicht viel mit Just zu tun hatte und ihn auch nicht besonders mochte, hat er keine Schwierigkeiten mit dem Tod fertig zu werden. Außerdem ist er ähnlich wie Strebelow, alles muß perfekt sein, Ausnahmen werden nicht geduldet. Er ist ein strenger Lehrer, der seine Tätigkeit liebt und glaubt, die Schüler wieder auf den rechten Weg zu bringen.
Karl Strebelow
Er ist der Direktor der POS in L. Es handelt sich bei ihm um einen sehr sturen Kopf, der immer Recht hat, genau weiß, was richtig ist und der solche Ausnahmen wie Just nicht duldet. Er beauftragt Herbert, dass dieser den Manfred Just beobachten soll.
3.3 Aufbau des Buches
Der Roman ,,Eine Anzeige in der Zeitung" von Günter Görlich ist in drei große Abschnitte geteilt, die im Buch mit römischen Zahlen gekennzeichnet sind.
Der erste Teil beginnt mit der Beschreibung des Urlaubs von Herbert und Eva Kähne, wobei in den ersten Seiten immer wieder auf die Zeit geblendet wird, als Herbert die Todesanzeige gelesen hat. Somit erhält man ein klares Bild davon, dass dieser erste Teil in der Vergangen- heit spielen muß, und nicht gerade erst beim Geschehen erzählt wird.Vorwiegend wird in der Ich-Perspektive von Herbert Kähne berichtet, der diese ganze Geschichte erzählt. Nur vereinzelt kommen Monologe mit seiner Frau Eva vor. Die Handlung wird fortgeführt, bis den beiden drei Tage vor ihrer Abreise eine Zeitung in die Hände fällt, in der sie die Todesanzeige des Kollegen Just entdecken.
,,Die Sterne standen tief und sehr klar über den Bergen und dem Meer. An diesem Abend, da wir die Anzeige in der Zeitung gelesen hatten, konnten wir uns an ihrem Anblick nicht erfreuen." 1
Mit diesen beiden Sätzen endet das erste Kapitel und ein neues beginnt in der Zeit der Gegenwart. Herbert und Eva kommen zu Hause an und Herbert geht sofort zu Strebelow, um herauszufinden, was mit seinem verehrten Kollegen Just geschehen ist. Eva und er hatten sich im Urlaub schon die schlimmsten Geschichten ausgedacht.
,,Ich dachte, dass er vielleicht mit seinem Motorrad verunglückt sei. [...] Was sollte denn sonst passiert sein? Infarkt? [...]" 2
,,[...] `Was war mit Manfred Just?` fragte ich, kaum daß ich gegrüßt hatte. [...] ,Woran ist er gestorben?` 3
,An einer Überdosis Tabletten`, sagte Karl Strebelow nüchtern.
,Er hat sich das Leben genommen?`[...]
,Natürlich hat man untersucht, es gibt jedoch keine Beweise.`
,Ein Versehen also? Ein Unglücksfall?`
,Ja, das kann man annehmen` [...]" 4
Mit dieser Aussage des Direktors gibt sich Herbert keineswegs zufrieden, er kann einfach nicht glauben, dass man eine Überdosis Tabletten aus Versehen nimmt.
Er berichtet alles seiner Frau und denkt als nächstes an die Klasse 10b, die die letzten beiden Jahre den Klassenlehrer Just hatte und sicherlich stark deprimiert ist, da alle sehr gut mit ihm auskamen. Vor allem muss es Mark Hübner stark getroffen haben. Dieser hielt besonders viel von Just, da ihm dieser einmal in einer schlimmen Situation als einziger zur Seite stand.
Am ersten Schultag im neuen Jahr bekommt die Klasse 10b den Sportlehrer Tetzlaff als neuen Klassenlehrer, der genau wie Strebelow die Meinung vertritt, dass Just auf tragische Weise gestorben sei.
Anne Marshall jedoch hält dieses Verschweigen der Wahrheit nicht länger aus und sagt den Schülern der Klasse 10b, dass sie genau wisse, dass es sich um einen Selbstmord gehandelt hat. Daraufhin wendet sich der nun verstört wirkende Mark Hübner an Herbert, um die Gründe für diesen Selbstmord zu erfahren. Als ihm dieser keine Auskunft geben kann, entfernt sich Mark Hübner rasch von ihm, in der Annahme, dass die Lehrer nichts sagen wollen, weil die Schüler solche Tatsachen nichts angehen. Da Herbert selbst nichts weiß, beschließt er, mit Anne Marshall zu reden, diese gibt ihm jedoch auch keine Auskunft, also versucht es Kähne bei Justs Vater in Berlin - erfolglos.
Nachdem Strebelow erfahren hat, dass Anne Marshall der Klasse die Wahrheit gesagt hat, droht er ihr mit einem Disziplinarverfahren. Herbert setzt sich für sie ein mit dem Ergebnis die letzten Briefe Manfred Justs an Anne Marshall zu bekommen.
,,[...] Lieber Herbert, ich habe mich nun doch entchlossen, Dir die Briefe, die mir Manfred in diesem Sommer, also kurz vor seinem Tode, geschrieben hat, zur Einsicht zu geben. Ich habe lange mit mir gekämpft. Ich glaube aber heute, daß Du sie lesen mußt. Sonst aber niemand. Doch eine Ausnahme würde ich erlauben. Wenn du meinst, soll auch Eva die Briefe lesen.
Gruß, Eure Anne" [...] 5
Mit diesen Briefen Manfreds befasst sich das dritte Kapitel. Man kann sagen, dass dieser Teil die Überschrift ,,Lösung" tragen müsste, da man in diesem Abschnitt aufgeklärt wird, warum Just ,,das" getan hat.
Er hatte eine unheilbare Krankheit, mit der er zwar hätte weiterleben können, aber nur als Invalide, also hätte er seine geliebte Arbeit nicht mehr ausführen können.
,,Und dann habe ich erfahren, daß mein Leben, so wie ich es geführt habe, wie ich es gern hatte, vorbei ist. Ein anderes beginnt, das Leben eines Invaliden. [...]"
,,[...] Leben? So leben? Nicht arbeiten? Warum nicht arbeiten? Es wird sich schon was finden. Was finden? Was denn? Vor Schülern werde ich nicht stehen können. [...]" 6
Herbert kennt nun endlich den Grund und versteht, warum Just so gehandelt hat.
3.4 Personenkonstellation
Eva Kähne - Herbert Kähne
Diese beiden sind verheiratet und lieben sich über alles. Sie leben in einer ehrlichen konstruktiven Beziehung.
Eva Kähne - Manfred Just
Sie hatten ein gutes Verhältnis miteinander. Manfred hat Eva bei ihrem ersten Aufeinandertreffen sehr stark umschwärmt und Eva gefiel dies. Es bildete sich eine innige Freundschaft heraus.
Herbert Kähne - Manfred Just
Zunächst war Herbert nicht gut auf ihn zu sprechen, da er zu viel frischen Wind in die Schule brachte, er war anders, als alle anderen Lehrer. Doch ein Stück später interessierte er sich sehr stark dafür, was Just tat, wie er unterrichtete, wie er mit den Schülern umging und schließlich kam es auch zwischen den beiden zu einer Freundschaft. In schwierigen Situationen stand Herbert Just bei und machte sich somit bei Strebelow unbeliebt.
Anne Marshall - Manfred Just
Als Anne Marshall vor einem Jahr an die Schule kam, wollte Just sie sofort kennlernen. Die zwei unternahmen viel und wurden schließlich ein Paar.
Mark Hübner - Manfred Just
Auf einer Klassenfahrt in die Umgebung von L. betrank sich Mark, da er am Morgen Zeuge wurde, wie sein Vater seine Mutter schlug und ihn das stark mitnahm. Als Just das bemerkte nahm er die ganze Klasse mit zu sich nach Hause, damit sich Mark wieder ausnüchtern konnte. Just hätte diesen Vorfall melden müssen und fragte deshalb nach den Ursachen für den Alkoholkonsum. Mark erklärte ihm alles und versprach, niemandem etwas davon zu erzählen, somit war Just der Held für Mark.
Herbert Kähne - Karl Strebelow
Zu Beginn der Handlung verstanden sich die beiden sehr gut, sie waren sogar sehr gute Freunde und trafen sich öfters, bis Just an die Schule kam. Für Streblow war er anders, er passte nicht dazu, aber auf Herbert wirkte er interessant. Dadurch, dass Herbert Just in verschiedenen Situationen beistand, entfernten sich Strebelow und Herbert immer mehr, am Ende kündigte Strebelow ihm sogar die Freundschaft deshalb.
Herbert Kähne - Anne Marshall
Herbert war auf sie eifersüchtig, da sich Just mehr mit ihr abgab, als mit ihm, doch dann redete er öfter mit ihr, versuchte ihr zu helfen, den Tod zu verarbeiten und erlangte schließlich das Vertrauen von ihr, dass er sogar die letzten Briefe Manfreds lesen durfte.
3.5 Stilistik
Der Erzähler, der vom Autor als Herbert Kähne bezeichnet wird, erzählt in der Ich-Form. Die erste Seite des Romans enthält keine wörtliche Rede. Herbert Kähne berichtet kurz von den Hintergründen des Urlaubs und somit bekommt man eine Einführung und kann sich den Handlungsort und die Handlung gut vorstellen. Mir ist zunächst aufgefallen, dass der Erzähler die Orte, in denen die Haupthandlung spielt nur mit der Stadt L. und der Stadt P. bezeichnet. Außerdem stellt der Erzähler viele Fragen an sich, die er teilweise sofort beantwortet. Doch am meisten ragt meiner Meinung nach die Dreiteilung des Buches heraus, bei der deutlich wird, dass Görlich erst in der Vergangenheit berichtet und schließlich in die Gegenwart übergeht. Alle drei Kapitel haben fast den selben Umfang an Seiten, wobei einem der zweite Teil beim Lesen am längsten vorkommt, da dort in allen Einzelheiten berichtet wird. Das Benutzen eines Selbstmordmotives ist ein Merkmal der Zeit, als der Roman geschrieben wurde (verweise auf Autorenintention). Ein weiteres auffallendes Stilmittel ist die Wahl der Namen der Personen.
Kähne verkörpert meiner Meinung das Mitschwimmen im Strom, genauso sein wie jemand anderes.
Just verkörpert das Spontane, das Aufgeschlossene, das Lebensfrohe, man weiß nie, was jetzt passiert.
Strebelow verkörpert das Exakte, das Strenge, das Streben, das Autoritäre, das Unverständnis. Marshall verkörpert das Genaue, das Zielstrebige, neuer Wind, militärische Exaktheit.
Eva verkörpert das kleine liebe Mädchen, dass doch nicht frei ist von Sünden, wie bei Adam und Eva.
Und ich denke, dass die Namen an die richtigen Personen verteilt wurden .
Im Buch wird sehr häufig die Stadt Berlin genannt, da dort Justs Vater lebt und Just selbst dort begraben ist. Aber was sind die Städte L. und P. und warum schreibt der Autor sie nicht aus? Auf jeden Fall müssen sie in der Nähe von Berlin liegen: ,,[...] Er wird schon unser L. kennenlernen. Eine junge Stadt am Rande von Berlin, das mit der Bahn in einer knappen Stunde zu erreichen ist. Und auch nicht weit von der Bezirksstadt P. entfernt. [...]" (5) Daraus schlußfolgerte ich, dass es sich bei der Stadt P. nur um Potsdam und bei L. nur um Ludwigsfelde handeln kann, da diese sich unmittelbar in er Nähe von Berlin befinden. Mit dieser Anonymität will er möglicherweise die Schule schützen, an der so etwas geschah, jedoch erkennt man ja doch, um welche Orte es sich handelt. Doch es könnte ja sein, dass er durch diese Abkürzungen darstellen will, dass so etwas nicht nur in Potsdam oder Ludwigsfelde, sondern auch in allen anderen Städten der DDR hätte passieren können.
3.6 Persönliche Auseinandersetztung
Das Buch ist relativ leicht zu lesen, es befasst sich mit dem Problem der DDR - Zeit und somit finde ich es recht interessant. Durch den Ich - Erzähler, der selbst eine Rolle spielt, kann man sich alles sehr gut vorstellen. Das Motiv des Selbstmordes interessiert mich persönlich sehr stark, weil ich es nicht verstehen kann, dass Menschen zu so etwas in der Lage sind. Ich kann dieses Buch jedem weiterempfehlen, vor allem auch, weil es sich um eine Schulsituation handelt und somit kann so etwas bei uns auch einmal zutreffen.
4 Autorenintention
Der Autor wählt das Motiv des Selbstmordes, welches auch eine große Rolle in anderen Romanen in der Zeit um 1978 spielt, wie zum Beispiel in C. Wolfs Roman ,,Kindheitsmuster". Der Selbstmord dient als Ausweg aus dem bestimmten Leben der DDR. Manfred Just ist für sein Leben gerne Lehrer, er liebt die Kinder, das Schulklima und die Kollegen, es ist sein Leben und auf einmal erfährt er, dass er diesen Beruf nie mehr ausführen kann, aufgrund einer unheilbaren Krankheit, die ihn zum Invaliden macht. Sein Lebenswerk ist zerstört und er sieht nur noch einen Ausweg, den Selbstmord, die Erlösung von den Qualen. Auf was soll er sich freuen? Er ist in der DDR eingeschlossen und glaubt, dass es nur noch diesen einen Weg in die Freiheit gibt. Görlich kritisiert damit die gesellschaftlichen Zwänge. Der Selbstmord ist etwas, was überhaupt nicht in die sozialistische Philosophie passt. Deshalb sollen die Schüler auch nichts davon erfahren. Die Entscheidungsfreiheit ist im Sozialismus weitgehend eingeschränkt. Just stößt nur auf Hindernisse bei neuen Ideen und Methoden. Wenn er nun seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, bewirkt er gar nichts mehr.
Als einziger Weg freier Entscheidung erscheint ihm der Freitod. Damit siegt er auch gegenüber allen Widersachern. Er hat das ,, letzte Wort"!
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR, Erweiterte Neuausgabe
2. Auflage
Gustav Kiepenheuer Verlag GmbH, Leipzig 1996
Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller I VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1972
Erklärung
Ich erkläre, dass ich diese Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln verfasst habe.
Falkenstein, 3. Januar 2001
Anlage 1
Zitat aus ,,Kleine Literaturgeschichte der DDR", Kiepenheuer Verlag 1996, Wolfgang Emmrich
Anlage 2
Leseprobe aus ,,Eine Anzeige in der Zeitung" , Verlag Neues Leben Berlin, 1978, Günter Görlich
Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Gymnasium Falkenstein Lektüreempfehlung
Autor der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts Fach Deutsch
Eine Anzeige in der Zeitung von
Günter Görlich
Maike Langner, Klasse 10 b
Abgabetermin: 01-01-05
[...]
1 Günter Görlich: Eine Anzeige in der Zeitung. Verlag Neues Leben Berlin 1978 5. Auflage 1981, S. 79
2 Günter Görlich: Eine Anzeige in der Zeitung. Verlag Neues Leben Berlin 1978 5. Auflage 1981, S. 80
3 Günter Görlich: Eine Anzeige in der Zeitung. Verlag Neues Leben Berlin 1978 5. Auflage 1981, S. 81
4 Günter Görlich: Eine Anzeige in der Zeitung. Verlag Neues Leben Berlin 1978 5. Auflage 1981, S. 82
5 Günter Görlich: Eine Anzeige in der Zeitung. Verlag Neues Leben Berlin 1978 5. Auflage 1981, S. 154
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Eine Anzeige in der Zeitung" von Günter Görlich?
Das Dokument ist eine umfassende Analyse des Buches "Eine Anzeige in der Zeitung" von Günter Görlich. Es enthält eine Gliederung, Informationen über den Autor Günter Görlich, eine Inhaltsangabe des Buches, Personencharakteristiken, eine Analyse des Aufbaus, der Personenkonstellation und des Stils des Buches, sowie eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Werk und eine Diskussion der Autorenintention. Abschließend sind Quellen- und Literaturverzeichnis sowie eine Erklärung enthalten.
Wer war Günter Görlich?
Günter Görlich war ein DDR-Autor, der am 06.01.1928 in Breslau geboren wurde. Er war Erzähler, Jugendbuch- und Fernsehspielautor. Er geriet als Jugendlicher in sowjetische Kriegsgefangenschaft und war später als Heimerzieher, Berufsausbilder, Redakteur und FDJ-Funktionär tätig. Er studierte am Institut für Literatur ,,Johannes R. Becher" in Leipzig und erhielt mehrere Auszeichnungen für sein Werk.
Worum geht es in "Eine Anzeige in der Zeitung"?
Die Geschichte dreht sich um Herbert Kähne, einen stellvertretenden Direktor, der im Urlaub im Kaukasus ist. Dort entdeckt er in der Zeitung die Todesanzeige seines Kollegen Manfred Just. Zurück in der Stadt L. versucht Herbert, die wahren Umstände des Todes von Just herauszufinden, da er nicht an einen Unfall glaubt. Er befragt Kollegen und die Geliebte Justs, Anne Marshall, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Letztendlich stellt sich heraus, dass Just aufgrund einer unheilbaren Krankheit Selbstmord begangen hat.
Wer sind die Hauptpersonen in dem Buch und wie werden sie charakterisiert?
Herbert Kähne: Stellvertretender Schulleiter, gutmütig, nimmt seinen Beruf ernst, will die Wahrheit über Justs Tod herausfinden.
Eva Kähne: Herberts Frau, arbeitet in einem Verlag, sensibel, erschüttert über Justs Tod.
Manfred Just: Junger, unkonventioneller Lehrer, der aneckt, stirbt unter tragischen Umständen.
Anne Marshall: Justs Geliebte, junge Kollegin, kennt die Wahrheit über seinen Tod.
Karl Strebelow: Sturer Direktor, der Justs Andersartigkeit nicht akzeptiert und den Vorfall herunterspielen will.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Der Roman ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beschreibt den Urlaub von Herbert und Eva Kähne und die Entdeckung der Todesanzeige. Der zweite Teil handelt von Herberts Nachforschungen und den Reaktionen der Kollegen und Schüler. Der dritte Teil enthält die Briefe von Manfred Just an Anne Marshall, die die Gründe für seinen Selbstmord offenbaren.
Welche Themen werden in dem Buch behandelt?
Das Buch behandelt Themen wie Schuld, Verantwortung, Andersartigkeit, Akzeptanz, gesellschaftliche Konventionen und den Umgang mit dem Tod. Es spiegelt auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR wider und kritisiert Zwänge und Einschränkungen.
Welche Autorenintention steckt hinter dem Buch?
Görlich kritisiert mit dem Roman die gesellschaftlichen Zwänge der DDR-Zeit. Der Selbstmord von Just wird als Ausweg aus einem bestimmten Leben dargestellt, welches durch eine unheilbare Krankheit eingeschränkt wird. Die fehlende Entscheidungsfreiheit und die Schwierigkeiten, neue Ideen umzusetzen, führen dazu, dass Just keinen anderen Ausweg sieht.
- Quote paper
- Maike Langner (Author), 2001, Görlich, Günter - Eine Anzeige in der Zeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99693