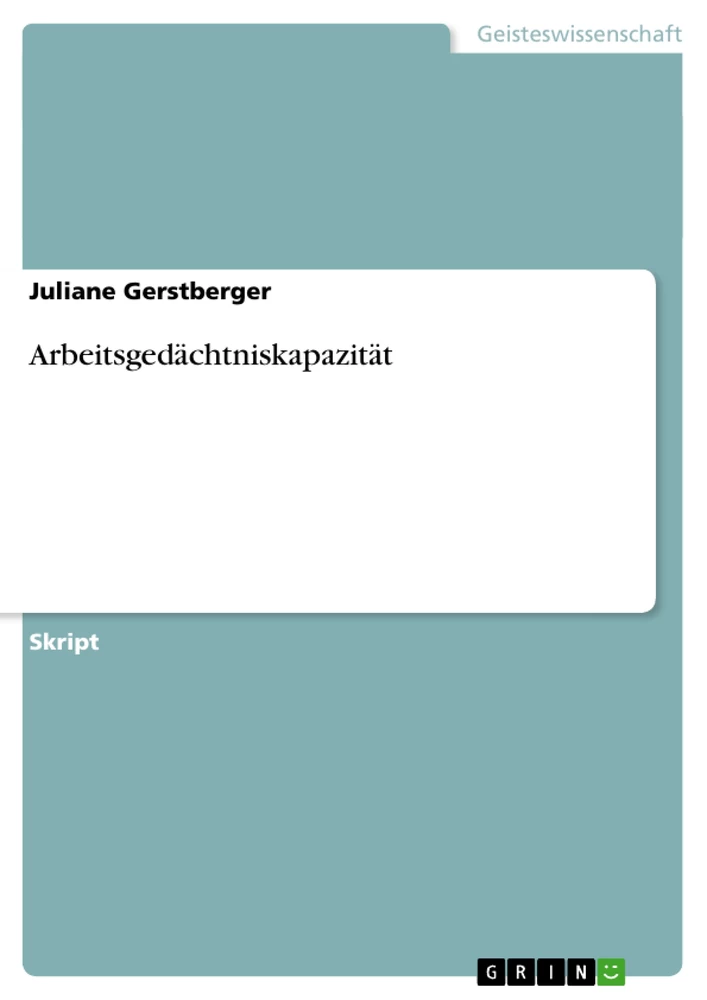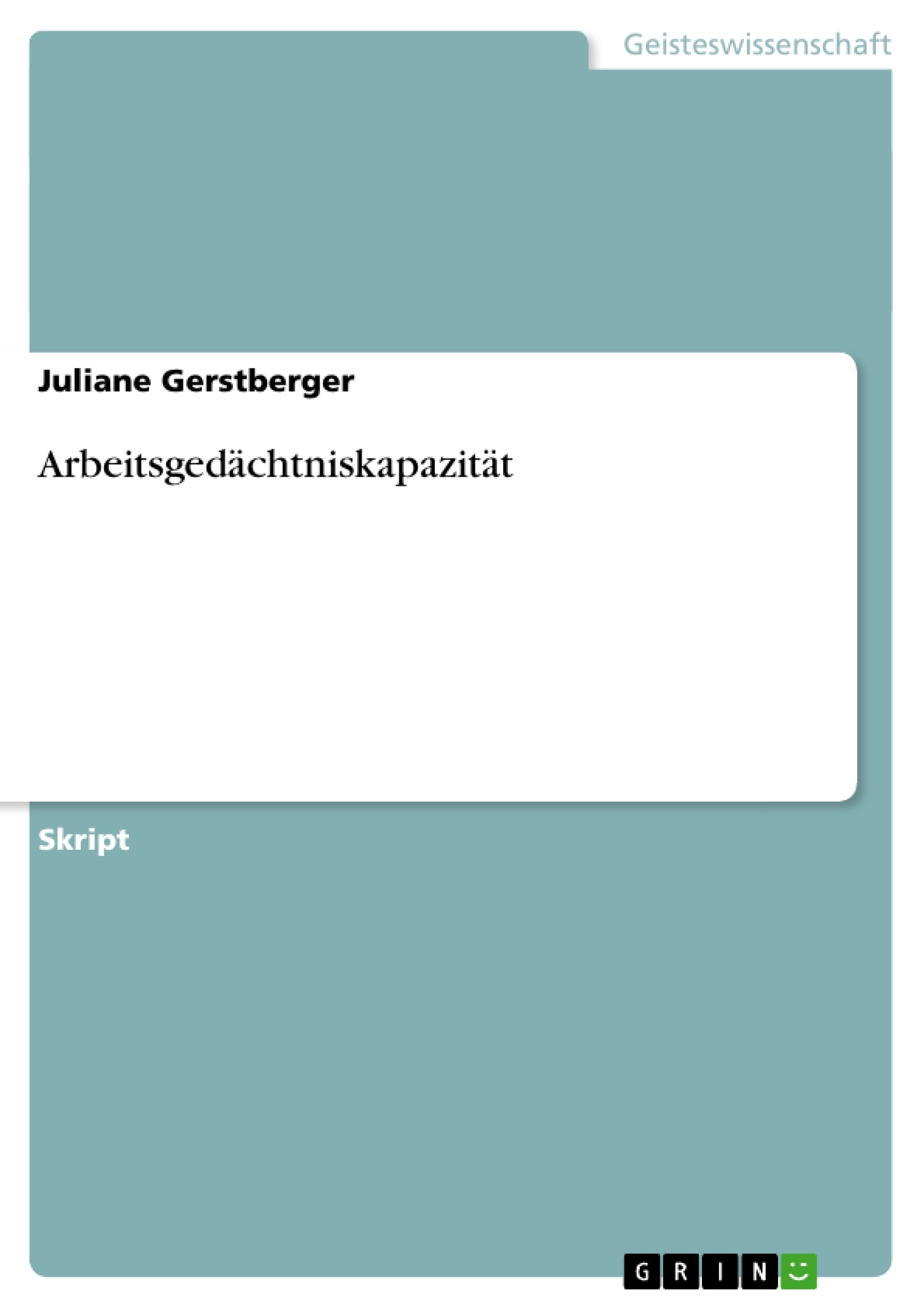1. Theoretischer Teil:
1.1. Einleitung und Fragestellung
In unserer Lehrveranstaltung „Experimentalpraktikum II“ beschäftigten wir uns mit dem Thema: „ ARBEITSGEDÄCHTNISKAPAZITÄT UND ZEITREPRODUKTION “. Gegenstand der Untersuchung waren folgende Fragestellungen:
Gelingt es der Versuchsperson die Zeit genauer zu reproduzieren d.h. die verstrichene Zeit nochmals vergehen zu lassen, wenn die Aufgabe, welche sie im ersten Teil der Untersuchung zu bearbeiten hatte einfacher zu lösen ist, als bei höherer Anforderung ? Fällt einer Versuchsperson mit hoher koordinativer Arbeitsgedächtniskapazität die exaktere Zeitreproduktion leichter, als einer Versuchsperson mit niedrigerer Arbeitsgedächtniskapazität ?
1.2. Zeiterleben, Zeitschätzung und Zeitreproduktion
Zeitreproduktion bezeichnet die Wiederherstellung eines Zeitintervalls. Das Reproduzieren eines Zeitintervalls wird dadurch erleichtert, daß Wahrnehmungsinhalte in Form von inneren Bildern (mentale Modelle) erinnert und gespeichert werden, welche zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen werden können. Durch Zeitschätzung läßt sich die Dauer eines Ereignisses bzw. die Dauer zwischen zwei Ereignissen beurteilen, herstellen oder reproduzieren. Diese Dauer läßt sich entweder durch Reproduktion der Zeitspanne definieren oder mit Hilfe einer numerischen Skala, z.B. Sekunden, Minuten und Stunden darstellen. Sieht man von numerischen Skalen ab, ist die Zeitwahrnehmung eine subjektive Erfahrung im menschlichen Bewußtsein. In unserem Experiment wollen wir feststellen, inwieweit sich durch subjektive Zeitwahrnehmung die Dauer eines Ereignisses reproduzieren läßt.
Theoretische Konzeptionen zur Zeitschätzung stammen aus der Physiologie bzw. Der Kognitionspsychologie. Physiologische Modelle münden explizit in der Annahme, daß irgendwo im Organismus ein „Zeitorgan“ existiert, das quasi als innere Uhr fungiert (Aschoff, 1985, zit von Funke, 1988). Leider konnte dieses sogenannte „Organ“ bis zum heutigen Tag noch nicht lokalisiert werden. Theorien zur Zeitschätzung unterscheiden sich danach, welche Faktoren als einflußreich beim Zustandekommen
von Zeittäuschung erachtet werden. Zeittäuschung bezeichnet man als Abweichungen der subjektiv empfundenen von der innerhalb eines begrenzten Intervalls tatsächlich vergangenen Zeit. In vielen Alltagssituationen erweisen sich subjektiv erlebte und objektiv verstrichene Zeit als diskrepant.
Die Annahme besteht, daß die Exaktheit der Zeitschätzung davon abhängt, ob die Tätigkeit, welche man während des zu reproduzierendes Zeitabschnittes ausführt, einem schwer oder leicht fällt. Ein Modell zu dieser Thematik stammt von Thomas und Weaver (1975). Das „processing effort“ - Modell, welches beschreibt, daß der kognitive Aufwand, den jemand in einer gegebenen Zeit betreibt, für die Zeitempfindung ausschlaggebend ist. Somit beeinflussen Speicher- und Abrufoperationen die Zeitschätzung. Die Zeitschätzung wird als separate Aufgabe begriffen ( „temporal task“). Je höher die nicht zeitbezogenen Aufgabenanforderungen bei gleicher Gesamtzeit sind, um so kürzer wird die subjektive Zeitempfindung wahrgenommen. Um die subjektive Zeitwahrnehmung der verschiedenen Versuchspersonen zu erfassen und zu vergleichen, mußten wir in unserem Experiment auf numerische Meßinstrumente (Uhr) zurückgreifen.
1.3. Das Arbeitsgedächtnis (working memory)
Als Arbeitsgedächtnis wird ein komplexes kurzfristige Gedächtnissystem bezeichnet, welches sowohl die zu verarbeitende Information speichert, wie auch Verarbeitungsprozesse gewährleistet. Die von dem Arbeitsgedächtnis zu einem Zeitpunkt aktivierte Informationsmenge kann Gegenstand der Verarbeitung durch kognitive Operation werden. Die Konditionierung von Prozeduren und Repräsentationen ist eine eigenständige Teilaufgabe und kommt als Quelle individueller Differenzen in Frage.
Es gibt verschiedene Theorien, die das Arbeitsgedächtnis beschreiben. Das differenzierteste Modell des Arbeitsgedächtnisses geht auf den Psychologen Allan Baddeley (1986) zurück. Nach seiner Theorie hat das Arbeitsgedächtnis nur eine begrenzte Kapazität und trägt aktiv zur Bearbeitung von Informationen bei, die zur Lösung von Aufgaben notwendig sind. Es hat eine zentrale Kontrollfunktion (central executive). Diese besteht darin, die eingehenden Informationen zu selektieren und zu koordinieren. Dieses geschieht durch Aufmerksamkeitsverteilung und Zuweisung von Verarbeitungsstrategien.
Die zentrale Exekutive hat mehrere Hilfssysteme, von denen wir zwei näher beschreiben:
1.) Die artikulatorische Rückkoppelungsschleife, welche nochmals in zwei Subsysteme unterteilt wird:
a.) ein phonologischer Speicher
b.) eine artikulatorische Wiederholungsschleife
2.) das Teilsystem für visuell-räumliche Informationsverarbeitung.
Abb.1: Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986)
(aus Schönpflug/Schönpflug, 1995, S.)
Die Koordinierung ist ein notwendiger Verarbeitungsaufwand zur Regulierung und Kontrolle des Informationsflusses zwischen Verarbeitungsschritten, wenn mindestens eine schrittweise Abstufung (Kaskadenstruktur) der zu beachtenden kognitiven Prozesse unterstellt wird (Carlson und Lundy, 1992). Eine Kaskadenstruktur besteht im wesentlichen aus einzelnen Operationen einer Abfolge, die interner Natur sind, die Repräsentation im Arbeitsgedächtnis erzeugen und für weitere Operationen bereitstellen. Entstehen Verluste bei den verschiedenen einzelnen Verarbeitungsschritten, so führt dies zu zusätzlichen „Kosten“ in Folge notwendiger Wiederholungen von Verarbeitungsprozessen. Mayr und Kliegel (1993) postulieren, daß unterschiedlichen Leistungen bei Anforderungen mit sequentieller und koordinativer Komplexität auf die Instabilität temporärer Repräsentation und damit auf die Funktionsweise zurückzuführen sind. Koordinative Komplexität verweist auf Anforderungen, die nicht durch unabhängige Teilschritte bearbeitet werden können. Bei der hingewiesenen Instabilität von Repräsentationen stehen die für notwendig koordinativen Aktivitäten im Vordergrund, welche sich im erhöhten kognitiven Aufwand ausdrücken. Um die Arbeitsgedächtniskapazität der Versuchsperson zu erfassen, bedienten wir uns zweier Aufgaben:
a.) verbale Koordination („Die Buchstabenaufgabe“,siehe Anhang).
b.) figural-räumliche Koordination („Die Schiffe-versenken-Aufgabe“,s.o.), (Aufgaben nach Oberauer, 1993, S.74 ff.)
Indem wir die figural-räumliche und verbale Koordinationsfähigkeit der einzelnen Versuchsperson untersuchten, beababsichtigten wir auf die individuelle Verarbeitungskapazität des Arbeitsgedächtnisses rückzuschließen. Die Aufgabe des Hauptversuchs beinhaltet zusätzlich eine dritte Anforderung an die Koordinationsfähigkeit:
den nummerischen Faktor.
Dieser nummerische Koordinationsfaktor geht auf das Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS) von Jäger, 1982/1984 zurück (aus Oberauer, 1993, S. 59):
(Abb. 1A: BIS von Jäger, 1982)
Jäger geht von zwei Facetten aus, welche sich in vier, bzw. drei Faktoren untergliedern lassen.
1.) „Die operative Facette“:
a.) Bearbeitungsgeschwindigkeit (B) b.) Merkfähigkeit (M)
c.) Einfallsreichtum (E)
d.) Verarbeitungskapazität (K)
2.) „Die inhaltsgebundene Facette“:
a.) verbal (V)
b.) figural (F)
c.) nummerische (N)
Für Oberauer (1993) stellt die „Verarbeitungskapazität“ den zentralen Begriff zum Verständnis des Arbeitsgedächtnisses und kognitiver Prozesse dar. Er definiert den Faktor „Verarbeitungskapazität“ nach Jäger (1982) folgendermaßen: „Verarbeitung komplexer Information bei Aufgaben, die nicht auf Anhieb zu lösen sind, sondern Heranziehen, Verfügbarhalten, vielfältiges Beziehungsstiften, formallogisch exaktes Denken und sachgerechtes Beurteilen von Information erfordern.“ (Oberauer, 1993, S. 59, nach Jäger, 1982).
1.4. Mentale Modelle
Man könnte ein mentales Modell als Konstrukt zur Kennzeichnung einer Wissensstruktur bezeichnen. Diese mentalen Modelle bestehen nur in der Kognition. Bezogen auf unseren Versuch würde das heißen, daß sich die Versuchsperson zur Zeitreproduktion kognitiver Konstrukte bedienen können, sofern es ihnen neben den Anforderungen der Koordinationsaufgaben noch gelingt.
Während der Übungsphase haben die Versuchsperson die Möglichkeit, sich ein Vorstellungsmodell der Lösungsstrategie zu entwerfen. Man kann davon ausgehen, daß verschiedene Versuchsperson auf den unterschiedlichen Gebieten (visuell, verbal und numerisch) Schwächen und Stärken haben. Auch die Zeitreproduktion wäre mit Hilfe eines mentalen Modells denkbar. Beispielsweise könnte eine Versuchsperson anhand der Erinnerung an die Ereignisse, die während des in Frage stehenden Zeitintervalls stattgefunden haben, die Dauer des Intervalls rekonstruieren oder er könnte die Anzahl der Items der zu lösenden Aufgabe als Rekonstruktionshilfe benutzen (z.B. die Zahlenreihen der Zählaufgabe, siehe Anhang).
Nach Schönpflug/Schönpflug (1995) ist es ungeklärt, inwieweit es sich bei mentalen Modellen um Vorstellungen, um Begriffe oder um Erinnerungen handelt. Hierbei stellt sich die Frage, ob mentale Modelle bewußt (explizit) oder unbewußt (implizit) sind. Zu Hinterfragen wäre auch, ob es notwendig ist, daß sie bewußt sind, denn eine innere Vorstellung setzt sich oft zusammen aus bewußtem und unbewußten, wobei man vielleicht später gar nicht mehr weiß, was einmal bewußt aufgenommen und später als unbewußt interpretiert wurde. Das Material, welches wir als menschliches Wissen bezeichnen, setzt sich zusammen aus Sprachlichem und Bildlichem, aus Erinnertem, Vorgestelltem und Gedachtem.
Nach Oberauer können kognitive Operationen als mentale Simulationen verstanden werden, die in einem semantischen Raum stattfinden. Dabei führt man vorgestellte Handlungen mit vorgestellten Gegenständen durch. Der semantische Raum umfaßt drei Dimensionen:
1. den physikalischen Raum
2. die Zeitdimension und
3. verschiedene Merkmalsdimensionen in denen mentale Inhalte verglichen und verändert werden können.
Oberauer nennt die mentalen Simulationsobjekte auch Sinnelemente („cognitive units“).
Mit diesen Sinnelementen baut man sich in einem semantischen Raum mentale Modelle auf. Diese Sinnelemente werden von ihm definiert als Objekte mit bestimmten Eigenschaften und in bestimmten Zuständen zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten.
1.5. Hypothese
„Die Arbeitsgedächtnishypothese besagt, daß die Begrenztheit der koordinativen Kapazität des Arbeitsgedächtnisses die Informationsgrundlage dieses mentalen Modells beeinträchtigen kann und so Einfluß auf die Zeitreproduktion nehmen kann“ (Dutke, 1997, Seite 60). Für unseren Versuch heißt das, daß Personen unter höheren Anforderungen an das koordinative Arbeitsgedächtnis bei der Bildung mentaler Modelle behindert sind, und somit die Zeit weniger exakt reproduzieren als Personen mit geringerer Anforderung an das koordinative Arbeitsgedächtnis. Wir gehen davon aus, daß die Zeitwahrnehmung „leerer“, d.h. „langweiliger“ und „erfüllter“, d.h. „kurzweiliger“ Zeitabschnitte durch Reizintensität, Frequenz, Dauer und Stellung der Reize beeinflußt wird. Die Frequenz und Stellung der Reize, sind für die Wahrnehmung einer zeitlichen Dauer aufeinanderfolgender Abschnitte eines Geschehens verantwortlich.
Die Reizintensität wiederum kann bewirken, daß die Aufmerksamkeit von sämtlichen anderen oberflächlichen Reizen abgelenkt wird und sich auf den intensivsten Reiz konzentriert und das Zeitempfinden komprimiert. Im allgemeinen kann man davon ausgehen, daß zeitliche Perspektive sich aus der Interaktion wiederkehrender Bedürfnisse mit Umwelteinflüßen im Sinne einer Konditionierung entwickelt (Arnold, 1993).
Die Frage in Bezug auf die Koordinationsleistung der Versuchsperson, bestand darin, festzustellen, ob die Arbeitsgedächtniskapazität und die koordinativen Anforderungen im Hauptversuch die Zeitreproduktionsleistung beeinflussen.
Versuchteilnehmer mit hoher Arbeitsgedächtniskapazität sind den Versuchspersonen mit geringer Arbeitsgedächtniskapazität in Bezug auf ihre Zeitreproduktionsleistung überlegen, wobei bei hoher koordinativer Anforderung der Unterschied noch größer sein sollte, als bei niedriger koordinativer Anforderung.
2. Methodischer Teil
2.1. Versuchsplan
Für unseren Versuch wählten wir ein „Zwei mal Zwei - Design“.Der erste Faktor ist die Anforderung an das koordinative Arbeitsgedächtnis, welche durch die Aufgabenschwierigkeit KOORD 1 und KOORD 3 abgestuft ist. Der zweite Faktor ist die Arbeitsgedächtnisleistung der Vp, die in AGK+ und AGK- abgestuft wurde.
Der erste Teil des Experiments bestand aus der Zählaufgabe (Instruktion siehe Anhang). Diese diente als Instrument zur Variation der koordinativen Anforderungen, welche sich auf die Leistung der anschließenden Zeitreproduktion auswirken sollte. Unter der Bedingung KOORD 1 mußte die Versuchsperson eine Zahl, die 16, in 40 Zahlenreihen, die der Vp nacheinander für jeweils acht Sekunden auf dem Bildschirm eingeblendet wurden, identifizieren und mitzählen, was einer niedrigen Anforderung an die Arbeitsgedächtniskapazität entsprach. Unter der Bedingung KOORD 3, mußte die Versuchsperson das Erscheinen von drei Zahlen, nämlich 16, 38 und 67 beobachten, was einer hohen Anforderung an die Arbeitsgedächtniskapazität entsprach. Die folgenden Aufgaben, die Buchstabenaufgabe und die Punkteaufgabe (Instruktionen siehe Anhang), stellten konstante Anforderungen an alle Versuchspersonen, und dienten der Messung der individuellen Leistung der Arbeitsgedächtniskapazität.
2.2. Variablen
Folgende Variablen werden in den Versuchen benutzt :
Unabhängige Variablen:
- Unterschiedlichen koordinative Anforderungen in der Zählaufgabe ( KOORD 1 , KOORD 3)
- Messung der individuellen Leistung der Arbeitsgedächtniskapazität (Punktwerte aus den verbalen und figuralen Aufgaben zur AGK)
Abhängige Variablen:
- Zeitreproduktion (Zeit in Sekunden)
- mittlere Reaktionszeit pro Zahlenreihe n Ergebnisse der Zählaufgabe, Zählfehler
2.3. Stichprobe
Jeder Teilnehmer des Praktikums sollte 3 - 4 Versuchspersonen anwerben. Unsere Stichprobe umfaßte 42 VPs im Alter von 19 bis 48 Jahren. Von den Versuchspersonen waren 30 weiblich und 12 männlich. Die Verteilung der Tätigkeiten der VPs stellt Abbildung II dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung II : Verteilung der Tätigkeiten
2.4. Durchführung
2.4.1. Hilfsmittel und Geräte
Zur Durchführung des Versuchs werden Stift und Aufnahmebogen für die Daten der Versuchsperson (Alter, Geschlecht), benötigt. Für die Zählaufgabe sind das entsprechende Computerprogramm und Schablonen für die Tastaturbelegung bei KOORD 1 bzw. KOORD 3 nötig. Die Arbeitsgedächtnisaufgaben erfordern die Programme Arbeitsgedächtnis (im weiteren AG, bzw. AGV und AGF) verbal bzw. figural, sowie die Bögen zum Eintragen der Ergebnisse (Ein Bogen bei AGV, 14 Bögen bei AGF, siehe Anhang).
2.4.2. Versuchsaufbau und -ablauf Der Versuch bestand aus folgenden drei Aufgaben:
1. Zählaufgabe
2. verbales Kurzzeitgedächtnis= Buchstabenaufgabe
3. figurales Kurzzeitgedächtnis= Punkteaufgabe
Nach der Begrüßung der Versuchsperson durch den Versuchsleiter, wurde diese gebeten, ihre Uhr abzulegen. Dazu wurde erklärt, daß es in dem folgenden Versuch um Konzentration gehe, um das Kurzzeitgedächtnis und um die Dauer von Aktionen. Danach bekam die Versuchsperson die Instruktionen für die Zählaufgaben entsprechendend KOORD 1 oder KOORD 3 (siehe Anhang). Anhand von 15 Demonstrationsaufgaben wurde der Versuchsperson noch einmal die Aufgabenstellung durch den VL erläutert, danach hatte die Versuchsperson die Gelegenheit, selbst 10 Übungsaufgaben zu absolvieren. Anschließend wurde der Versuchsperson erklärt, daß nach Beendigung ihrer Testaufgaben auf dem Bildschirm die Aufforderung erscheint, das verstrichene Zeitintervall nochmals vergehen zu lassen, sowie die Anleitung zum Starten und Beenden der Zeitmessung. Nachdem auch das vom VL demonstriert wurde, bekam die Versuchsperson die Anleitung zum Starten des Programms. Dies sollte geschehen, nachdem der VL den Raum verlassen hatte. Während der VL draußen wartete, führte die Versuchsperson den Test mit anschließender Zeitreproduktion durch. Danach holte sie den VL wieder ins Zimmer. Die Versuchsperson wurde nun gebeten zu schätzen, wie viele Zahlenreihen auf dem Bildschirm erschienen waren. Das Ergebnis wurde im Protokollbogen festgehalten. Als nächstes bekam die Versuchsperson die Instruktionen für die Buchstabenaufgabe (siehe Anhang), und anschließend zwei Übungsaufgaben zum Bearbeiten. Die Lösungen der Übungsaufgaben wurden in den Lösungsbogen eingetragen. Danach bearbeitete die Versuchsperson 15 Testaufgaben. Der VL verließ diesmal nicht den Raum. Nach Beendigung dieser Aufgabe wurden die Daten der Versuchsperson in den Protokollbogen eingetragen, und so der Versuchsperson eine kleine Pause gegönnt.
Anschließend wurden die Instruktionen für die Punkteaufgabe erteilt, und wiederum zwei Übungsaufgaben durchgeführt. Gab es keine Fragen mehr, so bearbeitete die Versuchsperson nun die Testaufgaben. Der VL war auch während dieser Aufgabe im Raum.
Anschließende Fragen der Versuchsperson nach der Richtigkeit ihrer Lösungen wurden vorerst nicht beantwortet, sondern konnten erst nach der Auswertung der Ergebnisse geklärt werden. Fragen nach dem Sinn des Versuchs wurden sofort beantwortet. Abschließend wurde die Versuchsperson nach den Angaben für den Versuchspersonenschein gefragt und verabschiedet.
2.5. Operationalisierung der Hypothesen
Eine VP, die unter einer hohen Anforderung (KOORD 3) getestet wird, wird die in der Zählaufgabe vergangene Zeit weniger genau reproduzieren, als eine VP, die unter niedriger Anforderung (KOORD 1) getestet wird.
Eine VP mit hoher koordinativer AGK wird die Zeit genauer reproduzieren, als eine VP mit niedriger koordinativer AGK (Ergebnisse aus den figuralen und verbalen Aufgaben zur AGK).
Eine VP mit hoher koordinativer AGK (AGK+), die unter der Bedingung KOORD 1 getestet wird, reproduziert die vergangene Zeit wesentlich exakter, als eine VP mit niedriger koordinativer AGK (AGK-), die unter der Bedingung KOORD 3 getestet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung III : Matrix der Hypothesen
3. Auswertung
3.1. Statistische Hypothesen
Der Wert µ1 in den folgenden Hypothesen entspricht dem Mittelwert des Betrages der Differenz zwischen reproduzierter Zeit und vergangener Zeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2. Variablendefinition
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.3. Statistische Auswertung
Um die Reaktionszeiten je VP bei der Zählaufgabe zu bewerten, wurden die einzelnen Ergebnisse der Reaktionszeiten um die nicht beantworteten Items korrigiert und der Mittelwert gebildet. Die neue Variable heißt rzeit.
Aus der variablen rdauer wurden zwei neue Variablen gebildet, nämlich zrf_rel als relativer Wert der Abweichung der reproduzierten Zeit von der tatsächlich vergangenen Zeit (400 s) und zrf_abs als Betrag der Abweichung der reproduzierten Zeit von der tatsächlich vergangenen Zeit.
Als nächstes stellte sich die Frage, mit welchem Kennwert die AGK zu bewerten ist. Dazu wurde die Korrelation der Variablen wort, b1, b2, sym, p1, p2 untereinander betrachtet.
Tabellen II + III : Korrelation der Variablen wort, b1 und b2, bzw. sym, p1, und p2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Korrelation der Variablen wort , b1 und b2 untereinander ist auf dem 1% Niveau signifikant. Daraus folgt, daß sich die Variablen kaum unterscheiden und somit beliebig austauschbar sind. Bei den Variablen sym, p1 und p2 besteht kein signifikanter Zusammenhang.
Tabelle IV : Korrelation der Variablen der figuralen und verbalen Tests untereinander
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
-. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
-. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
In dem obigen Diagramm korrelieren die Variablen b1 und p1, die beide die koordinativen Fähigkeiten des AG wiedergeben sehr gut miteinander. Um die koordinative AGK wiederzugeben wurde die neue Variable b1_p1 als Summe von b1 und p1 gebildet.
Um die VPs anhand der AGK (ausgedrückt durch die Variable b1_p1) in zwei Gruppen einzuteilen und somit eine Unterscheidung in AGK + und AGK - vorzunehmen, wurde die Gesamtzahl der VPs am Median geteilt. Zwei VPs mit dem genau dem Median entsprechenden Wert von b1_p1 = 109 wurden im weiteren nicht mehr betrachtet, ebenso eine VP die als Wert für rdauer 4 s hatte.
Die Gruppe AGK + erhielt in der neuen Variable agk den Wert 1, die Gruppe AGK - den Wert 0.
Es stellte sich an dieser Stelle auch die Frage, ob mit der durch das Versuchsdesign in der Zählaufgabe konstruierten Unterscheidung in koord 1 und koord 3 auch wirklich eine signifikant unterschiedlich hohe Anforderung an die koordinative AGK gestellt wurde.
Dies kann durch einen t-Test für die abhängigen Variablen zf und rzeit, welche die Anforderung an die AGK widerspiegeln sollten, in Bezug auf die unabhängige Variable koord geprüft werden (manipulation-check). Der t-Test ist an dieser Stelle nur möglich, da die Freiheitsgrade für den t-Test durch das verwendete Statistikprogramm SPSS korrigiert wurden. Auf diese Weise wurde die Anzahl der Freiheitsgrade von 40 auf 25,6 reduziert, wodurch die nicht vorhandene Varianzhomogenität ausgeglichen wurde.
Independent Samples Test
Die t-Werte für rf und rzeit in Bezug auf die unabhängige Variable koord sind auf dem 5 % Niveau nicht signifikant. Dies bedeutet, daß die Bedingungen koord 1 und koord 3 in der Zählaufgabe tatsächlich unterschiedliche Anforderungen an die AGK stellen. Die Hypothesen (H0.1 - H0.3) werden mittels Varianzanalyse auf ihre Signifikanz hin überprüft.
Folgende Zusammenhänge werden geprüft :
- zrf_rel in Bezug auf koord und agk, um gegebenenfalls eine Gerichtetheit festzustellen und
- zrf_abs in Bezug auf koord und agk.
Cell Meansb
a. ZRF_ABS by KOORD, AGK
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgrund der Ergebnisse der Varianzanalyse (ANOVA) besteht für alle abhängigen Variablen in Bezug auf die unabhängigen Variablen kein signifikanter Zusammenhang. Daraus ergibt sich, daß die jeweilige H0 gilt und die jeweilige H1 zu verwerfen ist. Es besteht also kein Zusammenhang zwischen koordinativer Arbeitsgedächtniskapazität und der Fähigkeit zur genauen Zeitreproduktion.
4. Diskussion
Ein möglicher Grund, daß unsere Ergebnisse die Hypothesen nicht bestätigt haben, könnte sein, daß die Hypothesen inhaltlich oder auch in ihrem Zusammenhang falsch konstruiert waren. Dies würde bedeuten, daß tatsächlich kein Zusammenhang zwischen der „Belastung“ des AG und der Zeitreproduktion besteht. Dies würde jedoch auch bisher bestehende Theorien in Frage stellen.
Ein weiterer Grund könnte sein, daß die von uns ausgewählten Untersuchungsverfahren für die figurale/räumliche und verbale AGK ungeeignet waren, um ein Maß für die koordinativen Fähigkeiten des AG zu ergeben. Es könnte sein, daß damit eher nur die Fähigkeiten des Kurzzeitgedächtnisses ermittelt wurden. Es wäre zu prüfen, ob mit anderen Aufgabenkonstruktionen andere Ergebnisse erzielt werden können.
Bei Ermittelung des notwendigen Stichprobenumfangs haben wir uns auf Effektgrößen aus vorangegangen Untersuchungen bezogen. Die Frage ist, ob diese Effektgrößen geeignet waren. Dies wäre im weiteren dadurch zu kontrollieren, daß der Stichprobenumfang zuerst innerhalb der vorhanden Daten variiert wird. Dabei wäre dann von Interesse, ob die sich ergebenden Effektgröße konstant bleibt oder sich verändert. Sollte bei der von uns angenommenen Anzahl von 42 VPs die Effektgröße weiterhin steigend sein, heißt das, der Umfang der Stichprobe wurde von uns zu gering abgeschätzt.
Die Versuchspersonen waren sicherlich, da sie aus dem direkten Bekanntenkreis ausgewählt waren, besonders motiviert, was sich in den im Durchschnitt zu vorhergehenden Untersuchungen um 30% besseren Ergebnissen in der Zählaufgabe widerspiegelt. Durch die Versuchsleiter erfolgte eventuell eine bewußte Aufteilung auf die Gruppen KOORD 1 und KOORD 3 entsprechend der durch den VL angenommenen Fähigkeiten der VP. Das heißt Unterschiede in den bestehenden koordinativen Fähigkeiten der VPs wurden durch unsere Zuordnung nivelliert.
Durch den hohen zeitlichen Umfang des Experiments ( min. 1h eher mehr ), können wir davon ausgehen, daß Konzentrationsfähigkeit und Motivation der VPs gegen Ende, also als es um die AGK ging, gering war. Dies hat damit eventuell dazu geführt, daß die Fähigkeit Punkte in der figural/räumliche Aufgabe in der richtigen Konstellation einzuzeichnen bei allen VPs ähnlich gering war.
Literaturverzeichnis
- Arnold, M.B.;Eysenk, E.& Meili, D. (1991). Lexikon für Psychologie. Bern: Herder- Verlag.
- Aschoff, J. (1985). Zur Zeitwahrnehmung während langdauernder Isolation, Human Neurobiology.
- Bortz, J. (1993). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer-Verlag. n Carlson, R.A.; Lundy, D.H. (1992). Consistency and restructuring in learning cognitive procedural sequences, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition.
- Dutke,S.(1997). Erinnern der Dauer. Zur zeitlichen Rekonstruktion von Handlungen und Ereignissen. Lengerich: Pabst Science Publishers
- Fraisse, P. (1984). Psychologie der Zeit. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Funke, J. (1988). „Changes or Effort ?“ Eine Überprüfung von zwei Theorien zu Zeitschätzung , Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie. n Huber, O. (1995). Das psychologische Experiment: Eine Einführung. Bern: Verlag Hans Huber.
- Mayr, U.; Kliegel, R. (1993). Sequential and coordinating complexity. Age differential limits of performance and learning in figural transformations, Journal of: Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition.
- Oberauer, K. (1993). Die Koordination kognitiver Operationen - Eine Studieüber die Beziehung zwische Intelligenz und„working memory“, Zeitschrift für Psychologie. n Schönpflug, W./Schönpflug, U. (1995). Psychologie. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text ist ein Bericht über ein Experimentalpraktikum zum Thema "ARBEITSGEDÄCHTNISKAPAZITÄT UND ZEITREPRODUKTION". Es werden Fragestellungen, theoretische Grundlagen, Methodik, Ergebnisse und eine Diskussion der Ergebnisse präsentiert.
Welche Fragestellungen werden untersucht?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob die Genauigkeit der Zeitreproduktion von der Schwierigkeit einer Aufgabe abhängt, die während des zu reproduzierenden Zeitintervalls bearbeitet wird. Zudem wird untersucht, ob Personen mit hoher Arbeitsgedächtniskapazität eine bessere Zeitreproduktionsleistung erbringen als Personen mit niedrigerer Kapazität.
Was versteht man unter Zeitreproduktion?
Zeitreproduktion bezeichnet die Fähigkeit, ein Zeitintervall wiederherzustellen oder zu vergegenwärtigen. Dies kann durch die Erinnerung an Wahrnehmungsinhalte und die Bildung mentaler Modelle erleichtert werden.
Welche Theorien zur Zeitschätzung werden genannt?
Der Text erwähnt physiologische Modelle, die von einem "Zeitorgan" im Organismus ausgehen, sowie kognitionspsychologische Modelle, die den kognitiven Aufwand ("processing effort") als entscheidenden Faktor für die Zeitempfindung betrachten.
Wie wird das Arbeitsgedächtnis definiert?
Das Arbeitsgedächtnis wird als ein komplexes kurzfristiges Gedächtnissystem beschrieben, das sowohl die Speicherung von Informationen als auch die Verarbeitungsprozesse gewährleistet. Es hat eine begrenzte Kapazität und trägt aktiv zur Bearbeitung von Aufgaben bei.
Welches Modell des Arbeitsgedächtnisses wird detaillierter beschrieben?
Das Modell von Allan Baddeley (1986) wird ausführlicher dargestellt. Es beinhaltet eine zentrale Kontrollfunktion (central executive) mit Hilfssystemen wie die artikulatorische Rückkoppelungsschleife und das Teilsystem für visuell-räumliche Informationsverarbeitung.
Was sind mentale Modelle?
Mentale Modelle werden als Wissensstrukturen in der Kognition verstanden. Im Kontext des Versuchs könnten Versuchspersonen mentale Modelle nutzen, um die Zeitreproduktion zu erleichtern, beispielsweise durch die Erinnerung an Ereignisse während des Zeitintervalls.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese besagt, dass die Begrenztheit der koordinativen Kapazität des Arbeitsgedächtnisses die Informationsgrundlage mentaler Modelle beeinträchtigen kann und somit Einfluss auf die Zeitreproduktion nimmt. Personen mit höherer Anforderung an das Arbeitsgedächtnis sollen die Zeit weniger exakt reproduzieren.
Wie war der Versuchsplan aufgebaut?
Es wurde ein "Zwei mal Zwei - Design" gewählt, mit den Faktoren Anforderung an das koordinative Arbeitsgedächtnis (KOORD 1 und KOORD 3) und Arbeitsgedächtnisleistung (AGK+ und AGK-).
Welche Aufgaben wurden im Experiment verwendet?
Es gab eine Zählaufgabe zur Variation der koordinativen Anforderungen, eine Buchstabenaufgabe und eine Punkteaufgabe zur Messung der individuellen Arbeitsgedächtniskapazität.
Welche Variablen wurden untersucht?
Unabhängige Variablen waren die unterschiedlichen koordinativen Anforderungen (KOORD 1, KOORD 3) und die Messung der individuellen AGK. Abhängige Variablen waren die Zeitreproduktion und die Reaktionszeit bei der Zählaufgabe.
Wie groß war die Stichprobe?
Die Stichprobe umfasste 42 Versuchspersonen im Alter von 19 bis 48 Jahren, davon 30 weiblich und 12 männlich.
Was war das Ergebnis der statistischen Auswertung?
Die Varianzanalyse ergab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen koordinativer Arbeitsgedächtniskapazität und der Fähigkeit zur genauen Zeitreproduktion. Die aufgestellten Hypothesen konnten nicht bestätigt werden.
Welche Gründe werden für die nicht bestätigten Hypothesen diskutiert?
Mögliche Gründe sind fehlerhafte Hypothesen, ungeeignete Untersuchungsverfahren zur Messung der AGK, eine zu geringe Stichprobengröße, hohe Motivation der Versuchspersonen, bewusste Aufteilung der Versuchspersonen auf die Gruppen oder eine geringe Konzentrationsfähigkeit der Versuchspersonen gegen Ende des Experiments.
- Quote paper
- Juliane Gerstberger (Author), 1998, Arbeitsgedächtniskapazität, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99294