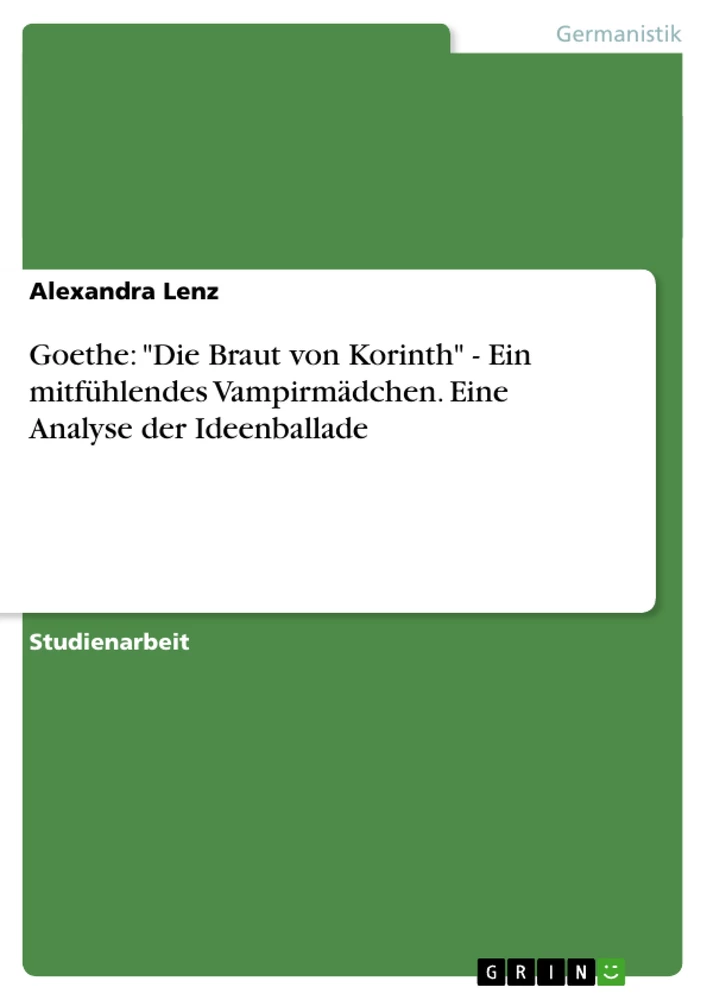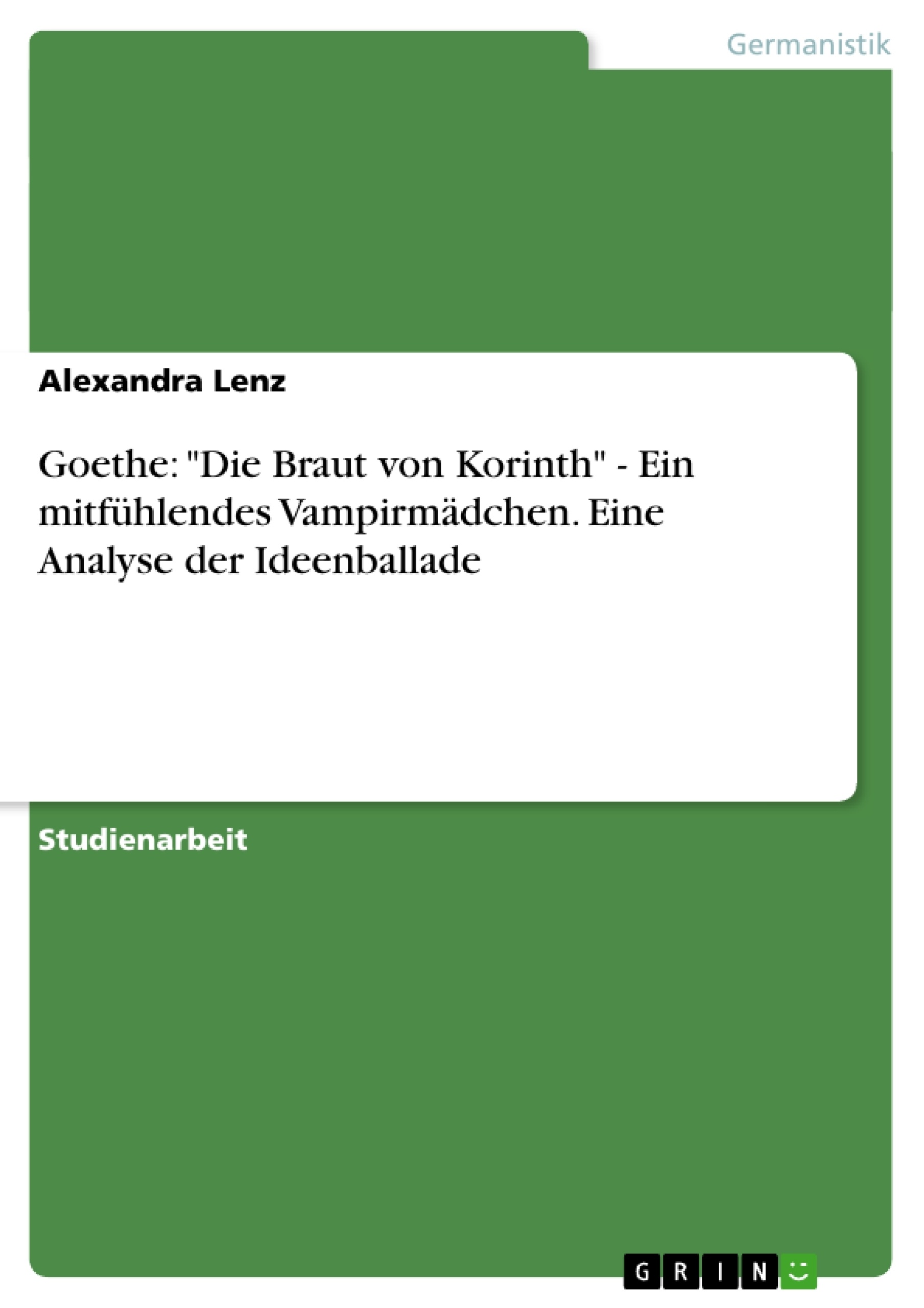In einer Zeit des Umbruchs, wo alte Götter neuen Glaubensbekenntnissen weichen, entfaltet sich eine düstere Romanze, die die Grenzen von Leben und Tod auf unheimliche Weise verschwimmen lässt. Johann Wolfgang von Goethes Ballade "Die Braut von Korinth" ist weit mehr als nur eine Gespenstergeschichte; sie ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Konflikten zwischen Heidentum und Christentum, zwischen sinnlicher Begierde und asketischer Entsagung, zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Zwang religiöser Doktrin. Ein junger Mann reist nach Korinth, um seine versprochene Braut heimzuführen, doch er ahnt nicht, dass er in ein Haus des Schreckens eintritt, in dem die Tochter der Familie, gezwungen zum Christentum konvertiert und frühzeitig ins Grab gebracht, als Untote wandelt. Was folgt, ist eine verstörende Begegnung mit einem Vampirmädchen, das zwischen dem Verlangen nach Blut und der Sehnsucht nach Liebe hin- und hergerissen ist. Goethe entwirft hier keine blutrünstige Bestie, sondern eine tragische Figur, deren vampirischer Durst eine Metapher für eine unterdrückte Lebenslust und den verzweifelten Wunsch nach Erlösung darstellt. Die Analyse dieser Ballade enthüllt Goethes Kritik an einer dogmatischen Religion, die das natürliche Begehren des Menschen unterdrückt und zu Unheil führt. Die Interpretation beleuchtet die aufklärerischen Ideale, die in der Ballade zum Ausdruck kommen, indem sie das Recht des Individuums auf freie Entfaltung und Selbstbestimmung in den Vordergrund stellt. Der Leser wird Zeuge eines schicksalhaften Aufeinandertreffens, in dem sich die Braut von Korinth gegen die ihr auferlegten Zwänge auflehnt und ihr eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Die Auseinandersetzung mit dem Vampirmythos, die subtile Erotik und die tiefgründige Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen Fragen machen "Die Braut von Korinth" zu einem fesselnden Meisterwerk der deutschen Balladenkunst, das bis heute nichts von seiner faszinierenden Wirkung verloren hat. Tauchen Sie ein in eine Welt voller dunkler Geheimnisse und lassen Sie sich von Goethes poetischer Vision verzaubern. Die Ballade ist ein Muss für Liebhaber der deutschen Klassik, der Vampir-Literatur und für alle, die sich für die großen Fragen der Menschheit interessieren. Eine tiefgründige Analyse, die den ideellen Hintergrund beleuchtet und neue Perspektiven auf dieses ikonische Werk eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Balladenjahr
2.1. Definition Ideenballade
3. Goethe: ,,Die Braut von Korinth" - eine Analyse
3.1. Goethes Quellen
3.2. Interpretationsversuch
3.2.1. Formaler Aufbau der Ballade
3.2.2. Ansätze zur inhaltlichen Auslegung
3.3. Ideeler Hintergrund
4. Schlussbemerkung Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Johann Wolfgang von Goethe war wohl einer der ersten Schriftsteller, der die Vampirgestalt nicht bloß als ein blutgieriges Monster skizzierte, sondern sie mit menschlichen Zügen ausstattete. In seiner Ballade ,,Die Braut von Korinth"1 verknüpfte er 1797 den Vampirmythos mit einer antiken Gespenstergeschichte. Diesen trivialen Ausgangsstoff formt er entscheidend: Er humanisiert das Vampirmädchen und läßt Heidentum und Christentum aufeinander prallen. Das sind die ideelen Hintergründe, die die Ballade prägen und sie zu einer Ideenballade machen.
Im folgenden Aufsatz möchte ich zunächst auf die Gattung Ideenballade und Goethes Quellen eingehen. Anschließend wird der Versuch einer Interpretation von ,,[der] Braut von Korinth" Thema sein.
2. Das Balladenjahr
Die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller prägte den Begriff des Balladenjahres. 1797 entstanden die großen Balladen der Beiden wie z.B. Goethes ,,Der Zauberlehrling" und ,,Die Braut von Korinth" und Schillers ,,Der Taucher" und ,,Die Kraniche". In wechselseitiger Anregung erlebten sie dieses Jahr als den Höhepunkt in ihrem Balladenschaffen. Trotzdem war das Balladenschreiben für Schiller und Goethe eher eine Art Lockerungsübung und eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Schiller veröffentlichte die Balladen von 1797 in einer Anthologie namens ,,Musen-Almanach für das Jahr 1798".
2.1 Definition Ideenballade
Die Ideenballade gehört als Sonderform zur neuzeitlichen deutschen Kunstballade und bezieht sich nur auf das Balladenschaffen von Goethe und Schiller. Hartmut Laufhütte umschreibt die Kunstballade als ,,[...] eine episch-fiktionale Gattung. Sie ist immer in Versen, meist gereimt und strophisch, manchmal mit Nutzung refrainartiger Bestandteile, oft mit großer metrisch- rhythmischer Artistik gestaltet. Sie kennt alle vier Arten epischer Fiktionsbildung."2 Das gilt auch für die Ideenballade. Hinzuzufügen bleibt die Intention von Schiller und Goethe: Für sie war weniger die Handlung das Elementare der Ballade, sondern viel mehr die Idee; d. h. sie ordneten die Handlung den vorherrschenden Ideen unter. Diese Ideen von Schiller und Goethe beinhalten aufklärerisches Gedankengut.
Bei Goethe sind die Menschen meist in naturmagische Beziehungen verflochten und übersinnlichen Kräften ausgeliefert.
3. Goethe : ,,Die Braut von Korinth" - eine Analyse
3.1 Goethes Quellen
Der antike Stoff stammt vermutlich aus dem ,,Buch der Wunder" von dem griechischen Schriftsteller Phlegon Aelius von Tralles, das im zweiten Jahrhundert entstanden ist. 1666 erschien dieser Stoff dann in ,,Anthropodemus plutonicus - Eine Weltbeschreibung von allerley wunderbaren Menschen". Herausgeber war Johannes Praetorius, ein Sammler von Gespenster- und Hexengeschichten. Aus diesem letzteren Buch dürfte Goethe wohl seine antike Gespenstergeschichte entnommen haben:
Danach kommt der Jüngling Machates in die syrische Stadt Tralles zu Gastfreunden seiner Eltern, denen vor sechs Monaten die Tochter gestorben ist. Davon weiß der Jüngling aber nichts. Nachts erscheint sie bei ihm, gesteht ihm die Liebe, und sie verbringen die Nacht zusammen. Am Tage verschwindet sie. Aber Dienstboten haben sie bemerkt und melden es den Eltern. Als sie in der nächsten Nacht wieder bei Machates ist, kommen die Eltern und sind entzückt, die verstorbene Tochter wiederzusehen. Sie aber sinkt tot um. Man wirft den Leichnam außerhalb der Stadt wilden Tieren vor und opfert sie den Göttern. Machates stirbt bald danach.3
Goethe nimmt einige Änderungen vor: Er gestaltet die umher spuckende Tote zu einer Wiedergängerin mit vampirischen Zügen und läßt den Jüngling nicht zufällig in das Haus von Gastfreunden seiner Eltern einkehren. Der junge Mann betritt bei Goethe das Haus mit der Absicht, die versprochene Braut zu holen. Auch ist der Schauplatz nicht in Tralles, sondern nach Korinth verlegt worden. Korinth, einer der ersten Städte im antiken Griechenland, die christianisiert wurde, verweist bereits auf den Konflikt zwischen den beiden Religionen. Auf der einen Seite ist die zum Christentum konvertierte korinthische Familie, auf der anderen Seite der heidnische Jüngling, der ihre Tochter mit sich nehmen will und somit wieder in die heidnische Religion einführen würde. Dass die versprochene Tochter bereits nicht mehr unter den Lebenden weilt, weiß auch Goethes Jüngling nicht. Das erfährt er erst, als die Mutter des toten Mädchens ihn und die Wiedergängerin (ihre Tochter) beim Liebesspiel stört.
Goethes ureigene Vampirgestalt, die nicht den gängigen Vorstellungen des 18. Jahrhunderts entsprach, entstand wahrscheinlich in Anlehnung seiner klassischen Studien. Er traff hierbei wohl auf die griechischen Lamien, ,,[...] den weiblichen Vampir der Antike, aus dem Umfeld der Hekate4, [...]. Die Lamien werden zwar als schöne Mädchen vorgestellt, sind unter dem Zwang einer sexuellen Gier aber darauf aus, den Männern das Blut auszusaugen."5 Dieser triebhafte Drang, Blut zu saugen, empfindet Goethes Vampirmädchen auch:
Aus dem Grabe werd' ich ausgetrieben, 177
[...],
Und zu saugen seines Herzens Blut.
Ist's um den geschehen, 180
Muß nach andern gehen,
[...] *
Ihre dämonische Lust auf Blut läßt sich auch in das damalige Bild eines Vampirs einfügen. ,,Der
Grund für den Nachzehrer- und Vampirglaubens [lag] in der Vorstellung vom fortlebenden Toten und seiner Gier nach Leben, das er besonders im Blut zurückzugewinnen hofft; darum bleibt er auch unverwest und behält andere Anzeichen eines unheimlichen Weiterlebens."6 Doch Goethes Vampirmädchen hat nicht nur jene dunkle Seite, sondern auch eine andere, die sehr menschlich ist. (Auf die Humanisierung der goetheschen Vampirgestalt - eine Idee der Ideenballade - werde ich an gegebener Stelle näher eingehen).
3.2. Interpretationsversuch
3.2.1 Formaler Aufbau der Ballade
Goethe wählt für seine Ballade als Versfuß den Trochäus, beginnend mit einer Hebung. Die ersten vier Verse einer jeden Strophe ergeben einen Kreuzreim mit fünfhebigen Trochäus. Der fünfte und sechste Vers ist immer ein Paareim und dreihebig-trochäisch. Der siebte Vers ist wieder fünfhebig und reimt sich mit dem zweiten und vierten Vers der jeweiligen Strophe. Durch den verbindenden Endreim der zweiten, vierten und siebten Zeile schafft Goethe eine kleine Einheit. Doch auch durch die 28-zig malig Wiederholung der Strophenform wirkt die Ballade einheitlich und geschlossen. Goethe wählt den trochäischen Rhythmus wahrscheinlich, damit die Leser mehr auf Einzelheiten achten; bricht der Redefluss beim Trochäus doch eher auf und reflexive Inhalte kommen zur Geltung. Sicher wollte Goethe sich mit dem trochäischen Versfuß auch von Bürgers Balladen abheben. In ,,Lenore" (1773) benützt Bürger den Jambus, der sich an der gesprochenen Sprache orientiert. Aber gerade das wollte Goethe vermeiden, hatte er doch zusammen mit Schiller das Ziel, die Ballade, die als niedriges Genre bei den gebildeten Rezipienten verpönt war, zu etwas Literarisch-wertvollen emporzuheben.
3.2.2 Ansätze zur inhaltlichen Auslegung
Wie bereits erwähnt kehrt der junge Mann bei der korinthischen Familie ein, um seine versprochene Braut mit sich nach Athen zu nehmen. Die gastverwandten Väter hatten einst ihre Kinder füreinander bestimmt. Doch in der Zwischenzeit hat sich die Glaubensrichtung der Familie in Korinth geändert. Sie hat ihren heidnischen Glauben abgelegt und wurde christlich.
Er ist noch ein Heide mit den Seinen, 10
Und sie sind schon Christen und getauft.*
Die treibende Kraft bei diesem Religionswechsel war die Mutter, die dann auch zum Dank für ihre Genesung die Tochter zwang Nonne zu werden.
Durch der guten Mutter kranken Wahn, 53
Die genesend schwur:
Jugend und Natur
Sei dem Himmel künftig untertan.*
Das Mädchen verstarb darauf hin. Über die Totesursache kann man nur spekulieren.
Vielleicht war es Selbstmord oder auch ein tödlicher Unfall? Sicher ist, dass sie als Tote wieder in ihr elterliches Haus zurückkommt und auf den versprochenen Bräutigam stößt. ,,[..], mit weißem Schleier und Gewand" (Vers 30)* betritt sie im Novizinnenkleid das Zimmer des Jünglings. Zuerst erkennen sich beide nicht: Dem Mädchen ist die Begegnung peinlich (,,Und nun überfällt mich hier die Scham" (Vers 39)*), während der junge Mann das eingetretene Fräulein als angenehme Überraschung, nicht ohne Hintergedanken, gleich zum Bleiben einlädt (,,'Bleibe, schönes Mädchen!' ruft der Knabe, [...]
'Hier ist Ceres´, hier ist Bacchus´Gabe; Und du bringst den Amor, liebes Kind!7 " (Vers 43)*).
Als sie ihm ihr Schicksal schildert, wird ihm klar, dass vor ihm seine zuk ü nftige Braut steht. Das Mädchen verheimlicht ihm jedoch, dass es schon tot ist, aber der junge Mann missdeute auch ihre Äußerungen: Wenn sie von ihrer ,,stillen Klausel" (V 73)* spricht, womit sie ihren Sarg meint, denkt er vermutlich sie meint ihr Zimmer; wenn sie davon spricht, sich bald in die Erde zu verbergen (V 77)*, dann glaubt er, dass sei bildhaft gesprochen. Der Jüngling bedrängt das tote Mädchen: ,,Liebe fordert er beim stillen Mahle;" (V 101)*, ,,Doch sie widersteht," (V103)*. Hier spiegelt sich der innere Konflikt der Nachzehrerin. Der lebendige junge Mann mit seinem warmen Blut ist für sie sehr verführerisch, zumal sie als Vampir ja auch den Drang nach Blut verspürt. Trotzdem widersteht sie, denn sie weiß, berührt sie ihn, ist sein Leben damit verwirkt. Als er aber ,,[...]weinend auf das Bette sank" (V105)* verspürt sie Mitleid mit ihm.
Und sie kommt und wirft sich zu ihm nieder: 106
,,Ach wie ungern seh` ich dich gequält!" *
Sie stürzt sich nicht mit diabolischer Leidenschaft auf ihn, sondern offenbart ihm ihren Zustand und überlässt ihm die Entscheidung, was geschehen soll. Der Jüngling ist dann derjenige, der aus Leidenschaft heraus handelt. Er will sie hier und jetzt körperlich lieben ohne wenn und aber. Deshalb reagiert und sagt er:
Heftig faßt er sie mit starken Armen,
Von der Liebe Jungendkraft durchmannt:
,,Hoffe doch bei mir noch zu erwarmen,
Wärst du selbst mir aus dem Grab gesandt!" * 116
Im Liebesspiel kommt auch der triebhafte Drang des Mädchens durch: ,,Gierig saugt sie seines Mundes Flammen, [...]." (V 122)* . Sie fügt dem Jüngling aber keine Schmerzen zu. Goethes Vampirgestalt ist zwar darauf aus, Blut zu saugen, doch sie tut das während der geschlechtlichen Vereinigung. Das bedeutet ihre Gier nach Leben (das Blut steht für das Leben) ist auch eine Gier nach Liebe und ihr vampirischer Drang ist erotischer Natur.
Vielleicht hat Goethe mit dieser durchpsychologisierten Figur die zwei Gesichter eines Menschen andeuten wollen: Der unkontrollierbare, triebhafte Liebesdrang zum einen und die Tugendhaftigkeit, Unschuld zum anderen. D. h. die sexuelle Lust und die vampirischen Züge des Mädchens auf der einen, und ihre Keuschheit (,,Sittsam still"/V 31*, schreckhaft, sie schämt sich und möchte gleich wieder gehen, als sie zufällig sein Zimmer betritt) auf der anderen Seite. Diese zwei Seiten (Zwei Seelen-Lehre) findet man ebenfalls in Goethes Hauptwerk, den ,,Faust" wieder: ,,Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust, [...];"8
Der Jüngling vermag wohl ihr ,,starres Blut" (V 125)* zu erwärmen, aber seine Braut bleibt tot. Die Mutter überrascht die beiden Liebenden und sieht sich plötzlich mit ihrer verstorbenen Tochter konfrontiert. Das Vampirmädchen klagt sie an.
Ist´s Euch nicht genug,
Daß ins Leichentuch, 160
Daß Ihr früh mich in das Grab gebracht? *
Ihre Mutter hat Schuld an ihrem verfrühten Tod, weil sie das Recht auf Selbstbestimmung ihrer Tochter nahm, d.h. ihre Tochter gegen deren Willen zu einem Nonnendasein zwang und sich nicht mit ihr aussöhnte. ,,Bei manchen Wiedergängern ist der Grund des Umgehens ein vorzeitiger Tod"9, heißt es im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Hinzu kommt bei Goethe das Motiv des Nachzehrers, aber auch das Motiv der Liebe, was das Mädchen aus ihrem Grab treibt.
Aus dem Grabe werd´ ich ausgetrieben,
Noch zu suchen das vermißte Gut,
Noch den schon verlornen Mann zu lieben* 179
,,Nachzehrer im eigentlichen Sinn kann man die Toten nennen, von denen deutlich gesagt wird, daß sie Lebende auf irgendeine Art nachholen, ein Spezialfall davon ist der Vampir."10 Mit dieser besonderen Art einer Wiedergängerin haben wir es bei der Braut von Korinth zu tun. Sie nimmt schließlich eine Locke des Jünglings mit sich und kettet ihn dadurch an sich. Diese Locke ist Symbol für das Leben des jungen Mannes, dass jetzt durch ihre Berührung ausgelöscht ist. Sie sagt ihm, dass er sterben wird:
Deine Locke nehm´ ich mit mir fort. 186
Sieh sie [die Locke] an genau!
Morgen bist du grau, *
Die grauen Haare stehen für seinen Tod. Doch mit dem Tod endet nicht ihre gerade begonnene Liebschaft, das deutet sie ihrem Geliebten auch an: ,,Und nur braun erscheinst du wieder dort." (V 189)*. Er wird zwar sterben müssen, aber nach dem Tod wird er wieder braune Locken haben, d. h. ein neues Leben im Elysium11 mit ihr führen können. Deshalb bittet sie die Mutter ,,Bring´ in Flammen Liebende zur Ruh´!" (V 193)*. Durch den heidnischen Feuertod werden das Vampirmädchen und der Jüngling (der durch ihren Biss ja auch zu einem Vampir wurde) erlöst und im Tod vereint. Der von ihr gewünschte Feuertod steht für das nie verlöschende, sich ständig wandelnde Leben- ein Leben bei den alten Göttern.
Ob die Mutter wenigstens den letzten Wunsch der Tochter erfüllen wird, erfahren die Leser nicht mehr. Aber ich denke sie wird es tun, ist es doch die einzige Möglichkeit ihrer Tochter den Seelenfrieden zurückzugeben. Natürlich könnte sie das Vampirmädchen auch pfählen oder mit dem Spaten köpfen, wie es im 18. Jahrhundert Sitte war, aber dann würde sie sich erneut gegenüber ihrer Tochter schuldig machen. So hat sie die Chance das Unrecht an der Tochter wieder gut zu machen.
,,Durch der guten Mutter kranken Wahn," (V 53)* wurde die Braut von Korinth zwangsweise Nonne. Die Mutter ist zwar vordergründig allein schuld an dem nächtlichen Umherwandeln des Vampirmädchens, aber eigentlicher Verursacher ist das Christentum. Denn erst durch den Religionswechseln wurde die gute Mutter wahnsinnig und handelte deshalb gegen die Natur ihrer Tochter. Der neue Glaube der korinthischen Familie löst den heidnischen Götterglauben ab und vertreibt damit auch ,,Lieb´ und Treu´" (V 13)*. Goethe negiert in seiner Ballade das Christentum, andererseits bewertet er das Heidentum positiv. Folgende Gegenüberstellung einiger der verwendeten Begriffe in ,,Die Braut von Korinth" soll dies verdeutlichen:
CHRISTENTUM (negativ): HEIDENTUM (positiv):
Keimt ein Glaube neu, 12 Und der alten Götter bunt Gewimmel 57
Wird oft Lieb´ und Treu
Wie ein böses Unkraut ausgerauft.
Haus im Stillen (V 15);
stille Haus (V 58)
Unsichtbar wird einer nur im Himmel, 59 Als noch Venus´ heitrer Tempel stand. 170 Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt;
,,Menschenopfer" (V 63) ,,Lamm [und] Stier" sind hier die Opfer (V 62)
Zusammenfassend kann man sagen, dass Goethe - selbst ein Heide - in diesem Gedicht das sinnerfüllte Leben bejaht und das Christentum verneint, weil dieser Glaube für ihn die Askese fordert und damit ein Leben ohne Freude ist. Er kritisiert die christliche Religion, die in seinen Augen unmenschlich ist, da Menschen geopfert werden: Jesus, aber auch die Braut von Korinth selbst, die für ihre Mutter ihr sinnerfülltes Leben opfern muss. Für Goethe ist das Christentum ein Glaube, der mit Leid und Schmerzen verknüpft und ein widernatürliches System ist. Das Heidentum sieht er dagegen als das farbigere, menschengerechtere System - ein System, das mit der Natur des Menschen eher in Einklang ist.
Der Glaubenswechsel der korinthischen Familie spiegelt auch eine Umbruchsituation in der Geschichte der Menschheit wider: Das Heidentum wurde zunehmend verdrängt, in der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es schließlich 810 Millionen Christen.
3.3 Ideeler Hintergrund
Für die Menschen im 18. Jahrhundert war der Vampir eine Unperson ohne Emotionen. Umso erstaunlicher ist es, dass Goethe 1797 ein Vampirmädchen mit menschlichen Zügen erfand. Seine Nachzehrerin empfindet Mitleid und weint. Sie ringt mit sich selbst: Einerseits hat sie den Drang Blut zu saugen und damit zu töten, andererseits möchte sie den Jüngling schonen. Dieser innere Konflikt und ihre Emotionen machen sie zu einem personalen Wesen. Goethes Vampirgestalt verkörpert Humanität und erhebt als Wiedergängerin ihr persönliches Recht auf Selbstbestimmung. Das ist aufklärerisches Gedankengut, dargestellt durch ein Wesen zwischen Leben und Tod.
Die zweite Idee von Goethe ist die Konfliktsituation aufgrund zweier verschiedener Religionen, wobei er eindeutig Position für das Heidentum bezieht. Er bewertet die zwei Glaubensrichtungen danach, wie die Menschen aus ihrem Glauben heraus handeln. Für ihn leben die Christen ohne Freunde und ihr Glauben macht sie wahnsinnig, so dass sie andere Menschen ins Unglück stürzen. Dagegen empfindet er das Heidentum dem Menschen eher entsprechend. Hier sind Sinnesgelüste erlaubt und der Mensch ist stärker in die Natur miteinbezogen.
4. Schlussbemerkung
Mich fasziniert ,,Die Braut von Korinth" und ich finde es erstaunlich, dass ein Schriftsteller konträr zum allgemeinen Vampirglauben des 18. Jahrhunderts solch eine rührende Gestalt einer Nachzehrerin entwickeln konnte.
Aufgeregt habe ich mich zum Teil über die Sekundärliteratur. Manche Interpreten, vor allem die um 1930/40 haben einfach nicht erkennen wollen, was Tatsache ist: Goethes Mädchengestalt ist ein Vampir. Jene Interpreten waren für mich gänzlich unbrauchbar. Mit anderen Interpreten und deren Auslegungen konnte ich mich eher anfreunden. Ich habe, nachdem ich das Referat zum gleichen Thema gehalten habe, auch manche Dinge anders betrachtet und nochmals meine Auslegung überdacht. (Ich muss gestehen, weil ich in einen Gedanken verliebt war, habe ich einen Interpreten falsch ausgelegt. Doch als ich nochmals seine Interpretation durchlas, habe ich verstanden, was er eigentlich meint und wusste, warum ich das Motiv der tragischen Leibe in meinem Referat falsch erklärt habe). Was jedoch noch viel wichtiger für mich war als die Sekundärliteratur, war die eigene Analyse. Denn erst, wenn man sich selbst Gedanken über ein Werk macht, kann man es im Wesentlichen erfassen.
Literaturverzeichnis
1. Primärtexte
- Von Goethe, Johann Wolfgang: Gedichte 1756 - 1799. Bibliothek der Klassiker/18, hrsg. von Karl Eibel, Frankfurt am Main 1987, S. 686 - 692.
- Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Texte, hrsg. von Albrecht Schöne, Frankfurt am Main 1999.
2. Sekundärliteratur
- Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band VI, hrsg. von u. a. E. Hoffmann-Krayer, Berlin/Leipzig 1934/1935.
- Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band IX, hrsg. von u. a. E. Hoffmann-Krayer, Berlin 1938/41.
- Laufhütte, Hartmut: Die deutsche Kunstballade. Gattungsbegriff und Gattungsgeschichte, in: Text- sorte und literarische Gattung. Dokumentation des Germanistentages in Hamburg vom 1. bis 4. April 1979, hrsg. vom Vorstand der Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten, Berlin 1983, S.335- 347.
- Meyers Taschen Lexikon in 10 Bänden, hrsg. und bearbeitet von Meyers Lexikonredaktion, Weltbild Sonderausgabe, Augsburg 1999.
- Schemme, Wolfgang: Goethe: Die Braut von Korinth. Von der literarischen Dignität des Vampirs, in: Wirkendes Wort. Deutsche Sprache in Forschung und Lehre, Band 36/1986, hrsg. von u. a. Theodor Lewandowski, S. 335 - 346.
- Schulz, Gerhard: Liebesüberfluß. Zu Goethes Ballade ,,Die Braut von Corinth". Jahrbuch des freien deutschen Hochstifts, hrsg. von Christoph Perels, Tübingen 1996, S. 38 - 69.
[...]
1 Johann Wolfgang von Goethe: Gedichte 1756-1799. Bibliothek der Klassiker / 18, hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt am Main 1987, S. 686 - 692. Die Zitate, die mit einem Sternchen versehen sind, beziehen sich alle auf diese Quelle. Ich werde an diesen Stellen auf die entsprechenden Fußnoten verzichten.
2 Hartmut Laufhütte: Die deutsche Kunstballade. Gattungsbegriff und Gattungsgeschichte, in: Textsorten und literarische Gattungen. Dokumentation des Germanistentages in Hamburg vom 1. bis 4. April 1979, hrsg. vom Vorstand der Vereinigung der dt. Hochschulgermanisten, Berlin 1983. S. 335-347, S. 335.
3 Wolfgang Schemme: Goethe: Die Braut von Korinth. Von der literarischen Dignität des Vampirs, in: Wirkendes Wort. Deutsche Sprache in Forschung und Lehre, Band 36/1986, hrsg. von u.a. Theodor Lewandowski, S. 335- 346, S. 338.
4 Die Hekate war zunächst eine Mondgöttin, später war sie als Göttin der Unterwelt, der Zauberei und des nächtlichen Geisterspucks bekannt.
5 Schemme, a. a. O, S. 340.
6 Aus: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Band VI, hrsg. von u. a. E. HoffmannKrayer, Berlin/Leipzig 1934/1935, S. 820.
7 Ceres ist die römische Göttin der Feldfrucht, Bacchus der griechische Gott des Weines und Amor der Gott der Liebe.
8 Johann Wolfgang Goethe: Faust. Texte, hrsg. von Albrecht Schöne, Frankfurt a. Main 1999, S. 57, Vers 1112. (Zum Inhalt: Faust, der sich bisher nur für die Wissenschaft entzünden konnte, fühlt plötzlich eine nie gekannte Sehnsucht nach einem Leben jenseits der Bücher. Der unschuldige Wissensdrang kämpft in seinem Herzen mit der Lust auf Leben, und später nach der Hexenküche, mit der Lust auf Liebe.)
9 Hdw. des deutschen Aberglaubens, Band IX, hrsg. von u. a. E. Hoffmann-Krayer, Berlin 1938/41, S. 572.
10 Hdw. des dt. Aberglaubens, Band VI, a. a. O, S. 813.
11 Das Elysium ist in der griechischen Sage das Land der Seligen am Weltrand der Erde, später auch der Unterwelt. P>10 Hdw. des dt. Aberglaubens, Band VI, a. a. O, S. 813.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Die Braut von Korinth"
Was ist das "Balladenjahr" und welche Bedeutung hat es für Goethes Balladen?
Das "Balladenjahr" bezieht sich auf das Jahr 1797, in dem Goethe und Schiller in enger Freundschaft und gegenseitiger Anregung ihre großen Balladen schufen, darunter Goethes "Der Zauberlehrling" und "Die Braut von Korinth" sowie Schillers "Der Taucher" und "Die Kraniche". Obwohl das Balladenschreiben für beide eher eine Lockerungsübung war, markierte dieses Jahr den Höhepunkt ihres Balladenschaffens.
Was ist eine Ideenballade und welche Merkmale kennzeichnen sie?
Die Ideenballade ist eine Sonderform der neuzeitlichen deutschen Kunstballade, die hauptsächlich auf das Balladenschaffen von Goethe und Schiller bezogen wird. Sie ist eine epische, fiktionale Gattung in Versen, oft gereimt und strophisch, und zeichnet sich durch metrisch-rhythmische Artistik aus. Im Gegensatz zu anderen Balladen liegt der Fokus hier nicht primär auf der Handlung, sondern auf der zugrundeliegenden Idee, die oft aufklärerisches Gedankengut beinhaltet.
Welche Quellen nutzte Goethe für "Die Braut von Korinth"?
Goethe entnahm den antiken Stoff vermutlich dem "Buch der Wunder" von Phlegon Aelius von Tralles (2. Jh.) und der Sammlung "Anthropodemus plutonicus" von Johannes Praetorius (1666). Die Gespenstergeschichte des Machates, der von einer toten Geliebten heimgesucht wird, diente ihm als Vorlage. Er veränderte den Stoff jedoch entscheidend, indem er die Tote zu einer Vampirgestalt mit menschlichen Zügen formte und den Konflikt zwischen Heidentum und Christentum in den Mittelpunkt rückte.
Welche Rolle spielt der Konflikt zwischen Heidentum und Christentum in der Ballade?
Der Konflikt zwischen Heidentum und Christentum ist ein zentrales Thema der Ballade. Die korinthische Familie ist zum Christentum konvertiert, während der Jüngling noch dem heidnischen Glauben anhängt. Goethe kritisiert in der Ballade das Christentum als lebensfeindlich und asketisch, während er das Heidentum als sinnlicher und naturnaher darstellt. Die unterschiedlichen Glaubensrichtungen führen zu einem Bruch zwischen den Liebenden und tragischen Konsequenzen.
Wie stellt Goethe die Vampirgestalt in "Die Braut von Korinth" dar?
Goethe bricht mit den gängigen Vorstellungen des 18. Jahrhunderts und zeichnet die Vampirgestalt als ein Wesen mit menschlichen Zügen. Seine Braut von Korinth empfindet Mitleid, ringt mit ihrem Trieb nach Blut und sehnt sich nach Liebe. Diese Humanisierung der Vampirgestalt ist ein wichtiges Element der Ideenballade und verkörpert aufklärerisches Gedankengut.
Welche Bedeutung hat die Locke, die die Braut von Korinth dem Jüngling abschneidet?
Die abgeschnittene Locke symbolisiert das Leben des Jünglings, das durch die Berührung mit der Vampirin ausgelöscht ist. Sie kündigt seinen baldigen Tod an, deutet aber gleichzeitig an, dass er nach dem Tod ein neues Leben im Elysium mit ihr führen wird. Die Locke verbindet die beiden Liebenden über den Tod hinaus.
Was ist die Botschaft der Ballade?
Goethe bejaht in "Die Braut von Korinth" das sinnerfüllte Leben und kritisiert das Christentum, da es für ihn Askese und ein Leben ohne Freude bedeutet. Er stellt das Heidentum als ein farbiges, menschengerechteres System dar, das eher mit der Natur des Menschen in Einklang steht. Durch die Humanisierung der Vampirgestalt und die Betonung der individuellen Freiheit plädiert Goethe für ein selbstbestimmtes Leben und gegen religiösen Zwang.
- Quote paper
- Alexandra Lenz (Author), 2000, Goethe: "Die Braut von Korinth" - Ein mitfühlendes Vampirmädchen. Eine Analyse der Ideenballade, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/99191