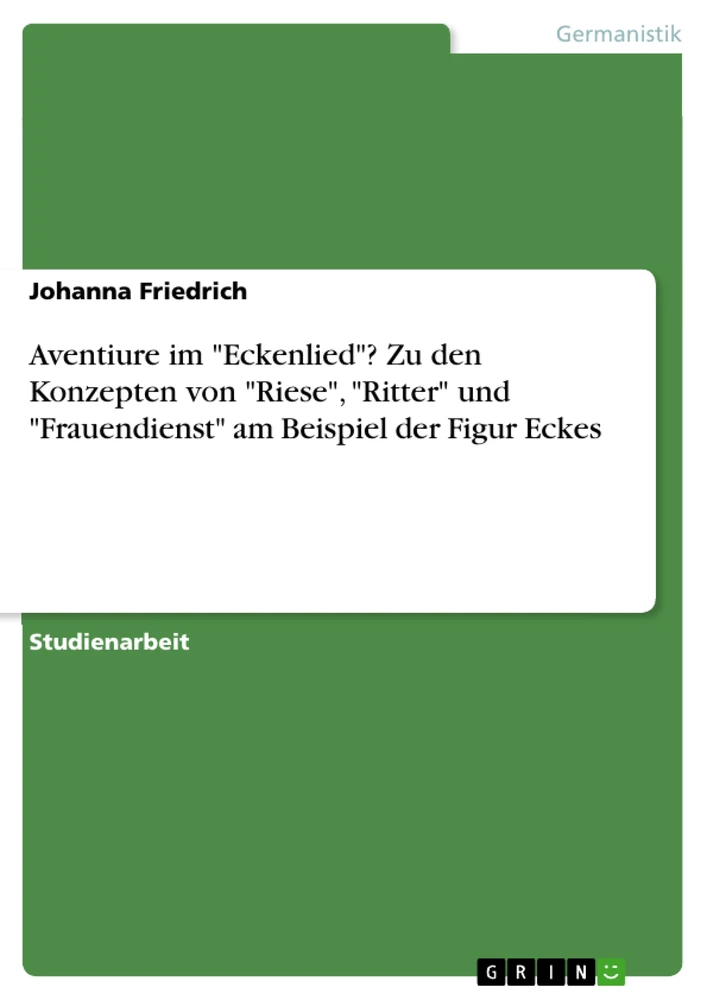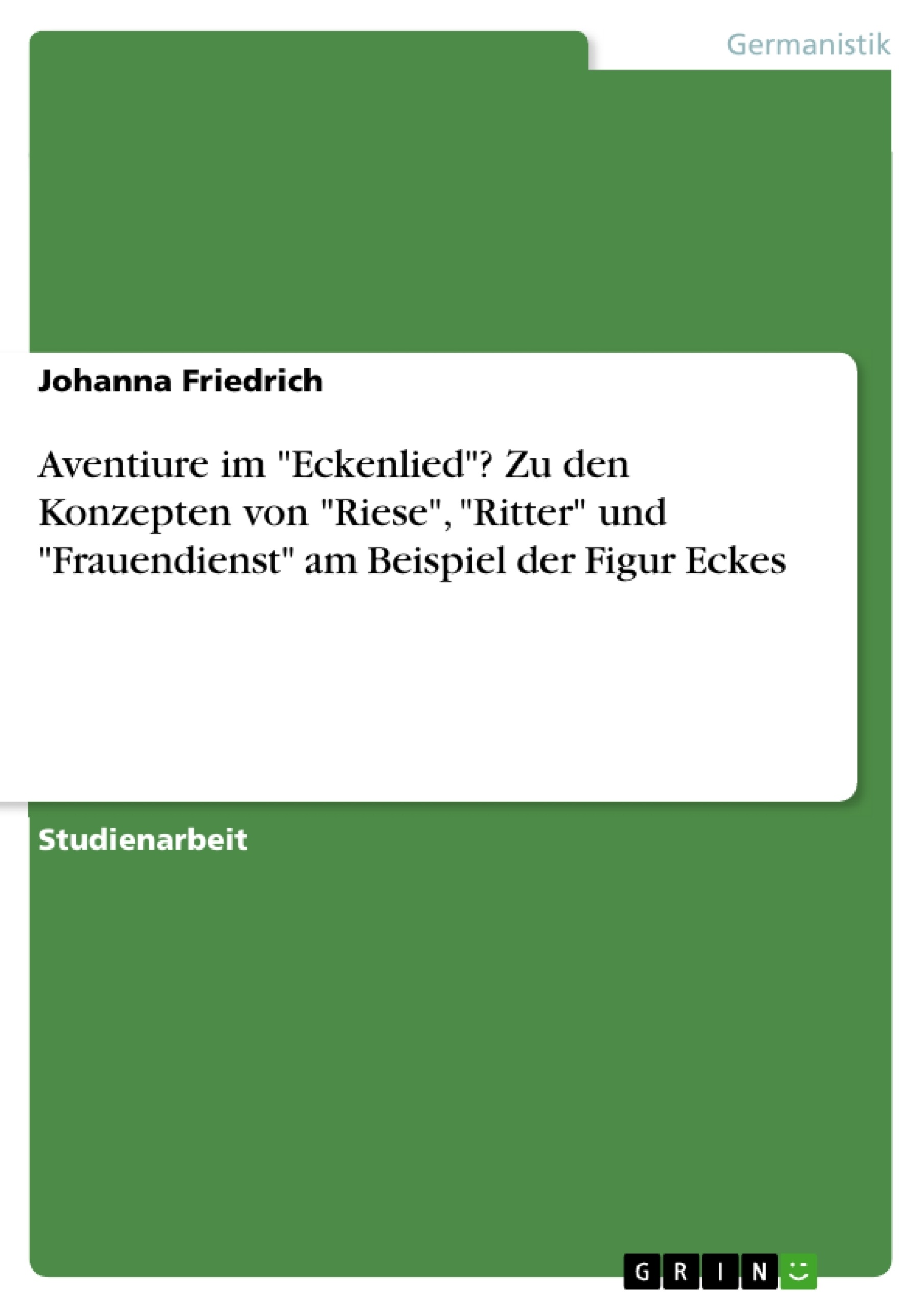In dieser Seminararbeit soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern im ‚Eckenlied‘ am Beispiel der Eigenschaften und Handlungsmotivationen Eckes von Âventiure gesprochen werden kann.
Âventiurehafte Dietrichepik – dieses Genre definieren populärliterarische historische Texte und Heldenepen, deren Paradigmen an Strukturmodelle des Romans erinnern. Die stereotypen Handlungsmuster der Aventiure-Erzählungen um Dietrich von Bern wiederholen sich in den Texten selbst und laufen auf Eindeutigkeit des Ergebnisses hinaus: Probleme werden durch Kämpfe und Waffen aus der Welt geschafft, womit man sich wieder am Anfang der Erzählung befindet und der Kreis geschlossen ist.
Die Wege, die die Dietrichaventiuren ihre Helden gehen lassen, haben mit Gattungsaustritt – „De-generation“ – zu tun.
Dabei bleiben die serielle Komposition und die Heldentypen eindeutig, während Wegtypen anders kombiniert und Perspektiven umgedreht werden. Die Mehrdeutigkeit und strukturelle Offenheit der Texte evozieren Fassungen und Varianten, die den Versuch einer Textrekonstruktion überflüssig machen. Erkennbar ist Degeneration etwa in Doppelungen, Handlungsbrüchen und sekundären Motivierungen – wie etwa in der Figur Ecke, deren Auszug als Aventiure-Eiferer und Frauenritter doppelt motiviert ist. Der Ritter Ecke reitet nicht auf einem Pferd zu Dietrich, um ihn herauszufordern, sondern geht zu Fuß – der Gattungsbruch scheint damit bewusst thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff und Konzept „Aventiure“
- Beitrag von Volker Mertens
- Mireille Schnyder: Sieben Thesen
- Zum Aventiurekonzept in der „Virginal“
- Das „Eckenlied“
- Zu den Begriffen „Riese“ und „Ritter“
- Der Frauen- und Minnedienst in der Epik und Lyrik
- Ecke als Riese, Ritter, Frauendiener?
- Aventiure im Eckenlied?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht, inwiefern im „Eckenlied“ am Beispiel der Figur Ecke von Aventiure gesprochen werden kann. Die Arbeit analysiert Eckes Eigenschaften und Handlungsmotivationen im Kontext des Aventiure-Konzepts. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Figur Ecke und deren Rolle innerhalb der narrativen Struktur des Eckenlieds.
- Der Begriff „Aventiure“ in der mittelalterlichen Literatur
- Die Charakterisierung der Figur Ecke im „Eckenlied“
- Die Darstellung von „Riese“, „Ritter“ und „Frauendienst“ im Kontext des „Eckenlieds“
- Die Frage nach der Gattung des „Eckenlieds“ und seiner Einordnung in die aventiurehafte Dietrichepik
- Analyse der Handlungsmotive Eckes und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der aventiurehaften Dietrichepik ein und beschreibt deren typische Handlungsmuster. Sie stellt die Figur Ecke als Beispiel für eine mehrdeutige und strukturell offene Darstellung innerhalb dieses Genres vor und kündigt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit an: Inwiefern kann im „Eckenlied“ am Beispiel Eckes von Aventiure gesprochen werden?
Zum Begriff und Konzept „Aventiure“: Dieses Kapitel nähert sich dem Begriff „Aventiure“ aus verschiedenen Perspektiven. Es präsentiert Volker Mertens' Definition als selbstgesuchte und vorbestimmte ritterliche Bewährungsprobe und diskutiert Mireille Schnyders sieben Thesen zur engen Beziehung zwischen Aventiure und dem Akt des Geschichtenerzählens. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Begriffs von seinen altfranzösischen Wurzeln bis zu seiner Verwendung in der aventiurehaften Dietrichepik, wobei die unterschiedlichen Interpretationen und Anwendungen des Begriffs in verschiedenen literarischen Werken herausgestellt werden. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Aventiure-Konzepts und seinen unterschiedlichen Ausprägungen in der Literaturgeschichte.
Das „Eckenlied“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem „Eckenlied“ selbst. Es analysiert die Begriffe „Riese“, „Ritter“ und „Frauendienst“ im Kontext des Epos und untersucht, wie diese mit der Figur Ecke in Verbindung stehen. Es untersucht die Rolle der Frau und des Minnedienstes in der Epik und Lyrik und wie diese Konzepte im „Eckenlied“ dargestellt werden. Der Schwerpunkt liegt auf einer detaillierten Analyse der Figur Ecke und ihrer Positionierung innerhalb der dargestellten Welt des Epos.
Aventiure im Eckenlied?: Dieses Kapitel setzt die vorhergehenden Kapitel in Beziehung zueinander und zieht Schlüsse hinsichtlich der Forschungsfrage. Es untersucht konkret die im „Eckenlied“ dargestellten Handlungen und Eigenschaften der Figur Ecke und analysiert diese anhand der zuvor etablierten Definitionen und Interpretationen des Begriffs „Aventiure“. Die Zusammenfassung und Interpretation der Analyseergebnisse stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Aventiure, Dietrichepik, Eckenlied, Ecke, Riese, Ritter, Frauendienst, Minnedienst, Heldenepos, mittelhochdeutsche Literatur, Gattung, Bewährungsprobe, narratologische Analyse, Figurencharakterisierung.
Häufig gestellte Fragen zum Eckenlied: Aventiure und die Figur Ecke
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht, ob und inwiefern im mittelhochdeutschen Eckenlied von Aventiure im Bezug auf die Figur Ecke gesprochen werden kann. Sie analysiert Eckes Eigenschaften und Handlungen im Kontext des Aventiure-Konzepts und dessen Ausprägungen in der mittelalterlichen Literatur.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff "Aventiure" in der mittelalterlichen Literatur, die Charakterisierung der Figur Ecke, die Darstellung von "Riese", "Ritter" und "Frauendienst" im Eckenlied, die gattungsspezifische Einordnung des Eckenlieds in die aventiurehafte Dietrichepik sowie eine Analyse der Handlungsmotive Eckes und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff und Konzept "Aventiure" (inkl. Beiträge von Mertens und Schnyder), ein Kapitel zum Eckenlied mit Fokus auf die Begriffe "Riese", "Ritter" und "Frauendienst", ein Kapitel zur Frage nach Aventiure im Eckenlied und einen Schluss. Jedes Kapitel analysiert verschiedene Aspekte des Themas und arbeitet auf die zentrale Forschungsfrage hin.
Wie wird der Begriff "Aventiure" definiert und verwendet?
Der Begriff "Aventiure" wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, unter anderem durch die Definition von Volker Mertens als selbstgesuchte und vorbestimmte ritterliche Bewährungsprobe und Mireille Schnyders sieben Thesen zur Verbindung von Aventiure und dem Erzählen. Die Arbeit verfolgt die Entwicklung des Begriffs von seinen altfranzösischen Wurzeln bis zur Dietrichepik.
Welche Rolle spielt die Figur Ecke in der Analyse?
Ecke steht im Zentrum der Analyse. Die Arbeit untersucht Eckes Eigenschaften und Handlungsmotivationen, um zu klären, ob sein Handeln als Aventiure interpretiert werden kann. Dabei werden die im Eckenlied dargestellten Aspekte seiner Rolle als "Riese", "Ritter" und "Frauendiener" berücksichtigt.
Wie wird das Eckenlied in die aventiurehafte Dietrichepik eingeordnet?
Die Arbeit untersucht die Gattung des Eckenlieds und seine Einordnung in die aventiurehafte Dietrichepik. Es wird analysiert, inwiefern das Eckenlied typische Merkmale aventiurehafter Erzählungen aufweist und wie sich dies auf die Interpretation der Figur Ecke auswirkt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Kapitel "Aventiure im Eckenlied?" fasst die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel zusammen und beantwortet die Forschungsfrage, inwiefern im Eckenlied am Beispiel Eckes von Aventiure gesprochen werden kann. Die Interpretation der Analyseergebnisse steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen Aventiure, Dietrichepik, Eckenlied, Ecke, Riese, Ritter, Frauendienst, Minnedienst, Heldenepos, mittelhochdeutsche Literatur, Gattung, Bewährungsprobe, narratologische Analyse und Figurencharakterisierung.
- Arbeit zitieren
- Johanna Friedrich (Autor:in), 2016, Aventiure im "Eckenlied"? Zu den Konzepten von "Riese", "Ritter" und "Frauendienst" am Beispiel der Figur Eckes, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/989029