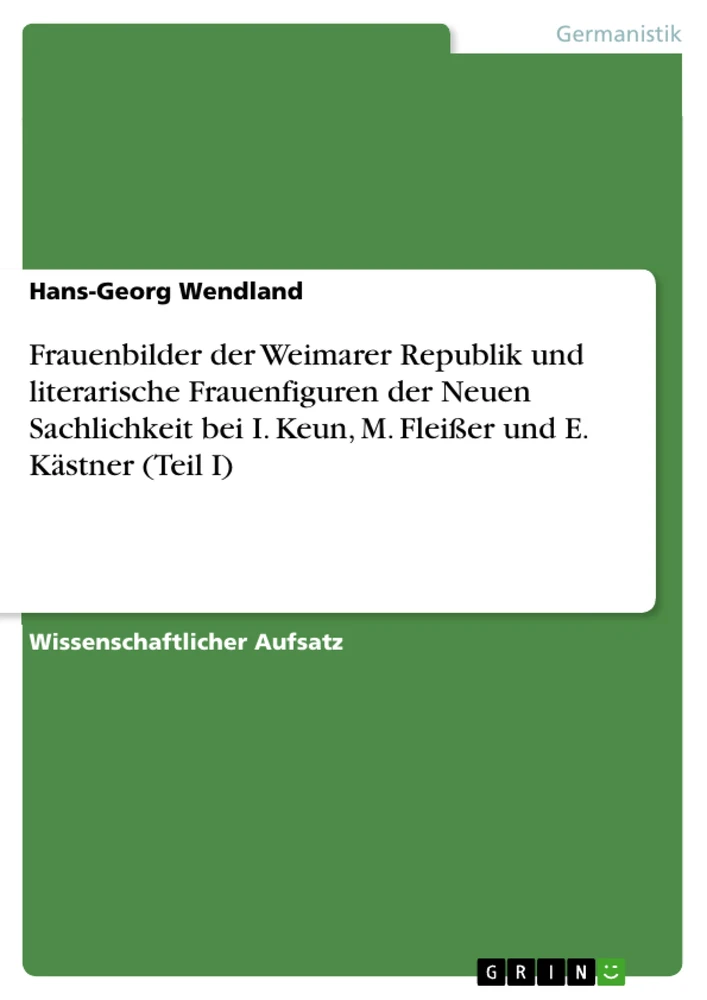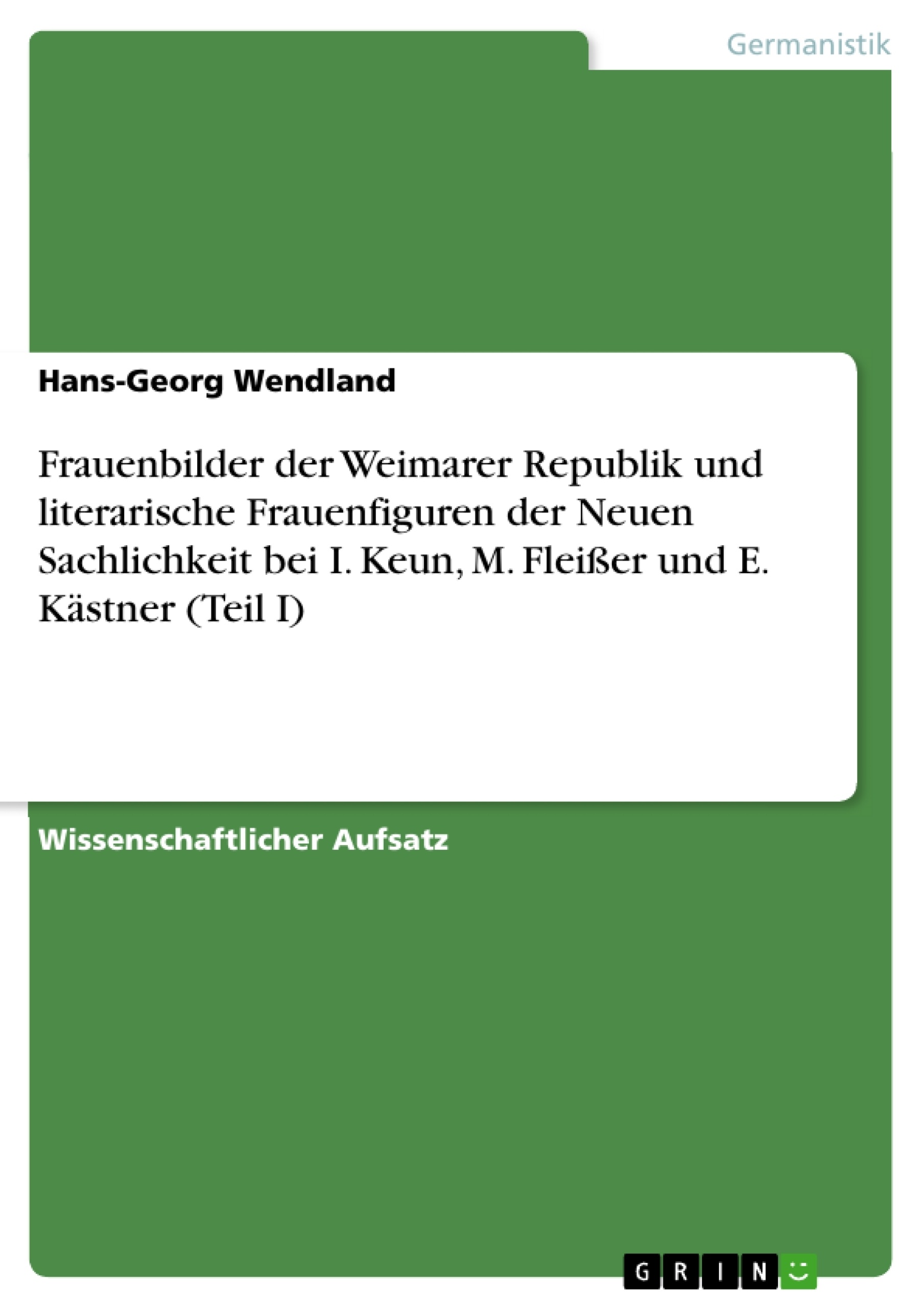In „Fabian“ (1931) von Erich Kästner und "Eine Zierde für den Verein" (1972, überarbeite Fassung von 1931) von Marieluise Fleißer treten uns zwei junge Frauen gegenüber, die in mancher Hinsicht an das Bild der modernen Frau erinnern, das Ende der Zwanzigerjahre weit verbreitet war. Entschlossen und selbstbewusst nehmen sie ihr Leben in die eigenen Hände. In ihrer Unnachgiebigkeit und Härte gegenüber ihrer Umwelt, aber auch gegen sich selbst stellen sie das weibliche Musterbeispiel eines neusachlichen Lebensentwurfs dar. In ihnen scheint sich das Schicksal einer ganzen Generation junger Frauen widerzuspiegeln, die danach strebten, mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen und, allen Widrigkeiten zum Trotz, zielstrebig ihren Weg zu gehen. Diese Eigenschaften kommen besonders prägnant in Marieluise Fleißers Frieda Geier zur Ausprägung. Sie bildet das Modell einer jungen Frau, die illusionslos und konsequent ihren Weg geht, sich nichts vormachen und nicht von geheimen Wünschen und Sehnsüchten leiten lässt. An ihrem Beispiel ist im Unterschied zu anderen Werken zeitgenössischer Romanliteratur zu ersehen, dass zwischen schönem Schein und erlebter Wirklichkeit eine nicht zu überbrückende Kluft bestand und dass die Sehnsucht nach einem sorgenfreien Leben voller Glanz und Glamour mit den Surrogaten der Film- und Vergnügungsindustrie nicht kompensiert werden konnte. Im Gegensatz dazu beruht der von Doris in Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“ (1932) eingeschlagene Weg auf Selbsttäuschung. Er erweist sich als der Irrweg einer jungen Frau, die permanent auf der Suche nach einem Identifikationsmodell ist, das außerhalb ihrer Reichweite liegt. Erst ganz zum Schluss gelangt sie scheinbar zu einer anderen Erkenntnis: "Auf den Glanz kommt es nämlich vielleicht gar nicht so furchtbar an." Die Diskrepanz zwischen den medialen Scheinwelten und dem wirklichen Leben erlebt Doris nur als Augenblicksphänomen ohne bleibende Wirkung, als sie mit dem "grünen Moos" einen Film ansieht, der sie zu Tränen rührt, weil er ihr vor Augen führt, dass ihr eigenes Leben nicht dem ersehnten Traum von einer vollkommenen Liebe entspricht. In ihrem ungestillten Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung vertrödelt sie ihre Zeit mit Selbstinszenierungen, anstatt sich darauf zu besinnen, was ihrem Leben Richtung und Festigkeit verleihen könnte. Dieser Roman wurde gleich nach seinem Erscheinen ein grandioser Publikumserfolg.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Drei literarische Frauenporträts.
- Das traditionelle Frauenbild im gesellschaftlichen Wandel.
- Unsicherheiten und Zweifel
- Neue Formen partnerschaftlichen Umgangs ..
- Alte und neue Zwänge.
- Konkurrierende Frauenbilder.
- Die berufstätige Frau aus männlicher Perspektive .
- Das Dilemma der modernen Frau
- Der Wunsch nach „normaler\" Weiblichkeit
- Die,,Neue Frau\"
- Die,,Neue Frau\" als Kultfigur
- ,,Mit geschäftigen, männlichen Schritten\": die „Neue Frau\" im Alltagsleben
- Die Frau als „Zugabe zum Manne\" und die Überwindung tradierter Rollenmuster
- Erscheinungsformen und Typen der „Neuen Frau\".
- Wiederentdeckung der Weiblichkeit
- Wirkungsbereiche der modernen Frau.
- Neue Rechte für die Frau
- Berufstätigkeit...
- Weibliche Angestellte: schöner Schein und raue Wirklichkeit.
- Hauptberuf: Hausfrau, Ehefrau und Mutter
- Der rechtliche Status der verheirateten Frau laut BGB von 1900.
- „Ehe auf Probe\" oder „Kameradschafts-Ehe\".
- Der „Kuhhandel der bürgerlichen Ehe\"\
- Sport, Jugend und Schönheit: das neue Körpergefühl.…………………………….
- Freizeit und Unterhaltung.
- Zusammenfassung und Ausblick: die Neue Sachlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Frauen in der Weimarer Republik und beleuchtet die literarischen Figuren der Neuen Sachlichkeit bei I. Keun, M. Fleißer und E. Kästner. Sie untersucht, wie diese Figuren das Frauenbild ihrer Zeit widerspiegeln und welche Konflikte und Herausforderungen sie in einem sich wandelnden gesellschaftlichen Kontext erleben.
- Das traditionelle Frauenbild im Wandel
- Die „Neue Frau“ als Leitbild und Konstrukt
- Konflikte zwischen Schein und Wirklichkeit
- Die Suche nach Identität und Selbstbestimmung
- Der Einfluss der Medien auf das Frauenbild
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert drei literarische Frauenporträts aus den Werken von Irmgard Keun, Marieluise Fleißer und Erich Kästner, die als Beispiel für verschiedene Frauentypen der Weimarer Republik dienen. Kapitel 2 beleuchtet das traditionelle Frauenbild und seinen Wandel im gesellschaftlichen Kontext. Es untersucht die neuen Möglichkeiten, die sich für Frauen eröffneten, sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Zweifel. Kapitel 3 befasst sich mit dem Phänomen der „Neuen Frau“ als Kultfigur und analysiert ihre Rolle im Alltagsleben und in den Medien. Kapitel 4 schließlich untersucht die Wirkungsbereiche der modernen Frau, insbesondere in Bezug auf Beruf, Familie und Freizeit.
Schlüsselwörter
Frauenbild, Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit, Literatur, Frauenfiguren, traditionelle Rollen, „Neue Frau“, Medien, Film, Literatur, Gesellschaftlicher Wandel, Identitätsfindung, Selbstbestimmung.
- Arbeit zitieren
- Hans-Georg Wendland (Autor:in), 2021, Frauenbilder der Weimarer Republik und literarische Frauenfiguren der Neuen Sachlichkeit bei I. Keun, M. Fleißer und E. Kästner (Teil I), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/987109