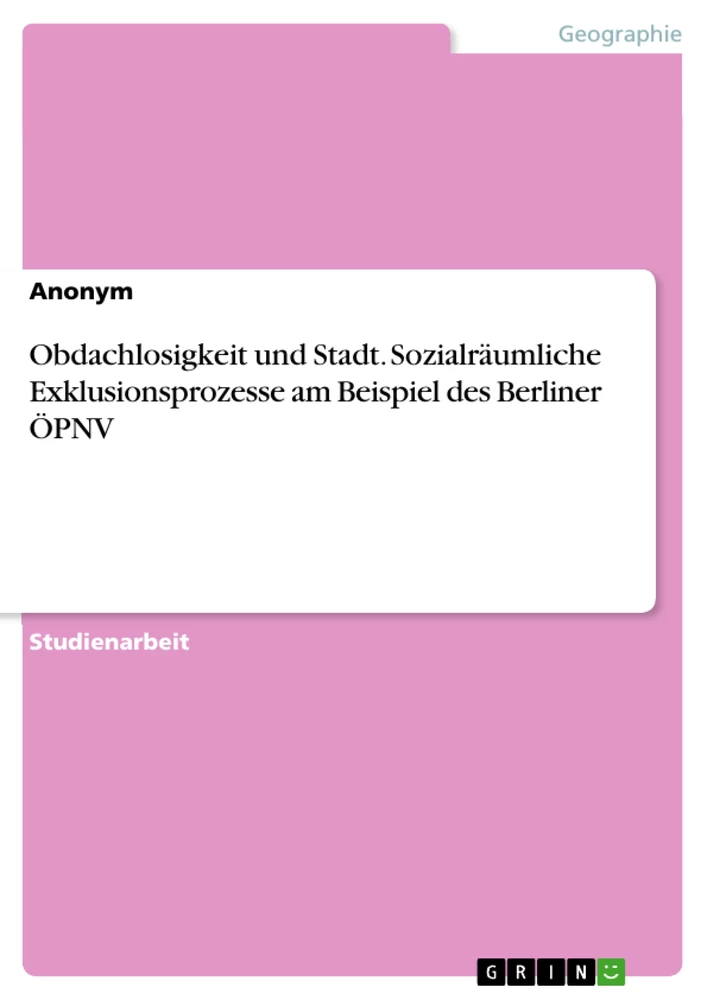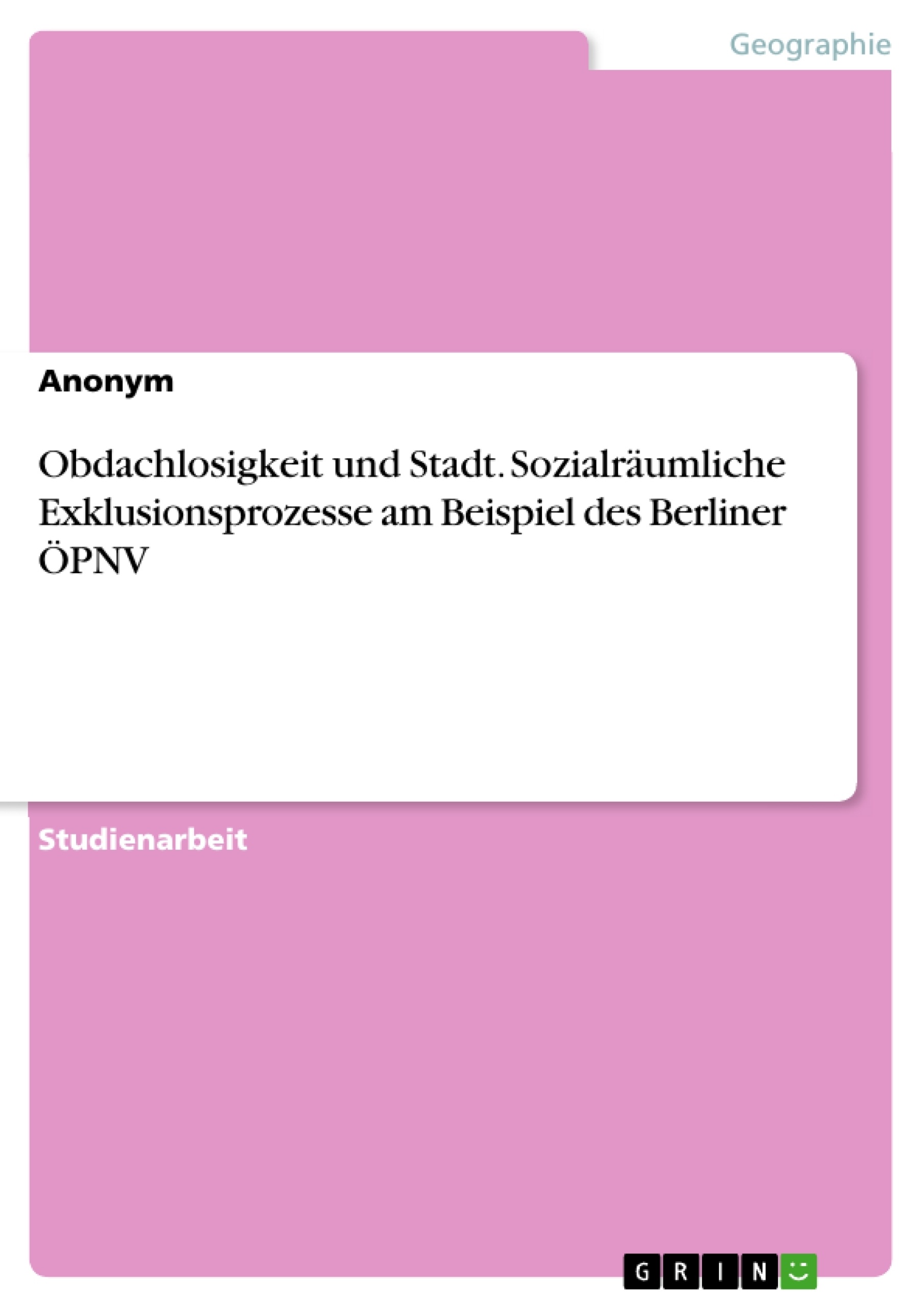Diese Hausarbeit thematisiert sozialräumliche Exklusionsprozesse am Beispiel der Exklusion obdachloser Menschen im Berliner ÖPNV. Konkret wird dabei untersucht, welche Maßnahmen zur Verdrängung obdachloser Personen aktuell Anwendung finden.
Obdachlosigkeit stellt in Großstädten wie Berlin eine nahezu unübersehbare Problematik dar. Insbesondere in den kalten Wintermonaten entfacht die Präsenz von Obdachlosen im städtischen Raum regelmäßig öffentliche Debatten in Berlin. Je kälter die Nächte sind, desto mehr werden überdachte und windstille öffentliche Plätze als Aufenthalts- und Schlaforte in Anspruch genommen und desto sichtbarer wird das Problem der Obdachlosigkeit für die Gesellschaft. Dazu trägt beispielsweise die Öffnung vereinzelter U-Bahnhöfe (2016/2017 in Berlin: U Schillingstraße und U Südstern) als Not-Schlafplatz bei, die unterschiedliche Reaktionen von Unwohlsein über Mitleid bis hin zu verstärktem Engagement in der Gesellschaft hervorrufen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Wissenschaftlicher Hintergrund
- 2.1 Einordnung in die politische Geographie
- 2.2 Gesellschaftliche Wahrnehmung von Obdachlosen
- 2.3 Formen räumlicher Exklusion
- Exklusion im Berliner ÖPNV
- 3.1 Maßnahmen
- 3.2 Wahrnehmung von Betroffenen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der räumlichen Exklusion obdachloser Menschen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Fallbeispiel Berlin. Die Arbeit untersucht, welche Maßnahmen zur Verdrängung dieser Personengruppe im Berliner ÖPNV Anwendung finden. Darüber hinaus werden die Wahrnehmungen betroffener Personen in diesem Zusammenhang beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Obdachlosigkeit“ und „Wohnungslosigkeit“
- Wissenschaftliche Einordnung des Themas in die politische Geographie
- Gesellschaftliche Wahrnehmung von Obdachlosen und die damit verbundene Stigmatisierung
- Formen räumlicher Exklusion im Kontext der Verdrängung von Obdachlosen
- Analyse der Maßnahmen zur Verdrängung von Obdachlosen im Berliner ÖPNV
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Obdachlosigkeit in Großstädten wie Berlin ein und beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz sowie die stetig steigende Zahl von Wohnungslosen in Deutschland. Dabei wird die Problematik der hohen Dunkelziffer und der Schätzung von Betroffenenzahlen hervorgehoben.
- Im Kapitel „Begriffsklärung“ werden die Begriffe „Obdachlosigkeit“ und „Wohnungslosigkeit“ definiert und anhand der ETHOS-Typologie voneinander abgegrenzt. Besonderes Augenmerk wird auf die prekärste Form der Wohnungslosigkeit, die Obdachlosigkeit, gelegt, da sich diese Arbeit auf diese Personengruppe konzentriert.
- Das Kapitel „Wissenschaftlicher Hintergrund“ ordnet das Thema der Verdrängungsprozesse in die politische Geographie ein und betont den Einfluss der räumlichen Komponente. Anschließend wird die gesellschaftliche Wahrnehmung von Obdachlosen beleuchtet, wobei die Stigmatisierung und die damit verbundenen Unsicherheitsgefühle im Vordergrund stehen. Das Kapitel beleuchtet zudem die Rolle der Medien und der Politik in der Darstellung und Wahrnehmung von Obdachlosen.
- Das Kapitel „Formen räumlicher Exklusion“ greift die Kategorisierung von räumlicher Exklusion nach Teuscher auf. Es werden die drei Formen der Reglementierung des Raums, der Sanktionierung der Anwesenheit und der latenten Hinderung an der Nutzung erläutert und die Unterscheidung zwischen harten und weichen Formen der Exklusion verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, räumliche Exklusion, gesellschaftliche Wahrnehmung, Stigmatisierung, Verdrängung, ÖPNV, Berlin. Darüber hinaus werden Themen wie soziale Exklusion, Stadtplanung, öffentliche Ordnung, sozialräumliche Diskriminierung und qualitative Befragungen behandelt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Obdachlosigkeit und Stadt. Sozialräumliche Exklusionsprozesse am Beispiel des Berliner ÖPNV, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/986015