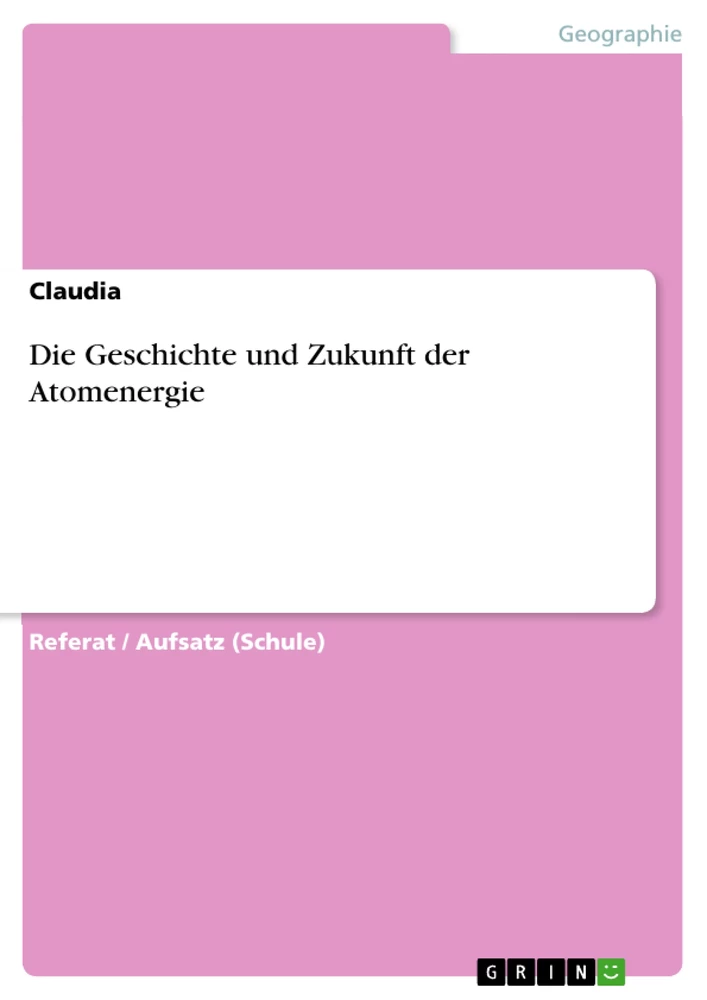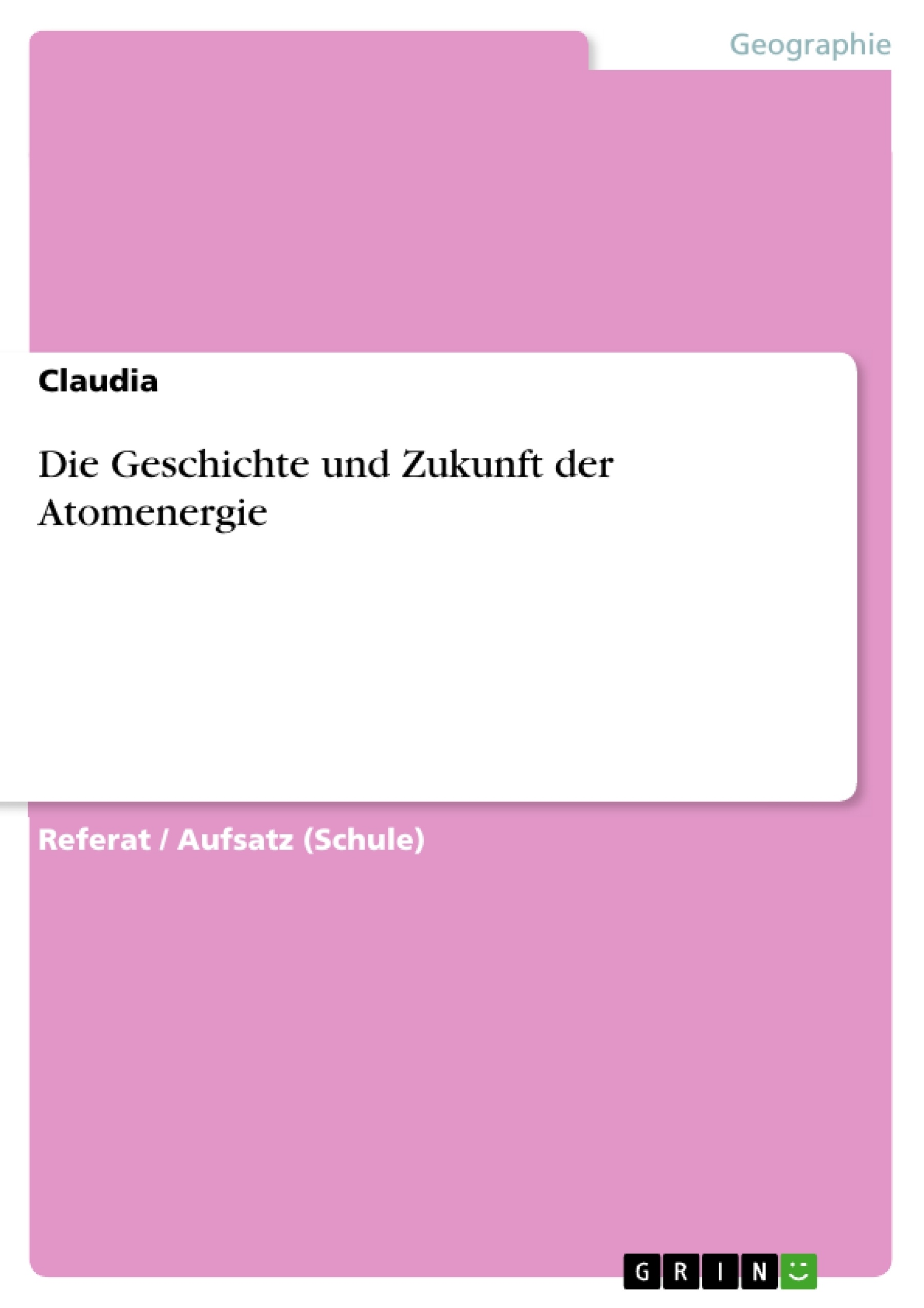Atomenergie
1. Atomkraft gestern und morgen
1.1 weltweit
Alles begann damit, dass den Physikern Hahn und Strassmann 1938 die erste Kernspaltung gelang. Darauf wusste man, dass es technisch möglich wäre, sowohl Atomreaktoren als auch -bomben zu bauen. 1942 gelang dem italienischen Physiker Enrico Fermi im Rahmen des ,,Manhattan-Projekts" (geheimes Projekt der Amerikaner zur Fertigstellung einer Atombombe) die Auslösung der ersten kontrollierten nuklearen Kettenreaktion- der erste Reaktor.
Die schrecklichen Folgen einer Atombombe offenbarten sich erstmals 1945, als die Amerikaner im 2. Weltkrieg Hiroshima und Nagasaki bombardierten. Man sah zum ersten Mal die grauenvollen Folgen radioaktiver Strahlung.
Bis 1953 wurde in Deutschland verboten Atomtechnik oder -wissenschaft zu betreiben. Die anderen grossen Nationen forschten jedoch munter weiter. Später fand auch vermehrt Forschungsaustausch zwischen den Nationen statt- dies führte zur technischen Weiterentwicklung.
Allmählich wurden aber auch der Bevölkerung die Nachteile der Atomkraft bewusst- damals war dies vor allem die Produktion von Atomwaffen aus radioaktiven Abfällen. Darum fand 1955 in Genf die internationale Konferenz zur ,,friedlichen" Nutzung der Atomenergie statt. Daraufhin sah man der kommerziellen Ausschöpfung dieser Energie sehr optimistisch entgegen. 1956 wurde in England der erste Reaktor in Betrieb gesetzt.
1.2 die Schweiz
1969 wurde in Beznau das erste AKW ans Netz angeschlossen. Allerdings wuchs nach den beiden Reaktorunglücken von Harrisburg und vor allem nach Tschernobyl der Widerstand gegen die Atomreaktoren. 1990 wurde ein Gesetz vom Volk verabschiedet, welches den Bau von AKWs während 10 Jahren verbot. 1993 betrug der Anteil des aus Reaktoren stammenden Stroms in der Schweiz 37%.
1.3 Zukunft???
Ende dieses Jahres läuft die ,,Moratoriumsinitiative" aus. Der Bundesrat hat in diesem Jahr beschlossen, dass die bestehenden AKWs der Schweiz so lange laufen sollen, wie sie technisch sicher sind. Es ist auch nicht auszuschliessen, dass noch ein sechstes Atomkraftwerk gebaut wird. Dies müsste dann allerdings vom Volk bewilligt werden. Hier sollte ebenfalls beachtet werden, dass bevor man ein AKW baut, eine Deponie für die Abfälle existiert (siehe auch Punkt 4).
Weltweit gesehen wird sich die Atomenergie kurzfristig noch weiter ausbreiten (man bedenke, dass in Frankreich der durch Reaktoren erzeugte Anteil an Strom schon heute bei 75% liegt). Dies liegt vor allem daran, dass Atomstrom im Moment sehr billig ist. Viele Probleme sind aber noch nicht geklärt oder schlicht unlösbar; daher wird Atomenergie längerfristig aussterben. vgl: >Burri, K., Schweiz, 164 -181
>www.hausarbeiten.de/archiv/physik/physik-o-kernenergie-ret.shtml >Boschke, F.L., Kernenergie
>TA, 3.10.2000
2. Fachbegriffe im Zusammenhang mit Kernenergie
Um die Probleme radioaktiver Abfälle und Kernenergie überhaupt verstehen zu können, muss man zuerst einige Vorkenntnisse besitzen um sich in diesem Urwald von Fachchinesisch überhaupt orientieren zu können. Wir wollen an dieser Stelle Licht ins Dunkel bringen.
2.1 Halbwertszeit
Als Halbwertszeit bezeichnet man die Zeitspanne, in der die Hälfte der Atomkerne zerfallen ist. Dies bedeutet die Zeit, in der die Aktivität um die Hälfte abgenommen hat. (Grafik: selbstgemacht; mit Hilfe von: Raab, Physik, S.139)
2.2 Radioaktive Abfälle
Wir unterscheiden unter den Abfällen drei verschiedene Arten:
1. schwachradioaktive Abfälle
2. mittelradioaktive Abfälle
3. hochradioaktive Abfälle
Schwachradioaktive Abfälle stammen zumeist aus der Medizin. Diese Art der Abfälle besitzen Halbwertszeiten unter 30 Jahren; es sind sogenannte kurzlebige Strahlungen.
Mittelradioaktive Abfälle kommen vor allem aus stillgelegten Kernkraftwerken.
Hochaktive Abfälle sind die gefährlichsten; sie stammen aus ausgebrannten Brennelementen der Kernreaktoren und/oder von Wiederaufbereitungsanlagen. Sie haben Halbwertszeiten von vielen Millionen Jahren; deshalb werden sie auch langlebige Abfälle genannt.
2.3 Zwischenlagerung
Bevor die Abfälle in eine endgültige Deponie gebracht werden, muss man sie zwischenlagern. Dies muss man tun, weil die radioaktiven Abfälle so heiss sind.
vgl: >Raab, Physik, 1997, S.139
>Hermann, A.G., radioaktive Abfälle, 1983, S.16, S.43 >TA, 7.9.1990
3. Probleme vor der Endlagerung radioaktiver Abfälle
3.1 die Zwischenlagerung
Bei der Zwischenlagerung hat man eigentlich keine grösseren Probleme. Einzig einzelne Demonstranten vor den Kraftwerken machen den AKWs kleinere Sorgen (die Abfälle werden oft in Wasserbecken in den Kraftwerken aufbewahrt); die Zwischenlagerung ist unumgänglich, da sich das umliegende Gestein durch die Hitze so stark erwärmen würde, dass es zu massiven Problemen mit Wasserdampf kommen würde. Eine andere Unart-vorwiegend von Entwicklungsländern (aber auch anderen)- ist es die Abfälle einfach ins Meer zu kippen. Die Zwischenlagerung ist keine Lösung, sondern nur ein Aufschub des Endlagerungsproblems.
3.2 die Wiederaufbereitung
Die abgebrannten Brennelemente eines Reaktors kann man wiederaufbereiten, das heisst einen Teil des Abfalls so präparieren, dass man ihn wieder als Brennstoff verwenden kann- quasi recycling- leider nur quasi. Denn es entstehen auch bei der Wiederaufbereitung Abfälle.
Die Schweiz liess bis vor einigen Jahren die Abfälle in Frankreich und England aufbereiten. Heute aber glücklicherweise nicht mehr; in Sellafield fand man radioaktiv hochverseuchte Böden; dies weil die Wiederaufbereitungsanlage nicht genug Vorsichtsmassnahmen ergriffen hatte. Radioaktivität ist krebserregend und man stellte in Sellafield auch eine erhöhte Krebsrate fest.
Ein anderer Punkt bei der Wiederaufbereitung ist der sogenannte Kastor-Transport. Dieser Transport von den Reaktoren zu den Wiederaufbereitungsanlagen wird sehr oft von Umweltaktivisten blockiert.
vgl: >Arbeitsgr. ,,Wiederaufbereitung" (WAA) Uni Bremen; Atommüll oder der Abschied.. >www.greenpeace.ch
>Beckmann, P., Atomenergie, ja bitte!,1976
4. das Endlagerungsproblem
Die Endlagerung ist der letzte Schritt der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle.
Dieser Atommüll muss wegen den hohen Halbwertszeiten ca. 200'000 Jahre weggeschlossen werden (man rechnet mit 10 Halbwertszeiten Lagerung). Bisher steht auf der ganzen Welt noch kein solches Endlager und auch die bisher vorgeschlagenen Lösungen führten zu keinem Ergebnis. Sie boten alle nicht die geforderte Sicherheit.
4.1 Varianten
> völlig geschlossenes Lager; wie teile ich der Nachwelt mit, an diesem Ort 200'000 Jahre nicht zu graben???
> offenes Lager mit regelmässiger Kontrolle; wer kontrolliert??, weiss man auch in 200'000 Jahren noch wie mit dem Müll umzugehen ist??
> ein gemeinsames Lager für Europa; solange die Schweiz nicht in der EU ist eher undenkbar; Problematik mit weniger technisierten Ländern (z.B. Ukraine)
4.2 Bedinungen für ein Lager
>für die endgültige Lagerung sind nur geologisch langfristig stabile Formationen mit sicherem Abschluss geeignet; somit muss es in einer plattentektonisch sicheren Zone gebaut werden.
>durch das Grundwasser können radioaktive Stoffe an die Umwelt gelangen; es muss also ein wasserundurchlässiges Gestein sein (z.B. Tonschichten) >kein Vulkanismus
DAS LAGER MUSS 200'000 JAHRE VöLLIG SICHER SEIN!!!!!!!
4.3 Unser Vorschlag
Zu Beginn dieses Abschnittes ist zu sagen, dass es nicht sehr einfach ist eine Lösung zu finden (die Experten haben keine; warum sollte also eine Gruppe Gymnasiasten eine vernünftige Lösung finden??).
Offenes Lager mit regelmässiger Kontrolle an folgender Stelle:
Wir schlagen den Ort beim Pfeil vor, weil er alle Punkte von 4.2 erfüllt. Wir meinen aber die Lösung eher an einem andern Ort zu finden. Wir sollten in sichere Raketen investieren um den Müll auf dem Mond zu vergraben. Es gibt dort (bis heute nichts bekannt) keine Plattentektonik und Leben existiert auch nicht. Allerdings liegt der Ausstieg nicht auf dem Mond, sondern im Ausstieg aus der Kernenergie.
vgl: >Arbeitsgr. ,,Wiederaufbereitung" (WAA) Uni Bremen, Atommüll oder der Abschied von einem teuren Traum
>Burri, K., Schweiz, S.180-181 >TA, 24.11.1998
Quellen
Bücher: Beckmann, A., Atomkraft, ja bitte!, 1981
Hermann, A.G., radioaktive Abfälle, 1983
Arbeitsgruppe ,,Wiederaufbereitung" (WAA) Uni Bremen, Atommüll
oder der Abschied von einem teuren Traum, 1977 Burri, K., Schweiz, 1995
Boschke, F.L., Kernenergie, 1988 Raab, Physik, 1997
Zeitungsartikel: TA, 7.9.1990
TA, 24.11.1998
TA, 3.10.2000
Websites:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ursprung der Atomkraftnutzung und wie hat sie sich entwickelt?
Die Nutzung der Atomkraft begann 1938 mit der ersten Kernspaltung durch Hahn und Strassmann. Dies führte zum Bau von Atomreaktoren und -bomben. 1942 gelang Enrico Fermi die erste kontrollierte nukleare Kettenreaktion. Die verheerenden Folgen der Atombombe wurden 1945 in Hiroshima und Nagasaki sichtbar. Nach einem Verbot in Deutschland bis 1953, die Atomtechnik zu betreiben, wurde 1955 in Genf die internationale Konferenz zur friedlichen Nutzung der Atomenergie abgehalten, was zu einem optimistischen Blick auf die kommerzielle Nutzung führte.
Wann wurde das erste Atomkraftwerk in der Schweiz in Betrieb genommen und wie entwickelte sich die Meinung der Bevölkerung?
Das erste AKW in der Schweiz wurde 1969 in Beznau ans Netz angeschlossen. Nach den Reaktorunglücken von Harrisburg und Tschernobyl wuchs der Widerstand gegen Atomreaktoren. 1990 wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Bau von AKWs für 10 Jahre verbot. 1993 betrug der Anteil des Atomstroms in der Schweiz 37%.
Wie sieht die Zukunft der Atomenergie in der Schweiz aus?
Ende des Jahres läuft die "Moratoriumsinitiative" aus. Der Bundesrat hat beschlossen, die bestehenden AKWs so lange zu betreiben, wie sie technisch sicher sind. Der Bau eines sechsten AKWs ist nicht ausgeschlossen, müsste aber vom Volk bewilligt werden. Vor dem Bau eines AKWs muss eine Deponie für die Abfälle existieren.
Was sind die wichtigsten Fachbegriffe im Zusammenhang mit Kernenergie?
Zu den wichtigsten Fachbegriffen gehören Halbwertszeit (die Zeit, in der die Hälfte der Atomkerne zerfallen ist), radioaktive Abfälle (schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle) und Zwischenlagerung (vor der Endlagerung).
Was sind die verschiedenen Arten radioaktiver Abfälle und woher stammen sie?
Es gibt drei Arten radioaktiver Abfälle: schwachradioaktive (meist aus der Medizin mit Halbwertszeiten unter 30 Jahren), mittelradioaktive (vor allem aus stillgelegten Kernkraftwerken) und hochradioaktive (die gefährlichsten, aus ausgebrannten Brennelementen mit Halbwertszeiten von Millionen Jahren).
Welche Probleme gibt es bei der Zwischenlagerung und Wiederaufbereitung radioaktiver Abfälle?
Bei der Zwischenlagerung gibt es weniger Probleme, abgesehen von Demonstrationen. Die Zwischenlagerung ist notwendig, da die Abfälle sehr heiss sind. Die Wiederaufbereitung (Recycling eines Teils des Abfalls) erzeugt ebenfalls Abfälle und birgt Risiken wie hochverseuchte Böden und erhöhte Krebsraten. Der Transport zu Wiederaufbereitungsanlagen (Kastor-Transport) wird oft von Umweltaktivisten blockiert.
Was ist das Endlagerungsproblem und welche Bedingungen müssen für ein Endlager erfüllt sein?
Die Endlagerung ist der letzte Schritt der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle. Der Atommüll muss wegen der hohen Halbwertszeiten ca. 200'000 Jahre weggeschlossen werden. Bisher gibt es weltweit kein solches Endlager. Bedingungen für ein Lager sind geologisch langfristig stabile Formationen, wasserundurchlässiges Gestein und keine Vulkanaktivität. Das Lager muss 200'000 Jahre völlig sicher sein.
Welche Vorschläge gibt es für ein Endlager und welcher Vorschlag wird in diesem Text gemacht?
Es gibt verschiedene Vorschläge, wie ein völlig geschlossenes Lager, ein offenes Lager mit regelmässiger Kontrolle und ein gemeinsames Lager für Europa. In diesem Text wird ein offenes Lager mit regelmässiger Kontrolle vorgeschlagen, aber es wird auch die Idee in den Raum gestellt, sichere Raketen zu nutzen, um den Müll auf dem Mond zu vergraben oder ganz aus der Kernenergie auszusteigen.
- Arbeit zitieren
- Claudia (Autor:in), 2000, Die Geschichte und Zukunft der Atomenergie, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98531