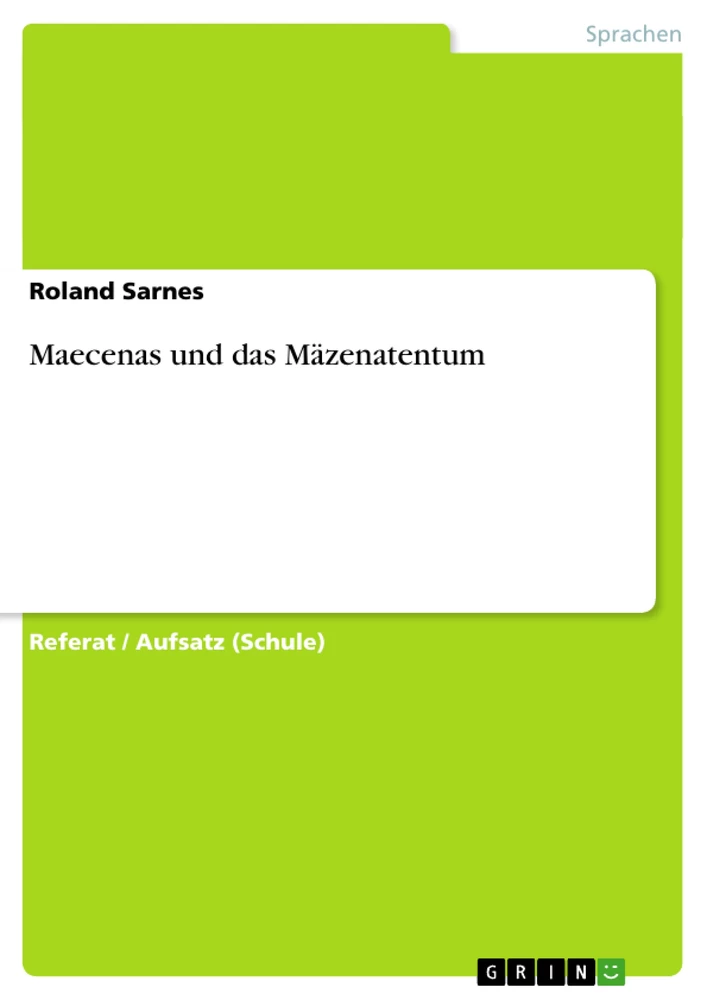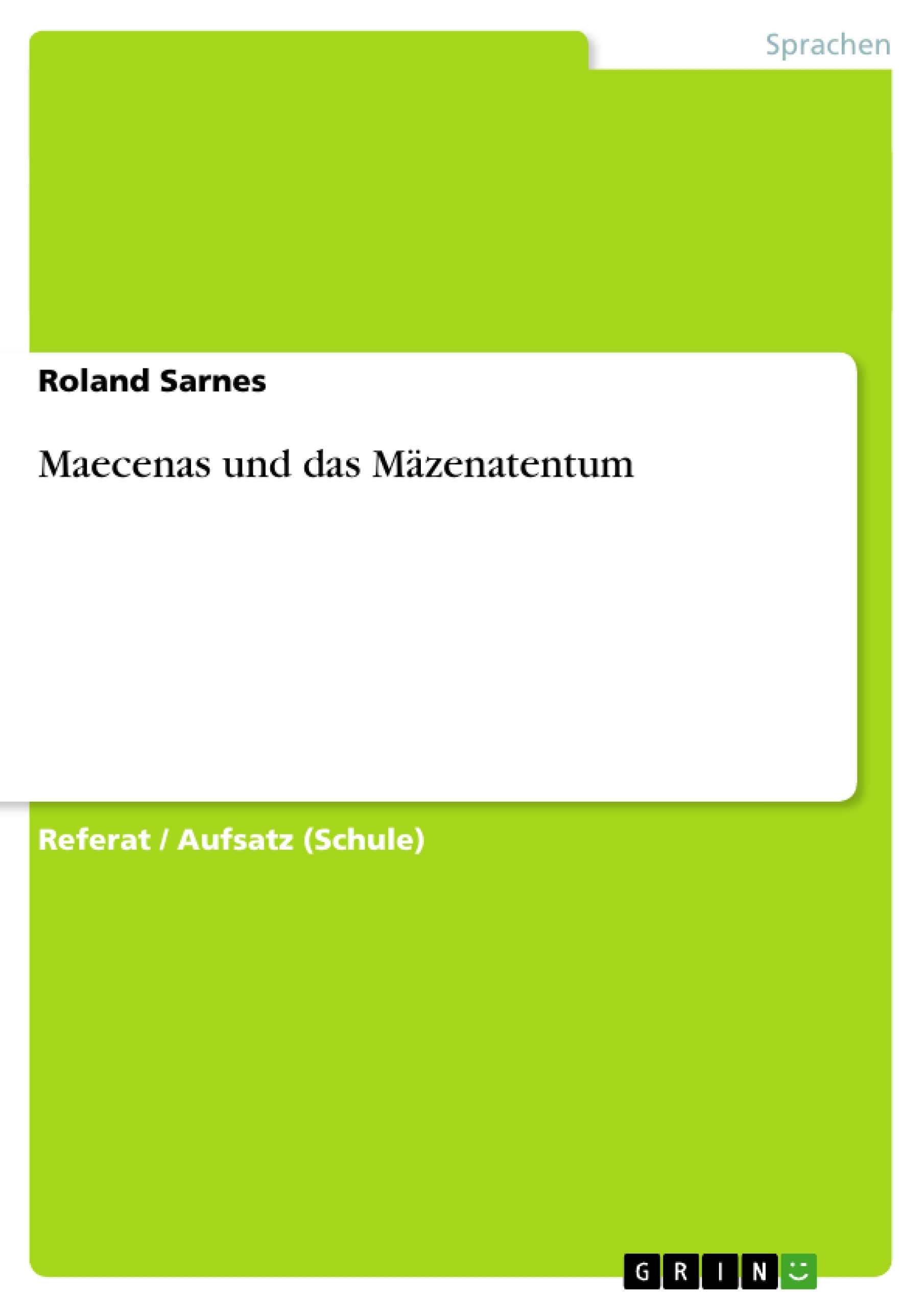Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Aufgabe 1
1. Das Nervensystem
1.2 Somatisches Nervensystem
1.3 Vegetatives Nervensystem
1.4 Vergleich zwischen den Nervensystemen
Aufgabe 2
2. Hypophyse und Hormone
2.1 Oxytocin (OXT)
2.2 Somatotropin (STH)
2.3 Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)
2.4 Prolaktin (PRL)
Aufgabe 3
3. Neurofeedback
3.1 Funktionsweise
3.2 Trainungsablauf und Wirkungsweise
3.4 Anwendungsgebiete im klinischen Bereich
3.5 Nichtmedizinische Anwendungsgebiete
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgabe 1
1. Das Nervensystem
Mit seiner kaum überschaubaren Architektur ist das Nervensystem, mit seinen Milliarden von Nervenzellen, kilometerlangen Nervenfasern und deren komplizierten Verknüpfungen, eines der komplexesten biologischen Systeme des menschlichen Körpers.1 Als elektrochemisches Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetz lenkt es alle physiologischen Prozesse des Körpers wie die Wahrnehmung von sensorischen Eindrücken, die Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts, die Reizweiterleitung sowie Informationssammlung und -auswertung. Strukturell lässt sich das Nervensystem folgendermaßen unterteilen: das zentrale Nervensystem (ZNS) beinhaltet Gehirn und rückenmark; das periphere Nervensystem (PNS) umfasst alle Nervenfasern; das zentrale Nervensystem schließlich verbindet die Sinnesrezeptoren mit den Muskeln und den Drüsen.2 Der Übergang zwischen beiden Nervensystemen liegt im Rückenmark. Das periphere Nervensystems wird zudem in das somatische und vegetative (autonomes) Nervensystem unterteilt.
1.2 Somatisches Nervensystem
Das somatische Nervensystem (SNS) wird auch willkürliches, cerebrospinales oder animalisches Nervensystem genannt und dient der bewussten Wahrnehmung der Umwelt, von Reizen aus dem Körperinneren sowie der Steuerung der Motorik und der Skelettmuskulatur.
Die Reizaufnahme wird entweder über primäre Sinneszellen oder sekundäre Sinneszellen an das zentrale Nervensystem weitergeleitet und dort verarbeitet, um die empfangenen Impulse an bestimmte Körperregionen weiterzuleiten. Die Nervenwurzel des somatischen Nervensystems liegt im Rückenmark, während die Nervenstränge mit der Skelettmuskulatur, den Sinnesorganen und der Haut verbunden sind und eine Oberflächen- und Tiefensensibilität ermöglichen. Weiterhin teilt sich das somatische Nervensystem in afferente und efferente Nerven auf. Afferente Nerven werden als wichtigste Strukturen des peripheren Nervensystems angesehen. Diese peripheren Rezeptoren werden in Mechanorezeptoren, Chemorezeptoren und Photorezeptoren unterteilt und leiten Informationen zum zentralen Nervensystem weiter, um beispielsweise Sinneseindrücke, wie beispielsweise Hören, Schmecken oder Sehen sowie Tasten oder Fühlen zu ermöglichen. Efferente Nerven hingegen versenden Impulse ausgehend vom zentralen Nervensystem, die zu den Skelettmuskeln übertragen werden.3
1.3 Vegetatives Nervensystem
Das vegetative Nervensystem wird dem somatischen Nervensystem gegenübergestellt und steht unter der Kontrolle des Großhirns. Die Steuerung physiologischer Prozesse erfolgt durch automatische, viszerale Funktionen, die ohne bewusste Impulse ausgeführt werden. Hierzu zählen beispielsweise die Regulation des kardiovaskulären Systems, der Flüssigkeitsmatrix, des Gasaustausches mit der Umwelt, der Körpertemperatur, der Aufnahme und Abgabe von Nährstoffen, Mineralien, Abfallprodukten und Wasser sowie die Regulation der Körperabwehr einschließlich des Immunsystems.4
Das periphere vegetative Nervensystem besteht aus Sympathikus, Parasympathikus und Darmnervensystem. Hierbei spielen Sympathikus und Parasympathikus gegensätzliche Rollen und haben eine entgegengesetzte Wirkung in der Regulation der Organe. Während der Sympathikus uns antreibt, lässt der Parasympathikus uns ruhen. Der Sympathikus besteht aus Ganglien und entspringt dem Brustmark und den oberen Segmenten des Lumbalmarks. Die Nervenzellen sind durch Nervenstränge verbunden, die zu Organen der Brusthöhle und des Bauches führen.5 Eine Aktivierung erfolgt bei Alarmsituationen, wodurch der Körper rasch in den Zustand höchster Leistungsfähigkeit versetzt werden kann. Der Parasympathikus entspringt dem Hirnstamm und dem Sakralmark.6 7 Organe wie z. B. Harnblase, Enddarm (Beckenraum), Magen-Darm-Trakt (Bauchraum), Herz, Lunge (Brustraum) und Speicheldrüsen (Kopfbereich) werden sowohl von parasympathischen als auch von sympathischen Fasern innerviert. Jedoch werden nicht alle sympathisch innervierten Organe durch den Parasympathikus angeregt. Die Aktivierung parasympathischer Neurone wirkt beispielsweise erregend auf Harnblase, Speicheldrüsen, auf die glatte Muskulatur der Luftröhren und hemmend auf Herzschrittmacherzellen, Herzvorhöfe und Rankengefäße des erektilen Gewebes der Sexualorgane.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Aufbau des peripheren vegetativen Nervensystems.
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, wie sich psychisches Erleben über das vegetative Nervensystem auf die physiologische Homöostase, einschließlich Immunprozesse, auswirkt, was folglich psychosomatische Effekte biologisch untermauert. Das vegetative Nervensystem als Schnittstelle der psychophysiologischen Regulation gewinnt durch die Forschung zunehmend an Bedeutung und ermöglicht ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen Psyche, Lebensstil, autonomer Regulation und chronischen körperlichen Erkrankungen.8
1.4 Vergleich zwischen den Nervensystemen
Obwohl somatisches und vegetatives Nervensystem miteinander agieren, ist festzustellen, dass durch das somatische Nervensystem hochdifferenzierte und gewollte Vorgänge möglich sind. Hierzu zählt beispielsweise eine willentlich ausgelöste Steuerung der quergestreiften Muskulatur des Körpers, sodass Motorik bewusst ausgeführt werden kann. Das vegetative Nervensystem hingegen ist ein unwillkürliches Nervensystem, das nur eine stark begrenzte bewusste Ansteuerung ermöglicht, und vor allem die glatte Muskulatur, Herzmuskel und Drüsen anspricht. Als Beispiel ist die automatisierte Steuerung von Atmung, Verdauung oder Pulsschlag zu nennen.
Ebenso ist pharmakologisch gesehen ein Unterschied hinsichtlich verschiedener Neurotransmitter in beiden Systemen festzustellen. Acetylcholin ist beispielsweise ausschließlich im somatischen Nervensystem wirksam, wobei nikotinähnliche Neurotransmitter im vegetativen Nervensystem effektiv sind. Ebenso sind bestimmte Hemmstoffe wie Alpha- und Betablocker speziell im vegetativen Nervensystem vorhanden, wohingegen Atropin im somatischen Nervensystem zu finden ist.9
Gleichzeitig sind auch Ähnlichkeiten erkennbar: So besitzen beide Nervensysteme sowohl periphere als auch zentrale Anteile, afferente und efferente Nerven sowie Ähnlichkeiten in der Unterteilung der sensorischen und motorischen Richtung bezüglich der Nervensignale.10
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide Systeme von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen sind und gleichzeitig psychophysiologische Prozesse beeinflussen können.
Aufgabe 2
2. Hypophyse und Hormone
Die endokrine Drüse mit dem größten Einfluss ist die Hypophyse (Hirnanhangdrüse). Als erbsengroße Struktur im mittleren Teil des Gehirns wird sie vom angrenzenden Hypothalamus gesteuert und sorgt für ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Hormone hinsichtlich Steuerung und Regulation. Hormone sind chemische Botenstoffe, die in spezialisierten Hormondrüsen des Hormonsystems gebildet und anschließend in die Blutbahn freigesetzt werden, um vielfältige Aufgaben zu übernehmen. Eine Ausschüttung erfolgt in kleinen Mengen mehrmals täglich, verändert sich rhythmisch über den Tag und wird durch unseren circadianen Rhythmus kontrolliert.11 Die komplexe Funktionsweise dieses Vorgangs wird mittels des hochspezifischen SchlüsselSchloss-Prinzips erreicht. Demzufolge muss ein in die Blutbahn ausgeschüttetes Hormon eine Zelle mit passendem Rezeptor finden, um sich an diese zu binden und seine spezifische Wirkung entfalten zu können.12 Die Hypophyse wird in Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen) und Neurohypophyse (Hypophysenhinterlappen) unterteilt.13 Diese beiden Orte werden vor allem darin unterschieden, dass in der Adenohypophyse Hormone gebildet werden, die zur Steuerung einzelner Körperfunktionen dienen, oder die Ausschüttung anderer Hormone im Körper regulieren. Die Neurohypophyse hingegen ist keine Drüse, sondern dient als Speicherungsorgan, das die vom Hypothalamus ausgeschütteten Hormone sammelt und bei Bedarf freisetzt.14
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Regulation der Hypophyse.
In der Adenohypophyse werden nach Birbaumer und Schmidt (2010) sechs essenzielle Hormone erzeugt. Die glandotropen Hormone (adrenokortikotropes Hormon, thyreoidea-stimulierendes Hormon, folikel-stimulierendes Hormon und luteinisierende Hormon) gelten als Steuerhormone. Nicht-glandotrope Hormone wie das somatotrope Hormon oder das Prolaktin wirken hingegen auf die Zellen eines Organs bzw. den kompletten Organismus.15 16
Anhand des folikel-stimulierenden Hormons (FSH) wird nachfolgend der Prozess der Erzeugung und Freisetzung beschrieben. Als Sexualhormon ist das olikel-stimulierende Hormon bei Männern für die Spermienbildung zuständig und regt bei Frauen Eizellenwachstum sowie die Eizellenreifung an. Durch die Neuronen im Hypothalamus wird ein Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH) erzeugt welches als Freisetzungshormon in den Blutkreislauf abgegeben wird. Nun wird das Gonadotropin-Releasing-Hormon mithilfe des hypophysären Pfortadersystems in die Adenohypophyse befördert, wo sich die Blutgefäße in kleine Kapillaren aufteilen, die hormonproduzierende Nervenzellen mit passenden Rezeptoren besitzen. Aufgrund der Gonadotropin-Releasing- Hormon-Präsenz werden diese Neuronen angeregt, folikel-stimulierende Hormone zu erzeugen und in die Kapillaren abzugeben, um über das Blut in Eierstöcke und Hoden transportiert werden zu können, die für die Eizellen- und Spermienentwicklung zuständig sind.17
In der Neurohypophyse werden das antidiuretische Hormon (ADH) sowie Oxytocin (OXT) gesammelt. Da ein Teil der Neurone des Hypothalamus mit den Axonen bis in die Neurophyse reichen, werden die Hormone auf entsprechende Signale direkt in das Kapillarennetz ausgeschüttet, um daraufhin in den Blutkreislauf zu gelangen.18
2.1 Oxytocin (OXT)
Oxytozin (OXT) besteht aus neun Aminosäuren und wird in den Neuronen der Nuclei supraoptici und paraventriculares produziert. Über den axonalen Transport wird es in den Hypophysenhinterlappen transportiert, wo es bei Bedarf abgegeben werden kann. Als sogenanntes „Bindungshormon“ spielt es beispielsweise während Geburt und Stillzeit eine tragende Rolle. Während des Geburtsprozesses nimmt die Oxytocinkonzentration schubweise zu, womit eine regelmäßige Kontraktion des Uterus ausgelöst wird. Ebenso ist es für das anschließende Einschießen der Milch in die Brust sowie die emotionalen Bindung der Mutter an den Säugling beim Stillen zuständig.19
Vergleichbare positive Auswirkungen beim männlichen Geschlecht wurden in einer Studie Schweizer Wissenschaftler untersucht. Hierbei wurde der Hälfte der männlichen Probanden Oxytocinspray über die Nase verabreicht und anschließend Bilder von ärgerlichen oder ängstlichen Gesichtern vorgelegt. Gleichzeitig konnte über einen fMRT-Scan festgestellt werden, dass die Versuchsteilnehmer, die zuvor ein Oxytocinspray erhalten hatten, eine vergleichsweise schwächere Aktivierung der Amygdala zeigten, als die Probanden ohne Oxytocin.20
[...]
1 Vgl. Beck/ Anastasiadou/ Meyer zu Reckendorf (2018), S. 1.
2 Vgl. Myers (2008), S. 65.
3 Vgl. Pinel/ Pauli (2017), S. 70.
4 Vgl. Jänig (2006)S. 134.
5 Vgl. von der Assen (2016), S. 80.
6 Vgl. Jänig (2006), S. 134.
7 Vgl. Jänig (2006), S. 135.
8 Vgl. Fouradoulas/ von Kännel/ Schmid (2019), S. 461ff.
9 Vgl. Efferth (2006), S: 52-56.
10 Vgl. Rohkamm & Kermer (2017), S. 24.
11 Vgl. von der Assen (2016), S. 81.
12 Vgl. Schneider, H. J., Jacobi, N., Thyen, J. (2020), S. 17.
13 Vgl. Güntürkün (2012), S. 95f.
14 Vgl. Schneider, H. J., Jacobi, N., Thyen, J. (2020), S.20.
15 Ebd., S.20.
16 Vgl. Birbaumer/ Schmidt (2010), S. 127.
17 Vgl. Güntürkün (2012), S. 96.
18 Ebd., S. 96.
19 Vgl. Walter (2003), S.100.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist ein umfassender Einblick in verschiedene Themenbereiche, darunter das Nervensystem, die Hypophyse und Hormone sowie Neurofeedback. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, Abkürzungsverzeichnis, Aufgaben zu den genannten Themen, ein Literaturverzeichnis und Internetquellen.
Was behandelt Aufgabe 1?
Aufgabe 1 behandelt das Nervensystem, einschließlich des somatischen und vegetativen Nervensystems, sowie einen Vergleich zwischen beiden Systemen.
Was sind die Hauptthemen von Aufgabe 2?
Aufgabe 2 konzentriert sich auf die Hypophyse und verschiedene Hormone wie Oxytocin (OXT), Somatotropin (STH), Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) und Prolaktin (PRL).
Was ist das Thema von Aufgabe 3?
Aufgabe 3 behandelt Neurofeedback, einschließlich seiner Funktionsweise, Trainingsablauf, Wirkungsweise sowie Anwendungsgebiete im klinischen und nichtmedizinischen Bereich.
Was wird über das somatische Nervensystem gesagt?
Das somatische Nervensystem (SNS) wird als willkürliches Nervensystem beschrieben, das für die bewusste Wahrnehmung der Umwelt und die Steuerung der Motorik zuständig ist. Es wird in afferente und efferente Nerven unterteilt, die Informationen zum bzw. vom zentralen Nervensystem leiten.
Was ist das vegetative Nervensystem?
Das vegetative Nervensystem ist ein unwillkürliches Nervensystem, das physiologische Prozesse wie die Regulation des kardiovaskulären Systems, der Körpertemperatur und des Gasaustausches steuert. Es besteht aus Sympathikus, Parasympathikus und Darmnervensystem.
Was ist die Funktion der Hypophyse?
Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) ist eine endokrine Drüse, die von Hypothalamus gesteuert wird und eine wichtige Rolle bei der Steuerung und Regulation verschiedener Hormone spielt. Sie wird in Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen) und Neurohypophyse (Hypophysenhinterlappen) unterteilt.
Welche Hormone werden in der Adenohypophyse erzeugt?
In der Adenohypophyse werden glandotrope Hormone (adrenokortikotropes Hormon, thyreoidea-stimulierendes Hormon, folikel-stimulierendes Hormon und luteinisierende Hormon) und nicht-glandotrope Hormone (somatotrope Hormon und Prolaktin) erzeugt.
Was ist die Funktion von Oxytocin (OXT)?
Oxytocin (OXT) wird als "Bindungshormon" bezeichnet und spielt eine wichtige Rolle während Geburt und Stillzeit, indem es Uteruskontraktionen auslöst und die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind fördert. Studien haben gezeigt, dass es auch Auswirkungen auf die Aktivierung der Amygdala hat.
Gibt es Unterschiede zwischen dem somatischen und dem vegetativen Nervensystem?
Ja, es gibt Unterschiede. Das somatische Nervensystem ermöglicht hochdifferenzierte und gewollte Vorgänge, während das vegetative Nervensystem unwillkürlich ist und vor allem die glatte Muskulatur, den Herzmuskel und die Drüsen anspricht. Es gibt auch Unterschiede in den Neurotransmittern und Hemmstoffen, die in beiden Systemen wirken. Es sind aber auch Ähnlichkeiten zu erkennen, wie periphere und zentrale Anteile, afferente und efferente Nerven sowie Ähnlichkeiten in der Unterteilung der sensorischen und motorischen Richtung bezüglich der Nervensignale.
- Quote paper
- Roland Sarnes (Author), 1982, Maecenas und das Mäzenatentum, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/98476