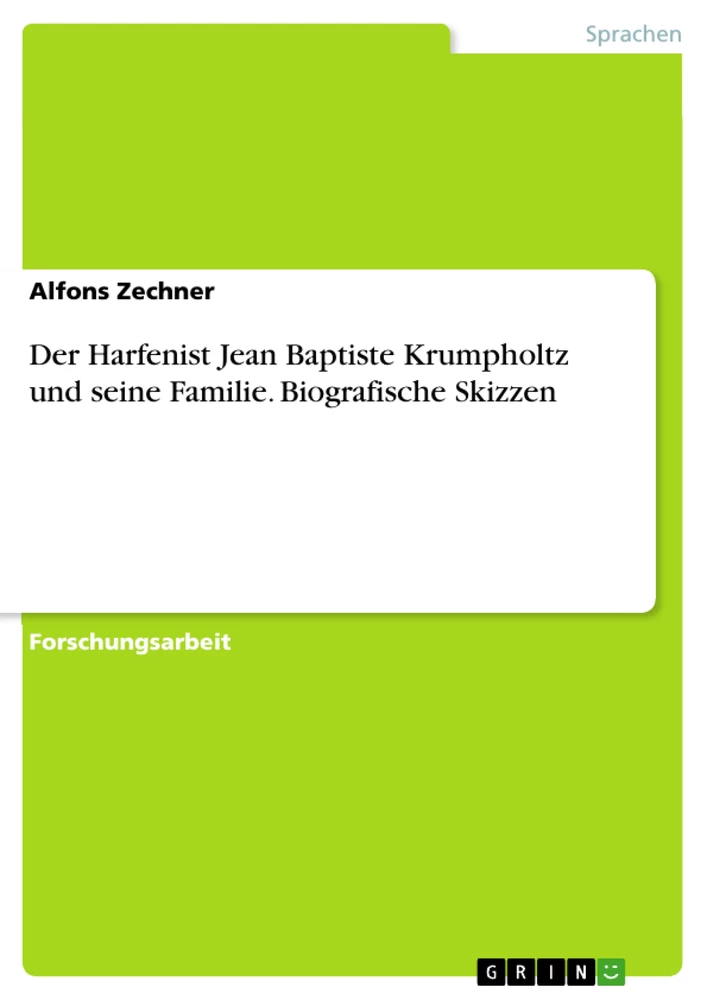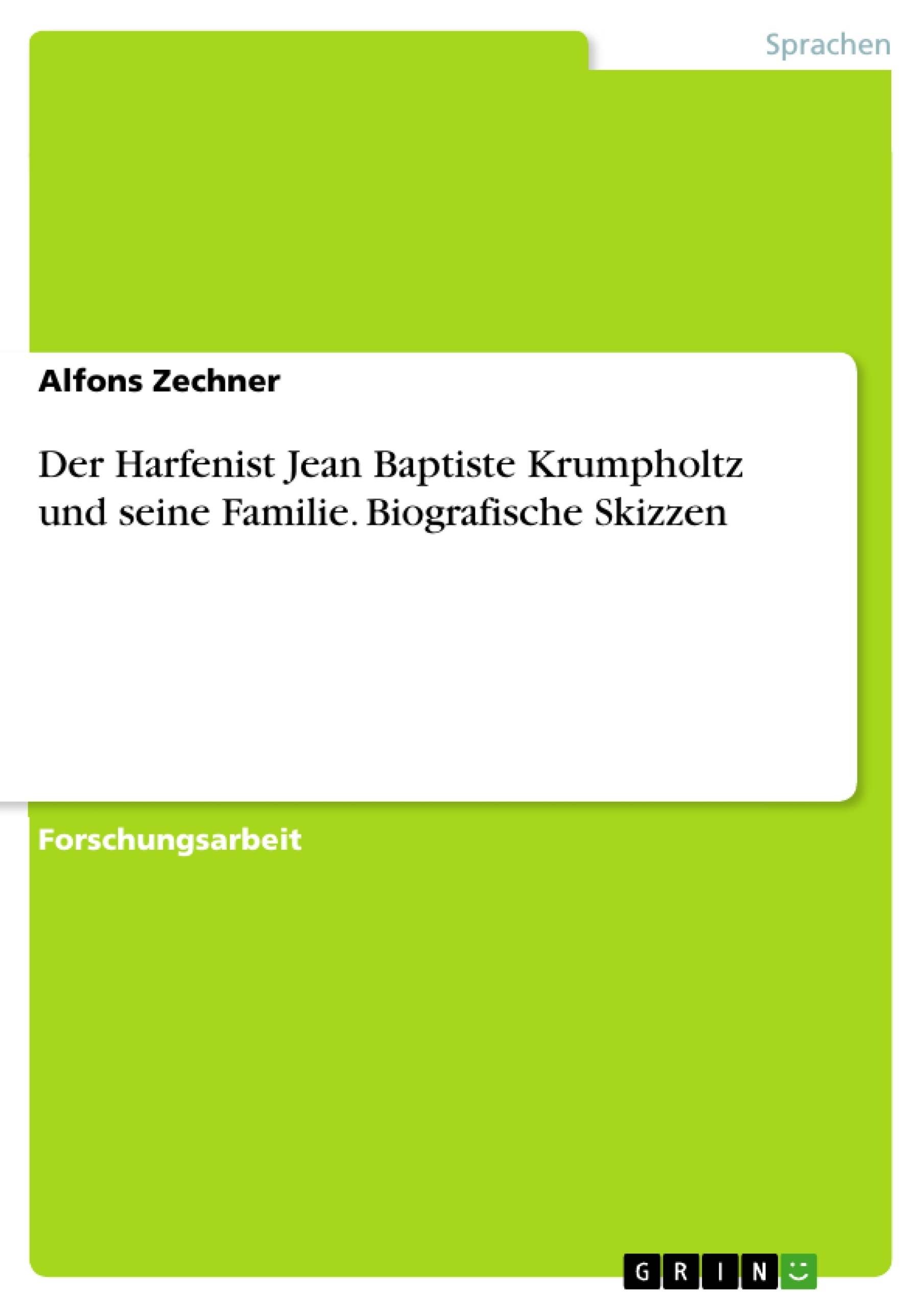Zweck dieser Arbeit ist es, biografische Fragen, die bei einer Sichtung einiger Quellen vor einem zeit- und musikgeschichtlich schillernden Hintergrund aufkamen, zu beantworten. Diese betreffen den Komponisten sowie einige seiner Familienmitglieder.
Der Besuch eines Konzerts, während dessen auch ein Stück für Harfe und Orchester von Jean-Baptiste Krumpholtz präsentiert worden war, weckte ein das Ende dieser Darbietung überdauerndes Interesse. Das gespielte Werk, ferner aber auch zwei Geburtsdaten des Komponisten verschiedener Jahre ohne Erörterung der Diskrepanz in den biografischen Notizen des Veranstalters dienten als Anregung, über das Leben und Schaffen des Komponisten Näheres in Erfahrung zu bringen.
Über Krumpholtz‘ Jugend ist kaum mehr als das bekannt, was eine autobiografische Überlieferung erzählt. Eine systematische Schulausbildung wird Jan Křtitel nicht zuteilgeworden sein. Er ist als Leibeigener in einer Zeit aufgewachsen, in der es in seinem Lebensumfeld noch keine Schulpflicht gab. Der wahrscheinliche Mangel einer soliden allgemeinen Schulbildung wird auch dessen künstlerische Entwicklung anfänglich erschwert haben. Seine Liebe für das Harfenspiel und der Wunsch, auch als Komponist Bedeutung zu erlangen, waren aber immer starke Triebfedern seines Strebens. Das Spiel der Mutter wird der Keim seiner Neigung für die Harfe und deren Klänge gewesen sein. Die Mutter wird den Knaben ferner bereits seit früher Kindheit durch praktische Unterweisungen mit dem Instrument einigermaßen vertraut gemacht haben. Im älteren Schrifttum des 20. Jahrhunderts wurde dagegen vereinzelt unrichtig behauptet, der Vater J. Haydns habe den ungarischen Musiker "Johan Baptist Krumpholz" an der Harfe unterrichtet.
Inhalt:
A. Jean-Baptiste (Jan Křtitel) Krumpholtz (1747 – 1790)
I. Autobiografische Überlieferung
1. Wortlaut
2. Quelle
2.1 Chronologie von Ereignissen
2.2 Authentizität
II. J. M. Plane über seinen Lehrer
1. Künstlerische Bedeutung
2. Schicksal
3. Werdegang der Krumpholtz’schen Harfenschule
III. Biografische Erzählung
1. Jugend, Ausbildung und frühe Wanderjahre
2. Wien
2.1 Bruder Václav (Wenzel) Krumpholtz
3. Eszterház
4. Konzerttournee
5. Metz
6. Künstlerische Entfaltung in Paris
6.1 Krumpholtz‘ eminente Schülerin
6.1.1 Anne-Maries Mädchenname
7. Persönliche und familiäre Entwicklungen
7.1 Leibeigenschaft
7.2 Veränderungen im Familienstand
8. Verbesserung der Harfenmechanik
9. Ausreißen der Anne-Marie Krumpholtz
9.1 Die Vornamen Anne-Maries
9.2 Zur Zeitspanne
9.2.1 Concert Spirituel
9.2.2 Madame Krumpholtz – Debüt und frühe Auftritte in London
9.3 Zum Liebhaber
9.3.1 Schrifttum
9.3.2 Indizien zu Gossec Sohn
9.3.3 Indizien zu Dussek
9.4 Resümee
10. Krumpholtz‘ Tod
10.1 Herrschende Ansicht
10.2 Einwände gegen die These vom Freitod
10.3 Stellungnahme
10.4 Nachruf
11. Werke
B. Madame (Anne-Marie, Anne-Marguerite, Julie) Krumpholtz (1766 – 1813)
I. Anne-Marie (Anne-Marguerite, Julie) Steckler (verehel. Krumpholtz) in Frankreich
II. Madame Krumpholtz in London
1. Die Künstlerin
1.1 Berufliche Kooperation mit Dussek
1.2 Künstlerischer Ruf
2. Das Privatleben
2.1 Gerüchte über Liebhaber
2.1.1 Liebschaft mit Ferrari?
2.1.2 Verehrer Earl of Powis
2.1.3 Affäre mit Dussek?
2.2 Konkubinat mit Sturt
2.2.1 Prozess Sturt gegen Blandford
2.2.1.1 Madame Krumpholtz im Beweisverfahren
2.2.1.2 Schlüsse aus dem Beweisverfahren
2.2.2 Kinder aus dem Konkubinat
2.2.3 Dauer des Konkubinats
3. Der Ausklang
3.1 Fortsetzung und Beendigung der Karriere als Harfensolistin
3.2 Tätigkeit als Harfenpädagogin und Komponistin
3.3 Vermittlerin für Érard
3.4 Das Ende
3.4.1 Tod
3.4.2 Nachlass
C. Fanny (Louise Françoise) Pittar-Krumpholtz (1779 – 1862)
I. Abstammung, Kindheit und Jugend
1. Abstammung
2. Kindheit und Jugend in Frankreich
3. Übersiedlung nach England
4. Konversion zum Anglikanismus
II. Aufenthalt in Irland
III. Umgang mit Madame Krumpholtz
IV. Familie
V. Berufliche Entfaltung – Verwechslung mit Melanie Krumpholtz
VI. Tod
Quellen
Bibliografie
Bildnachweise
Abkürzungen
Zum Autor:
Dr. jur. Alfons Zechner, Richter im Ruhestand, Österreich.
Anstoß für die Skizzen:
Der Besuch eines Konzerts, während dessen auch ein Stück für Harfe und Orchester von Jean-Baptiste Krumpholtz präsentiert worden war, weckte ein das Ende dieser Darbietung überdauerndes Interesse. Das gespielte Werk, ferner aber auch zwei Geburtsdaten des Komponisten verschiedener Jahre ohne Erörterung der Diskrepanz in den biografischen Notizen des Veranstalters dienten als Anregung, über das Leben und Schaffen des Komponisten Näheres in Erfahrung zu bringen. Die Sichtung einiger Quellen warf vor einem zeit- und musikgeschichtlich schillernden Hintergrund mehrere biografische Fragen auf, die den Komponisten und einzelne seiner Familienmitglieder betreffen. Darauf Antworten zu finden, die in ihrer Faktizität gesichert oder mehr oder weniger wahrscheinlich sind, ist Zweck dieser Arbeit.
Hinweise:
Zu den in Fußnoten gekürzt zitierten Grundlagen (Quellen und Schrifttum) finden sich die vollständigen Titel und sonstigen Identifizierungsmerkmale in den Verzeichnissen der Quellen und der Bibliografie. Von Google digitalisierte, mit Hilfe von Google Books und Google Play oder auf der Plattform der Österreichischen Nationalbibliothek im Internet zugängliche Quellen und Werke des Schrifttums sind in den Fußnoten und im Registerteil mit einem Klammerausdruck (Google Play) oder (ÖNB-ANNO) gekennzeichnet. Gleiches gilt für digitalisierte Inhalte der (HathiTrust Digital Library) und des (Internet Archive). Zugriffsdaten werden insofern nicht genannt, ist doch nicht anzunehmen, dass dieses inhaltlich unveränderliche historische Material, das für den Abruf im Internet digitalisiert wurde, einen Wandel erfahren oder aus dem Netz entfernt werden könnte. Die Annahme einer dauerhaften und unveränderten Verfügbarkeit bestimmter Netzadressen und Netzdaten betrifft auch manch andere Zitate. Im Übrigen sind in den Fußnoten Zugriffsdaten genannt. Etliche verwendete Werke der Sekundärliteratur enthalten auch die Wiedergabe mehrerer Quellen. Sie sind daher im Quellenregister und in der Bibliografie verzeichnet.
Um den Apparat an Fußnoten nicht zu überlasten, wurden dort nur gelegentlich Hyperlinks eingefügt. Diese sollen den direkten Zugang zu Quellen und Schrifttum während der Lektüre ermöglichen.
Abgesehen von Jahreszahlen und anderen selbsterklärenden Daten beziehen sich arabische Ziffern in Fußnoten auf Seitenzitate. Diese betreffen die Seitenzahlen im zitierten Material, insbesondere auch im digitalisierten. Das bedeutet bei Quellen und Schrifttum in digitalisierter Gestalt, dass nicht die fortlaufende Zählung gescannter Seiten die Grundlage für Zitate bildet, es sei denn, es wird ausdrücklich auf eine Scan-Seitenzählung verwiesen. Vereinzelt sind Seitenzitate auch durch römische Ziffern individualisiert.
Die Übersetzungen gemeinfreier Texte aus Fremdsprachen sind vom Autor. Diese Bearbeitungen sind durch Anführungszeichen kenntlich gemacht. Texte in eckigen Klammern sind jeweils Einfügungen durch den Autor.
A. Jean-Baptiste (Jan K ř titel) Krumpholtz (1747 – 1790)
I. Autobiografische Überlieferung
1. Wortlaut
„Meine Mutter konnte mir keine andere Erbschaft als ihre Leidenschaft für die Harfe hinterlassen1. Ein Lehrer, der das, was er lehrte, selbst hätte lernen sollen, erteilte mir den ersten Unterricht; seine Entlohnung bestand nur aus einer bescheidenen Mahlzeit, die er in unserem Haus verzehrte; und da er seine Besuche drei- bis viermal täglich wiederholte, reflektierte seine große Genauigkeit nicht nur sein Talent, sondern auch seine Beliebtheit. Nach drei Monaten spielte ich Menuette und Allemanden genauso gut, aber zumindest nicht schlechter als mein Lehrer.2 Damals verließ ich Prag, meine Heimat, um meinen Vater zu begleiten, der als Musiker einem französischen Regiment angehörte. Nicht imstande, meine Neigung für die Harfe zu fördern, zog er es vor, mich – ihm entsprechend – eine Oboe blasen und eine Violine und Viola kratzen zu lassen. Er lehrte mich das Lesen der Noten, aber nichts an Komposition; ich widmete der Harfe stets die Zeit, die ich anderen Instrumenten stehlen konnte. Im Alter von vierzehn Jahren [noch 1761 oder schon 1762] kam ich zufällig nach Paris. Man verschaffte mir die Bekanntschaft mit Herrn Hofbruker [sic].3 Er geruhte, mich ein Dutzend Mal zu empfangen; ich spielte ihm einige seiner Sonaten vor; er schien mir nachsichtig zuzuhören und riet mir, mit größerer Kraft und Geschwindigkeit zu spielen. Ich befolgte diesen Rat, und ich schätze mich glücklich, meine Dankbarkeit ihm gegenüber öffentlich zu bekunden.
Bald verließ ich Paris, um mich nach Lille in Flandern zu begeben. Das Verlangen, Komposition zu studieren, quälte mich. Ein Arzt [sic], der mich für begabt hielt, erklärte, mein Lehrer sein zu wollen. Er ärgerte und ermüdete sich sechs Monate vergeblich; während sechs Monaten arbeitete ich zwecklos Tag und Nacht; ich bekritzelte Unmengen an Papier; ich lernte Rameau4 auswendig, aber ich verstand ihn nie. Schließlich verloren mein Lehrer und ich die Geduld. Als einziges Mittel zur Bestreitung meines Unterhalts verblieb mir, den Regimentern und den Orchestern der Truppen von Provinzkomödianten zu folgen. Ich studierte Horn, ich nutzte die wenigen Stunden, die mir Herr Rodolphe5 gewährte, und während fünf Jahren vergaß ich die Harfe vollständig. Ich war fünfundzwanzig Jahre 1772, als ich nach Prag zurückkehrte. Mein Vater wollte, dass ich in ein von ihm begonnenes kleines Unternehmen eintrete, das ihm den Lebensunterhalt verschaffte. Hier bin ich nun so ein Ladenjunge. Eines Abends, als ich an einem Garten vorbeiging, hörte ich eine Serenade, die mir im Ensemble außergewöhnlich erschien. Ich konnte eine Klarinette leicht unterscheiden, allerdings vermochte ich das begleitende Instrument nicht zu erkennen; seine Töne waren, selbst in den Spitzen, voll und weich, mit jenen einer Klarinette zu verwechseln. Ich habe mich genähert. Welche Überraschung, eine Harfe zu sehen! Ein zwölfjähriges Kind spielte sie; sie war aus Walnussholz, ohne Pedale, und von einem einfachen Tischler gefertigt. Die oberen Saiten erschienen mir ein wenig stark, und ich fragte nach dem Grund. Das Kind antwortete mir, feine Saiten seien selten gut; man müsse davon viele kaufen, um die Auswahl zu erleichtern, und ein solcher Aufwand übersteige seine Mittel. ‚Ich bin verärgert‘, fügte es hinzu, ‚starke Saiten verwenden zu müssen; sie bewirken Schmerzen an meinen Fingern, aber ich hoffe, dass ich mich langfristig daran gewöhnen werde‘. Damals hatte ich erkannt, dass die Saitenstärke für die Klanggüte ausschlaggebend war, aber ich fühlte gleichzeitig das Erfordernis der Vermeidung eines Übermaßes. Zu starke Saiten strapazieren das Instrument und erzeugen weniger Schwingungen. Zu feine Saiten geben nur säuerliche Töne6 wieder; die Weichheit solcher Saiten erlaubt weder Kraft noch Geschwindigkeit beim Spiel, geschweige denn die Sanftheit als Ausdruck der ohne Zweifel wertvollsten Spielart.
Dieses Ständchen hatte meine alte Leidenschaft wiedererweckt. Ich bedrängte meinen Vater, endlich konnte ich ihn veranlassen, eine gute Pedalharfe aus Paris zu beschaffen. Ich habe hartnäckiger als je zuvor gelernt. Ich besorgte mir die Werke der besten Cembalisten. Die extreme Schwierigkeit, die ich vorfand, um sie für die Harfe einzurichten, hat mich nicht entmutigt. Diese mühevolle und kontinuierliche Arbeit beschäftigte meinen Geist, und ich wurde dabei mit allen möglichen Modulationen vertraut.
Ziemlich glücklich bin ich dann gewesen, die Freundschaft des berühmten Vagenzail [sic] zu gewinnen:7 Er gestattete mir, jeden Vormittag unter seiner Kontrolle zu studieren. Er ließ mich zwei Stunden lang spielen, stets hintereinander, und immer nach freier Eingebung. Wenn er mich, mangels neuer Ideen, bereit sah, innezuhalten, sagte er zu mir: ‚Na los, strengt eure Phantasie an, nur so kann sie fruchtbar werden‘. Manchmal unterbrach er mich, um darauf hinzuweisen, es seien einige Ideen glücklicher als andere, er wollte, dass ich diese bald zu Papier bringe, und er hat mir so die Niederschrift beigebracht. In der Folge trug er die gleichen Passagen am Cembalo vor, um mir neuerlich Freude zu bereiten und mich daran zu gewöhnen, mich selbst zu beurteilen. Er unterbrach den Unterricht oft mit diesen Worten: ‚Wie schade! Wie schade!‘ Eines Tages fragte ich ihn um eine Erklärung; und er antwortete mir: ‚Ihr tut mir leid, und ich gratuliere Euch, Euer Kopf ist bereits überladen, es verbleibt kein Platz mehr für das, was man ihm noch vermitteln möchte; Ihr werdet nie ein Theoretiker sein, Ihr werdet nie ein Komponist sein. Beschränkt Euch daher darauf, Eure Harfe gut zu kennen; ich habe Euer Talent beurteilt, Ihr werdet nicht nachahmen, Ihr werdet einen eigenen Stil haben, und Ihr werdet Erfolg haben; ich sage es Euch voraus‘. Nach seinem Rat beschloss ich, mich dem Publikum bekannt zu machen, und ich debütierte mit einem Konzert, der Erstaufführung meines Op. 4. Herr Püchel [sic],8 Musikdirektor am Hof zu Mailand, der sich damals in Wien aufgehalten hatte, übernahm die Instrumentierung.9 Er hatte nichts am Hauptteil geändert, er glaubte sogar, einen ziemlich groben, weiterhin bestehenden Fehler belassen zu müssen. Etliche Tage, nachdem ich am fürstlichen Hof in Eszterház gespielt hatte, bot mir der berühmte Haydn, der Musikdirektor, namens des Fürsten sogleich an, in dessen Musikerensemble zu verbleiben. Ich willigte freudig ein, und ich zeigte mich in der Besoldungsfrage nicht schwierig, glücklich, die Werke des Gottes der Harmonie jeden Tag hören und aufführen zu können. Ich komponierte ein neues Konzert, das erste meines Op. 6. Ich wendete mich wieder an Herrn Püchel wegen der Instrumentierung. Ich war genötigt, die ‚tutti‘ vollständig neu einzurichten, weil sie keine Beziehung zu den Motiven meines Hauptteils hatten. Der Erfolg ermutigte mich. Ich schuf das zweite Konzert dieses Op. 6, und ich habe die Instrumentierung selbst erarbeitet. Ich bat Herrn Haydn, ein Auge auf meinen Entwurf zu werfen; er fand an meinem Hauptteil nichts zu verbessern, aber er machte mich auf mehrere Fehler in der Instrumentierung aufmerksam; ich hatte einem Instrument etwas zugeschrieben, was zu einem anderen gehörte, und diese Umsetzung stiftete insgesamt viel Chaos und Verwirrung. Ebenso unterwarf ich seiner Prüfung meine sechs ersten Sonaten, und er fand keine sechs Noten zu ändern. Ich komponierte in der Folge das zweite Konzert meines Op. 4, vollständig instrumentiert, und ich habe es ausgeführt, ohne Herrn Haydn zu Rate zu ziehen. Er hörte aufmerksam zu, und er erschien über meine Kühnheit erstaunt. Ich sagte ihm, dass ich zu reisen geplant und den Moment vorausgesehen hatte, in dem ich seines Rates beraubt sein würde, und ich nun versuchen wollte, auf eigenen Beinen zu stehen.10 Ich wünsche jedoch, antwortete er mir, dass Ihr mir diese neue Tätigkeit mitteilt. Ihr habt im Solo des letzten Stücks eine Abfolge an Modulationen, die mir – für Harfen – sehr kühn erscheint. Ich hörte auf ihn, er prüfte meine Partitur; und ich schreibe das Lob, das er mir aussprach, nur seiner äußersten Nachsicht zu. Ich erhielt zwei Jahre Urlaub. Ich besuchte mehrere Höfe, und ich machte in mehreren Städten Halt. Unterwegs komponierte ich die vier Sonaten meines Op. 3, zur Begleitung durch eine Violine, zwei Hörner und einen Bass. Ich kam schließlich am 14. Februar 1777 in Paris an, ich hatte Gönner, und ich habe mich in einigen Gesellschaften zu Gehör gebracht, und ich hatte bald mehr Schüler als nötig, um all meine Zeit auszufüllen. Somit musste ich, um zu leben, eine Kunst zum Beruf machen, die ich leidenschaftlich und um ihrer selbst willen liebte. Ich musste unterrichten, wenn ich lebhaft die Notwendigkeit und das Verlangen empfand, mich wieder selbst zu unterweisen. Mir wurde vorgeworfen, nur meine Musik zu spielen; und an meiner Musik wurde getadelt, immer zu schwierig oder zu melancholisch zu sein; es bedarf nicht mehr, um einen Lehrer zu diskreditieren. Ich fühlte die Notwendigkeit, diese ersten Eindrücke zu zerstören, und ich entschied mich, bei einem Concert Spirituel11 zu spielen. In dieser Absicht komponierte ich mein fünftes Konzert in Variationen zur Melodie: O meine zarte Musette, und ich beendete dieses Konzert mit einem fröhlichen Rondo. Zuerst hatte ich die Instrumentierung selbst besorgen wollen. Allerdings verfügte ich über wenig Theorie und Praxis. Ich hätte mich für drei Monate einsperren, meine Schüler aufgeben und das Spielen vernachlässigen müssen, eine Fertigkeit, die nur mit viel Übung bewahrt werden kann. Also machte ich, was man vor mir gemacht hat, was wir noch tun und immer tun werden. Ich nahm einen Färber12, aber ich hatte ihn gut ausgewählt. Es war Herr Rigel der Ältere.13 Ich habe mein Konzert beim Concert Spirituel des Weihnachtstags 1778 aufgeführt. In der Folge habe ich immer auf Herrn Rigel für Instrumentierungen zurückgegriffen. Er kennt meine Unwissenheit besser als jeder andere, er selbst wird jedoch einräumen, dass er in den Hauptteilen für die Harfe nie Fehler gefunden hat. Er wollte mir, wie so viele andere, die Komposition beibringen; vier Tage reichten aus, um ihn von meiner absoluten Unfähigkeit zu überzeugen. Er behielt es für sich; aber ich schulde es mir selbst, ihm die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die er verdient, und um anzuerkennen, wie sehr mir sein Talent geholfen hat. Ich bekunde daher, dass ich die Herren Püchel, Haydn und Rigel den Älteren als Mitarbeiter hatte, dass ich mich in Deutschland geschult, und meinen Geschmack in Frankreich geformt habe.
Mir wird vorgeworfen, das Spielen zu vernachlässigen. Es ist wahr, dass ich es fast völlig aufgegeben habe. Falls das ein Fehler ist, so bekenne ich, dass es für mich zur neuen Freude wird. Ich bin zu anspruchsvoll und vielleicht – mir selbst gegenüber – zu kritisch geworden, ich sah mich durch meine Frau übertroffen: die Natur hat sie für die Harfe mit einer einzigartigen Begabung ausgestattet. Sie vereint Kraft mit größter Geläufigkeit; noch wertvoller ist, sie legt in ihr Spiel diesen Ausdruck und dieses Empfinden, die aus der Musik eine wahrhafte Sprache machen. Ich überlasse es ihr, meine Ideen zum Ausdruck zu bringen. Beim Spielen war es für mich unmöglich, die Wirkung zu beurteilen, wenn ich zuhöre, entgeht mir nichts. So gewinne ich für die Komposition, was ich aufseiten des Spielens einbüße. Umso nützlicher bin ich für Amateure. Noch nützlicher bin ich für meine Schüler; denn indem ich meine Frau gleiche Abschnitte in zwanzig Varianten wiederholen ließ, weiß ich besser als jeder andere, wozu Finger fähig sind, und was das Instrument erlaubt.
Man kreidet mir noch an, nach Schwierigkeiten zu suchen; das ist falsch; mein Bestreben ist nur, die ganze Spannweite und alle Ausdrucksmittel der Harfe bekannt zu machen. Dieses Instrument hat seine Mängel, doch – gut verstanden – steht es keinem anderen nach. Es fehlt ihm vielleicht nur ein weiteres Dutzend an fähigen Komponisten. Ich habe mich lediglich um die Erweiterung der Grenzen, die ihm gesetzt zu sein schienen, und darum bemüht, ihm eine größere Ausdrucksfähigkeit zu verschaffen.“
2. Quelle
2.1 Chronologie von Ereignissen
Jan Křtitel berichtet, er sei mit fünfundzwanzig Jahren, somit irgendwann ab August 1772, nach Prag zurückgekehrt. Als nunmehriger Mitarbeiter im Unternehmen seines Vaters habe ein zufälliges musikalisches Erlebnis seine alte Leidenschaft für die Harfe wiedererweckt. Sodann habe ihm sein Vater – auf Grund längeren Drängens – eine Pedalharfe aus Paris beschafft. In der Folge habe er sich durch „mühevolle und kontinuierliche Arbeit“ autodidaktisch als Harfenist fortgebildet.
Diese Geschehnisse müssen einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen haben, die sich nicht erst frühestens ab August 1772 zugetragen haben können, war doch Jan Křtitel allem Anschein nach schon Anfang 1772 in Wien (unten A.III.2). Die Chronologie der Ereignisse muss daher eine andere gewesen sein:
Jan Křtitel hatte das erste Mal wohl von 1767 bis 1769 im Prager Geschäft seines Vaters gearbeitet, danach hatte er sich von 1769 bis 1770 in Frankfurt am Main aufgehalten und war 1771 nach Prag zurückgekehrt, ehe er 1772 nach Wien übersiedelte.14 Dessen autodidaktische Fortbildung als Harfenist nach seiner Heimkehr ist somit in den Kontext der Lebensgeschichte zeitlich nicht so einzuordnen, wie es die autobiografische Erzählung referiert und nahelegt (unten A.III.1. und 2.).
2.2 Authentizität
Die autobiografische Überlieferung ist in dem 1800 veröffentlichten Lehrbuch Jean-Baptiste Krumpholtz‘ für das Harfenspiel in einer Bearbeitung durch seinen Schüler Jean Marie Plane15 enthalten.16 Dort betont der Bearbeiter in einleitenden Ausführungen, Krumpholtz habe diesen Text selbst geschrieben.17 Es mangelt allerdings an einer Mitteilung, wo diese – nunmehr offenkundig seit langem verschollene – Skizze seinerzeit aufgefunden wurde und was mit ihr geschah.
Die Erzählung wirkt ehrlich, sachlich und unprätentiös, ohne einen Hang zur Selbstinszenierung im Interesse einer Verehrung durch die Nachwelt. Auffallend ist aber das Aussparen der Kindheit und der frühen Jugend, so etwa das Fehlen von Hinweisen auf eine absolvierte, abgebrochene oder vollständig unterbliebene geregelte Schulbildung, die rudimentäre Beschreibung einzelner Lebensumstände im jugendlichen Alter, eine gewisse Unzuverlässigkeit in der Chronologie von Ereignissen, die Spärlichkeit an Daten, die verlässliche zeitliche Einordnungen ermöglichen, der weitgehende Mangel an Tatsachen über das Pariser Lebensumfeld und die – abgesehen vom Künstlerischen – dominierenden persönlichen Lebensumstände, so etwa das Fehlen von Angaben über Krumpholtz‘ Ehen und die daraus entsprossenen Kinder. Insoweit wird lediglich auf die außergewöhnliche Begabung von Anne-Marie, der zweiten Ehefrau, als Harfenistin Bezug genommen. Das findet allerdings eine plausible Begründung im erkennbaren Zweck der autobiografischen Überlieferung, Krumpholtz‘ eigene Entwicklung als Komponist, Harfenist und Harfenpädagoge, schließlich unter dem starken und für sein künstlerisches Schaffen fruchtbaren Einfluss seiner zweiten Ehefrau, zu schildern.
Ein Indiz für die Authentizität des erörterten Textes findet sich im Journal de Paris, Ausgabe Dienstag 10.11.1789, somit etwa drei Monate vor Krumpholtz‘ Tod. Dort werden die Noten der Sonaten seines Op. 16 zum Kauf angeboten. Im Übrigen wird ergänzt:18 „… An den Beginn dieses neuen Werks setzte Herr Krumpholtz die Erzählung über einen Teil seines Lebens und die Schwierigkeiten, die er zu überwinden hatte, um auf der Harfe den Grad an Dominanz zu erreichen, den man bei ihm kennt, und der ihm zu Recht einen hervorragenden Ruf eingebracht hat. In dieser mit Interesse zu lesenden Mitteilung, die ein eher seltenes Beispiel an Bescheidenheit bietet, fand der Verfasser Freude an der Nennung der Künstler, die ihn mit ihrem Rat oder ihrer Arbeit unterstützt haben.“
Diese Wendungen sprechen wohl dafür, dass sie zumindest einen Ausschnitt jener Niederschrift betreffen, die J. M. Plane als Quelle zur Verfügung stand.
Eine tragfähige Stütze für die Echtheit der erörterten Quelle ist ferner, dass Dokumente die Richtigkeit zumindest einiger der geschilderten Lebensumstände untermauern. Darauf wird zurückzukommen sein.
F.J. Fétis erwähnt zwar am Ende seines biografischen Eintrags zu „Krumpholz (Jean-Baptiste)“, dass unter dessen Namen – nicht von ihm herrührende – „Principes pour la harpe“ veröffentlicht worden seien, und insofern ein kommerzieller Betrug vorliege.19 Dort mangelt es aber nicht nur an der Nennung eines Belegs, sondern Fétis wird ohnehin nicht die Bearbeitung von J. M. Plane im Auge gehabt haben, fehlt doch in der vom gleichen Verfasser wesentlich später veröffentlichten Kurzbiografie zu J. M. Plane eine Erwähnung der hier maßgebenden Bearbeitung der Krumpholtz’schen Harfenschule. Demnach gibt es dort auch keinen Hinweis auf eine Fälschung.20
Alles in allem besteht somit kein Grund, die Authentizität der autobiografischen Überlieferung in Zweifel zu ziehen.
II. J. M. Plane über seinen Lehrer
1. Künstlerische Bedeutung
„‘Das Leben eines Schriftstellers liegt in seinen Schriften‘ sagte Voltaire; dasselbe könnte man über einen kundigen Komponisten sagen. Jede seiner Schöpfungen verfügt über einen Charakter, ein Erscheinungsbild als Abbild seiner Seele.
So sind die Werke des berühmten Krumpholtz, der in ganz Europa ob seiner Begabung und seines Unglücks bekannt ist. Manchmal regt er Sie mit einer zarten und melancholischen Weise zu einer süßen Träumerei an; manchmal vermitteln Ihnen seine Akkorde – eine düsterere Schattierung annehmend – unfreiwillige Traurigkeit. Gelegentlich führt Sie seine naive und pastorale Stimmung auf einen Spaziergang inmitten wohltuender Natur, und wiederbelebt in Ihnen die Erinnerung an ländliche Freuden. Bald stört der Sturm der Leidenschaften diese glückliche Ruhe, und ihre Seele teilt dann die Unruhe und Erregung seiner.
Allen Werken Krumpholtz’ ist eine solche Wahrhaftigkeit eigen, dass sie insbesondere eine Erinnerung bei jenen hervorrufen, die ihn zu den Zeiten ihrer Komposition kannten. Hier sind einige Umstände aus seinem Leben, deren Details umso wertvoller sind, als sie von ihm selbst geschrieben wurden. (autobiografische Überlieferung)
Das sind alle Einzelheiten, die uns Krumpholtz über seine Ausbildung hinterließ, und ich habe sie getreulich berichtet, weil sie – notwendigerweise – jeden interessieren müssen, dem die Harfe ein Anliegen ist, und sie haben jedenfalls einen direkten Einfluss auf das Erlernen der Beherrschung des Instruments. Jede Zeile spiegelt die bescheidene Einstellung, die Künstlern immer als Modell für einen unverfälschten Hinweis auf das Genie dienen solle.“
2. Schicksal
„Mir bleibt, ein Wort über sein letztendliches Unglück zu ergänzen, dessen Erinnerung in meinen Gedanken immer gegenwärtig ist. Einige Jahre waren vergangen, während welcher Krumpholtz am Ende – als Opfer starker Eifersucht, die ihm keine Ruhe gönnte – von Liebe zur Hingabe wechselte, und es war die Religion, in der er nach Trost suchte, den er nicht mehr länger in weltlichen Angelegenheiten finden konnte. Das Unglück, das ihn so lange verfolgt hatte, veranlasste ihn, einen ignoranten und fanatischen Priester als Ratgeber zu wählen, dessen unheilvoller Rat nur dazu diente, seine Zweifel zu verschärfen, statt seinem verstörten Gewissen Mut zu machen.
Wir erreichten gerade die denkwürdige Zeit des Beginns der Französischen Revolution. Die ersten Ereignisse, die vor seinen Augen stattgefunden hatten, verwirrten erfolgreich seinen armen Geist. Zuletzt, als er nicht mehr in der Lage war, die Bürde der Probleme seines Lebens zu ertragen, setzte er diesem ein frühes Ende.“
3. Werdegang der Krumpholtz’schen Harfenschule
Keinen Bedenken begegnet überdies die Erzählung von J. M. Plane über das Entstehen des Lehrbuchs am Ende seiner Einleitung, nämlich:
„Einige Monate vor seinem Tod hatte Krumpholtz – trotz seines Kummers – die Güte, mich regelmäßig bei einer deutschen Dame (Frau Baroness Dis…), welche die Harfe sehr mochte, zu unterrichten, und wir verbrachten oft einen Teil unserer Abende bei ihr. Da er dieser Dame sehr zugetan war, hatte er seine Prinzipien mit einer Vielzahl an Merkmalen, Übungen und Präludien für sie niedergeschrieben. … und ich verdanke ihr die Materialien, deren ich mich bediente, um das von mir zu Tage geförderte Werk zu bearbeiten. Diese Prinzipien waren auf fliegenden Blättern in deutscher Sprache geschrieben worden; ich fand unzählige Wiederholungen, Details, die nur für sie verfasst waren, und viele Sachen zeigten sich in einer Unordnung, die in einem Werk oder eher in Notizen herrschen musste, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. Trotz dieser – durch ein wenig Arbeit zu beseitigenden – Flüchtigkeiten erschien mir das Ganze ausgezeichnet; ich erkannte die Nützlichkeit dieser Lektionen einer berühmten Schule, und ich fing an, sie zu übersetzen, indem ich allen zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen treu folgte; ich präsentierte sie in neuer Reihenfolge. Besonders konzentrierte ich mich auf die Vermeidung von Wiederholungen und darauf, alle Prinzipien mit Klarheit und Genauigkeit darzulegen, mit einem Wort, ich verfasste ein Lehrbuch.
Zahlreiche Beschäftigungen haben den Zeitpunkt des Erscheinens verzögert. Schließlich erfülle ich diese Pflicht im Gedenken an einen großen Künstler mit der doppelten Genugtuung, nützlich für die Förderung der Harfe zu sein und mich als Mitarbeiter meines Lehrers geehrt zu fühlen.“ J. M. Plane war zur Zeit des Ablebens von Krumpholtz (1790) 16 Jahre alt. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass ab diesem Zeitpunkt bis zur Veröffentlichung des Lehrbuchs etwas mehr als 10 Jahre verstrichen, mussten doch für den Bearbeiter zunächst der Abschluss der eigenen Schul- und Berufsausbildung, die Gewinnung der notwendigen musikalischen Erfahrung und der Aufbau einer gesicherten wirtschaftlichen Existenz vorrangig gewesen sein.
III. Biografische Erzählung
1. Jugend, Ausbildung und frühe Wanderjahre
Jan Křtitel Krumpholtz21 wurde am 5.8.1747 in Prag geboren.22 Unrichtig sind daher andere Geburtsdaten, die im Schrifttum tradiert wurden und werden, nämlich der 3.5.1742,23 der 8.5.1742,24 (um) 174525 oder 1746.26 Ebenso unzutreffend ist die Nennung von Zlonice, Budenice oder Chržín als Geburtsort.27 Selbst im neueren wissenschaftlichen Schrifttum finden sich immer noch unrichtige Angaben zu Datum und Ort der Geburt.28
Über Krumpholtz‘ Jugend ist kaum mehr als das bekannt, was die autobiografische Überlieferung erzählt. Eine systematische Schulausbildung wird Jan Křtitel nicht zuteilgeworden sein. Er ist als Leibeigener in einer Zeit aufgewachsen, in der es in seinem Lebensumfeld noch keine Schulpflicht gab. Der wahrscheinliche Mangel einer soliden allgemeinen Schulbildung wird auch dessen künstlerische Entwicklung anfänglich erschwert haben.29 Seine Liebe für das Harfenspiel und der Wunsch, auch als Komponist Bedeutung zu erlangen, waren aber immer starke Triebfedern seines Strebens. Das Spiel der Mutter wird der Keim seiner Neigung für die Harfe und deren Klänge gewesen sein. Die Mutter wird den Knaben ferner bereits seit früher Kindheit durch praktische Unterweisungen mit dem Instrument einigermaßen vertraut gemacht haben. Im älteren Schrifttum des 20. Jahrhunderts wurde dagegen vereinzelt unrichtig behauptet, der Vater J. Haydns habe den ungarischen Musiker „Johan Baptist Krumpholz“ an der Harfe unterrichtet.30
Wegen seines vielseitigen musikalischen Talents wurde Jan Křtitel 1758 als Stipendiat des Grafen Kinský kurze Zeit nach Wien geschickt, um dort das Hornspiel zu erlernen.31 Einer Vertiefung dieser schon im Kindesalter begonnenen Ausbildung diente später jener Unterricht, den ihm – nach vorangegangenen praktischen Erfahrungen im Hornspiel – Jean-Joseph Rodolphe erteilt hatte. Die während der Begleitung seines Vaters als Berufsmusiker nach Erfordernissen des Alltags aufgetretene Notwendigkeit, das Spiel mehrerer Instrumente zu erlernen, um an solchen in Musikkapellen eingesetzt werden zu können, verschaffte ihm eine gediegene musikalische Grundausbildung. Dem Hang zur Harfe als Instrument der persönlichen Vorliebe konnte er dabei wohl nur in seiner Freizeit frönen, sofern ein Instrument zur Hand war. Ein Unterricht in Komposition war zunächst überhaupt außer Reichweite. Als vermutlich Christian Hochbrucker32 den Knaben im Alter von vierzehn Jahren 1761 oder 1762 in Paris „ein Dutzend Mal“ empfangen hatte, um sich im Zuge didaktischer Übungen einige seiner Harfensonaten vorspielen zu lassen, musste Jan Křtitel auf Grund seines Talents bereits einen hohen Grad an Virtuosität als Autodidakt erreicht haben, erteilte ihm doch Hochbrucker, der auch ein angesehener Harfenvirtuose war, letztlich nur Ratschläge, die den künstlerischen Ausdruck seines Vortrags betrafen.
Der Kompositionsunterricht auf dem Boden Rameau’scher Musiktheorie, den er noch als Jugendlicher – nun wahrscheinlich nicht mehr seinen Vater begleitend – erhalten hatte, wird zumindest den Nutzen gehabt haben, ihm in Ansätzen kompositorische Strukturen einer bestimmten Schule zu verdeutlichen. In der Folge konnte er seinen Lebensunterhalt, bereits als Minderjähriger auf eigenen Beinen stehend, selbst bestreiten, und zwar dank der bisher erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit mehreren Musikinstrumenten, aber mutmaßlich vor allem durch das Hornspiel. Er war jetzt selbst einige Jahre ein – allerdings die Harfe seit Längerem nicht mehr spielender – reisender Berufsmusiker.
Jan Křtitel kehrte um 1767 heim.33 Sein Vater Jan hatte sich bereits 1763 wieder in Prag niedergelassen. Dieser war seit 1.6.1745 mit Eleonora, geb. am 2.5.1724, verheiratet.34 Sie ist die Mutter von Jan Křtitel und vier weiteren, dieser Ehe entsprossenen Kindern. Jan Křtitel hatte einen Bruder und drei Schwestern.35
Nach Eleonoras Tod36 heiratete Vater Jan am 23.1.1764 die reiche Witwe Rozálie Šebková in Prag. Danach eröffnete er in der Prager Altstadt ein Geschäft im Haus "Zum Goldenen Strauß". Dort war er vor allem Händler von Musikinstrumenten.37 Jan Křtitel, der sich insbesondere bei den Blech- und Saiteninstrumenten gut auskannte, arbeitete nun wohl bis 1769 im Geschäft des Vaters.38 Währenddessen wurde seine Neigung für die Harfe als Instrument seiner Vorliebe durch ein persönliches Erlebnis mit einem Harfe spielenden Kind neu entfacht. Er machte sich jetzt auch schon erste Gedanken über Möglichkeiten, die Spannweite des musikalischen Ausdrucks einer Harfe zu erweitern. Sein Vater beschaffte ihm eine Pedalharfe39 auf der Höhe des damaligen Entwicklungsstandes, und er nahm das Harfenspiel mit großer Intensität wieder auf. Im Zuge dessen richtete er anspruchsvolle Stücke aus der Literatur für Cembalo in kompositorischer Bearbeitung für die Harfe ein. So konnte er – vor allem vermöge seiner natürlichen Begabung – in kurzer Zeit wieder einen hohen Standard an Virtuosität erreichen.
Danach ließ er sich 1769 in Frankfurt am Main als Harfenlehrer nieder.40 Seine Unterrichtstätigkeit wurde etwa am 13.10.1769 folgendermaßen annonciert:41 „[13. October.] Der Harfenist Krumholz offerirt Lectionen auf seinem Instrument. Es hoffet derselbe um so ehender geneigten Zuspruch zu haben, da er sich keiner andern Musicalien bedienet als derer, die wesentlich auf das Clavier gesetzt sind, ohne Veränderung derselben, sie mögen gleichwohl Sonaten, Concerten und drgl. seyn; welches allerdings ein grosser Vorschub für Liebhaber der Music ist.‘“
Diese Erläuterungen belegen, dass sich Jan Křtitel – wie in der autobiografischen Überlieferung beschrieben – mit der Einrichtung von Klaviermusik für die Harfe beschäftigte. Die Wendung „…, die wesentlich auf das Clavier gesetzt sind, ohne Veränderung derselben, …“ verdeutlicht augenscheinlich, dass sich allfällige Bearbeitungen darin erschöpften, Klavierstücke mit Harfen nach dem damaligen Entwicklungsstand ihrer Mechanik spielbar zu machen.
In Frankfurt am Main trat Krumpholtz am 12.1.1770 überdies in einem öffentlichen Konzert als Harfenist auf. Die Bekanntmachung für diese Darbietung lautete:42 „[12. Januar.] Concert des Herrn Krumholtz, Virtuosen auf der Pedal-Harfe. Im Scharfschen Saal; Billet 18 Batzen.“
Ein Jahr darauf, somit 1771, übersiedelte Jan Křtitel wieder nach Prag.43 Dort auf Dauer im geschäftlichen Unternehmen seines Vaters als Verkäufer zu arbeiten, konnte natürlich einen Mann seiner musikalischen Begabung nicht befriedigen. Sein Ziel war mehr denn je eine künstlerische Karriere als Komponist, Harfensolist und Harfenpädagoge.
2. Wien
In selbstbewusster, aber realer Einschätzung seiner erlangten, nunmehr wohl schon verfeinerten Spieltechnik, übersiedelte Jan Křtitel bald – allem Anschein nach bereits Anfang 1772 – nach Wien, um in einem der europäischen Zentren der Tonkunst dieser Zeit besonders als Solist und Komponist voranzukommen. Dort kümmerte sich um ihn als Lehrer während eines längeren kontinuierlichen Zeitraums Georg Christoph Wagenseil, ein bedeutender Komponist, Solist und Pädagoge des 18. Jahrhunderts, der am Wiener Hof gewirkt hatte. Dieser Unterricht war intensiv und nachhaltig. Gefeilt wurde am solistischen Ausdruck und an der Kompositionstechnik, im Besonderen an der Notation. Zuvor hatte sich Krumpholtz schon an einigen kleineren Kompositionen versucht. Nun schuf er ein von Václav (Wenzel) Pichl, dem böhmischen Komponisten und Geiger sowie langjährigen Freund der Familie Krumpholtz,44 instrumentiertes Harfenkonzert, mit dessen Uraufführung er in Wien als Harfenist in einem öffentlichen Konzert – seinen autobiografischen Erinnerungen entsprechend – debütierte. Diese Präsentation hatte am 4. Oktober („Weinmonat“) 1772, wahrscheinlich im Theater „nächst der Burg“, zwischen zwei Theaterstücken stattgefunden. Darüber wurde in einem Presseorgan am 17. Oktober („Weinmonat“) 1772 so berichtet:45 „…,zwischen beyden Stücken ließ sich Hr. Krumbholz aus Böheim46 auf einer auf besondere Art in Paris verfertigten Harfe hören in einem Sonete, mit Violin, Baß, und Horn begleitet.“
Bei der „auf besondere Art in Paris“ hergestellten Harfe – wahrscheinlich eine „Harpe Organisée“47 – wird es sich um jenes Instrument gehandelt haben, das der Vater des Solisten auf dessen Drängen einige Jahre vorher beschafft hatte.
Wenig später am 30. Oktober („Weinmonat“) 1772 war Krumpholtz in Wien im Rahmen der Musikalischen Akademie ein weiteres Mal als Harfenist zu hören. Über diesen Auftritt fand sich am 7. November („Wintermonat“) 1772 folgende Pressenotiz:48
„Die Musik fieng mit einer großen Symphonie von Hrn. Ditters an. … Hr. Pichl spielte ein neues Konzert auf der Geige, so wie Hr. Krumpholz ebenfalls eines von neuer Erfindung auf der großen Harfe. …“
Das gespielte Werk wird das zuvor im selben Monat uraufgeführte Harfenkonzert gewesen sein. Krumpholtz wird überdies das gleiche Instrument wie am 4.10.1772 verwendet haben. Orchestermusiker für die Besetzung der weiteren Instrumente standen offenkundig zur Verfügung, weil zum Konzertprogramm auch Symphonien zählten.
Am Mittwoch, den 4., und am Mittwoch, den 11. November („Wintermonat“) 1772 annoncierte Krumpholtz die Erteilung von Harfenunterricht:49 „Nachricht.
Herr Krumholtz, welcher schon die Ehre gehabt in der Akademie sich zu produciren, auf der neu erfundenen Pettalharpfen, thut allen hochgnädigsten Liebhabern zu wissen, daß diejenige, welche diese Pettal oder allgemeine Harpfen möchten lernen, seine Wohnung finden, im genannten Haus beym verlohrnen Sohn auf dem Plätzel bey Maria Trost.“
Damals wohnte er also am Platz um die katholische Kirche St. Ulrich (Maria Trost), Sankt-Ulrichs-Platz 3, im 7. Wiener Gemeindebezirk (Neubau). In seiner „Nachricht“ nahm er manifest Bezug auf seinen Auftritt am 30.10.1772 in der Musikalischen Akademie und spricht von „der neu erfundenen Pettalharpfen“, somit wohl von einer „Harpe Organisée“. Die Annonce belegt ferner, dass er seinen Lebensunterhalt auch in Wien zumindest teilweise durch die Erteilung von Harfenunterricht finanzierte. Er verblieb schließlich bis zu seinem nachfolgenden Engagement in Eszterház in Wien.
2.1 Bruder Václav (Wenzel) Krumpholtz
Eine Enkelin Krumpholtz‘ berichtete in einer von ihr um die Mitte des 19. Jahrhunderts handschriftlich dokumentierten autobiografischen Erzählung ihrer Mutter Fanny Pittar geb. Krumpholtz, ihr Großvater sei ein großer Freund „Beethovens“ gewesen.50 Nun, Ludwig van Beethoven wurde 1770 geboren. Jan Křtitel Krumpholtz ist 1790 verstorben. Deren Lebenswege können sich – nach bekannten biografischen Daten – weder in Wien noch in Paris gekreuzt haben. Dagegen war der Bruder von Jan Křtitel, nämlich Václav (Wenzel) Krumpholtz (im Schrifttum auch Krumpholz oder Krumholz) (1750 – 1817), der 1795 nach Wien gekommen und ab 1796 als Geiger Mitglied des Opernorchesters war, ein enger Freund Beethovens. Václav (Wenzel) Krumpholtz soll im Übrigen einer der Ersten gewesen sein, der Beethovens Größe als Komponist erkannt hatte,51 wobei ihm Beethoven auch Einsicht in Kompositionsentwürfe gewährt haben soll.52 Er erlag am 2.5.1817 einem Schlaganfall während eines Spaziergangs in Wien. Dieses Ereignis veranlasste Beethoven, einen seinem verstorbenen Freund gewidmeten Gesang für drei Männerstimmen zu komponieren.53
Fanny Pittar geb. Krumpholtz wird daher in Wahrheit erzählt haben, ihr Onkel Václav (Wenzel) sei in Wien ein großer Freund Beethovens gewesen. Eine Verwechslung von Václav (Wenzel) mit Jan Křtitel (Jean-Baptiste) Krumpholtz als Freund Beethovens findet sich allerdings auch im älteren wissenschaftlichen Schrifttum.54 Nicht zutreffend ist des Weiteren die in der Literatur gelegentlich tradierte Ansicht, Václav (Wenzel) Krumpholtz habe im fürstlichen Orchester in Eszterház „die erste Violine“ gespielt.55
3. Eszterház
J. Haydn, damals Musikdirektor am Hof des Fürsten Nikolaus I. Joseph Eszterházy de Galantha, wird Krumpholtz als Harfenisten bei einem seiner öffentlichen Wiener Auftritte 1772, dabei jeweils eine eigene Komposition spielend, gehört haben, und er wird von dessen Entwicklungsfähigkeit als Tonschöpfer und dem herausragenden solistischen Können überzeugt gewesen sein; oder J. Haydn wurde nach diesen Auftritten von kundigen anderen über die kompositorische und solistische Begabung Krumpholtz‘ unterrichtet. Jedenfalls wurde dieser von J. Haydn eingeladen, in Eszterház, der Sommerresidenz jenes Fürsten im heutigen ungarischen Fertöd,56 vorzuspielen. Krumpholtz hatte dieses Angebot angenommen und er soll sein erstes unter Mitwirkung von Václav (Wenzel) Pichl in Wien komponiertes Harfenkonzert gespielt haben.57 Wenige Tage nach seiner Darbietung erhielt er – beginnend mit 1.8.177358 – ein Engagement als Harfenist im fürstlichen Orchester. Als solcher scheint ab diesem Zeitpunkt „Johann Baptist Krumpholtz“ in der Liste der Instrumentalisten der fürstlichen Kammermusik auf.59 Dieses Ensemble war 1769 nach Eszterház verlegt worden.60 Seither war es vor allem dort tätig. Die musikalische Saison in Eszterház erstreckte sich vom Frühjahr bis in den Herbst jedes Jahres. Das Engagement Krumpholtz‘ erfolgte somit weniger als ein Jahr nach dessen Wiener Auftritten im Herbst 1772. Mit dem Harfenisten, der sich in der Besoldungsfrage, wie in der autobiografischen Erzählung erwähnt, als „nicht schwierig“ erwies, war ein – später verlängerter – Jahresvertrag geschlossen worden. Kaum ein Jahr später wurde ihm am 18.7.1774 eine Gehaltszulage gewährt.61
Das war eine Anerkennung für seine Leistungen als Musiker. Schließlich verweilte Krumpholtz bis Ende Februar 1776 in Eszterház.62 Am 1.1.1776, somit kurz vor dem Ausscheiden des Harfenisten, war die fürstliche Kammermusik unter Leitung des „Kapellmeisters“ J. Haydn mit insgesamt achtundzwanzig Instrumentalisten besetzt.63
Krumpholtz war – formell betrachtet – nicht „Schüler“ J. Haydns. Die Rede ist vom „… einstigen Esterhazyschen Harfenisten Joh. Baptist Krumpholz …“64 Mit J. Haydn zu arbeiten, bedeutete aber, von ihm zu lernen, wollte doch Krumpholtz in Eszterház, wie die autobiografische Überlieferung nahelegt, seine Kompositionstechnik verbessern, vornehmlich um Orchestrierungen gewachsen zu sein, und im Zuge dessen seine Kenntnisse in puncto Kompositionsstil und Formenlehre erweitern. Dabei schuf er einige Werke für die Harfe und er hatte insofern vorerst J. Haydn zu Rate gezogen, um dessen etwaigen Empfehlungen nach Durchsicht der Kompositionen zu folgen. Mit fühlbarer Befriedigung über erzielte Fortschritte betonte Krumpholtz schließlich, das zweite Konzert seines Op. 4 vollständig selbst – somit ohne die Mithilfe J. Haydns oder eines anderen – instrumentiert zu haben.
Dokumentiert ist eine Abrechnung J. Haydns (mutmaßlich) über Aufwendungen für die Aufführung seiner Buffooper „L’infedeltà delusa“ und seiner Marionettenoper „Philemon und Baucis“. Diese Werke wurden anlässlich des Besuchs von Kaiserin Maria Theresia in Eszterház vom 1. bis 2.9.1773 dargeboten.65 In dieser Abrechnung ist das Honorar für den „Harpfenisten Krumpholtz“ inklusive einer Sonderzuwendung („Discretion 4 Cremnitzer Ducaten“)66 mit insgesamt 17 Gulden, 12 Kreuzern ausgewiesen.67
Krumpholtz war jedoch bei der Aufführung jener Opern – mangels einer Harfe in den Instrumentierungen – nicht als Harfenist, sondern vermöge seiner Vielseitigkeit als Musiker wahrscheinlich als Aushilfe an einem anderen Instrument eingesetzt.
Die Solo- und die Kammermusik als Harfenist sowie Einsätze im Opernorchester meist wohl an einem anderen Instrument als der Harfe werden die Schwerpunkte des musikalischen Wirkens Krumpholtz‘ in Eszterház gewesen sein.68 Dabei wird er auch jene Werke – Konzerte und Sonaten – als Solist gespielt haben, die er vor und während seines Aufenthalts in Eszterház für die Harfe komponiert hatte.
4. Konzerttournee
Gegen Ende seines Aufenthalts in Eszterház fühlte sich Krumpholtz auf Grund seiner solistischen Fähigkeiten und kompositorischen Kenntnisse gerüstet, als Solist, Komponist und Harfenpädagoge künstlerisch und wirtschaftlich eigenen Vorstellungen zu folgen. Deshalb begab er sich Anfang März 1776 auf eine Konzerttournee. Nach dem Bericht in der autobiografischen Überlieferung besuchte er mehrere Höfe, machte in mehreren Städten Halt und komponierte unterwegs einige Harfensonaten. Dabei dürfte ihn sein Weg auf dem Weg nach Frankreich über Dresden, Leipzig, Gotha, Frankfurt am Main und Koblenz nach Metz geführt haben.69 Belegt sind freilich nur Auftritte in Leipzig und in Frankfurt am Main.70
Am 17.6.1776 war Krumpholtz in Leipzig – auf einer „Harpe Organisée“ spielend – zu hören.71 In Frankfurt am Main spielte er als Harfenist in einigen öffentlichen Konzerten, das letzte Mal am 22.9.1776. Dieser Auftritt wurde – unter Hinweis auf vorangegangene Darbietungen – so angekündigt:72 „[22. September.] Künftigen Sonntag wird ein grosses vollstimmiges Concert im Junghof in dem neu erbauten Commödien-Haus gehalten, wobey sich die Mademoiselle Tauber, Mr. Janitsch, Mr. Krumpholz und Mr. Reicha werden hören lassen, welche sich zwar schon den ersten Mess-Sonntag im rothen Hauss haben produciret, und den zweyten im Junghof in dem neuerbauten Commödien-Saal, weilen der Ort sehr favorabel für die Music ist, so haben sich dieselben entschlossen, den künftigen Sonntag, nemlich den 22. September nochmahls mit einem Concert aufzutreten. Der Anfang ist um 6 Uhr, die Plätze werden so wie in der Commödien bezahlt.“
5. Metz
Der autobiografischen Überlieferung ist nichts zu einem längeren Aufenthalt Krumpholtz‘ in Metz 1776/1777 zu entnehmen. Dieser Zwischenstopp dauerte jedoch weniger als fünf Monate, stellt man den Zeitraum in Rechnung, der zwischen seinem letzten Auftritt am 22.9.1776 in Frankfurt am Main, einem möglichen Auftritt in Koblenz als weiterer Station der Tournee und seiner späteren Ankunft in Paris am 14.2.1777 verstrichen war. Die Metzer Zeit sollte aber zu einem Markstein in seiner Lebensgeschichte werden.
In Metz besuchte Krumpholtz regelmäßig die Werkstatt Christian Stecklers, der am 7.8.1746 in Haute-Vigneulles geboren worden war und am 12.11.1765 Marie Bâillon geheiratet hatte. Deren Tochter Anne-Marie wurde am 10.10.1766 geboren. Die Familie übersiedelte 1770 von Haute-Vigneulles nach Metz. Bis 1782 hatten die Ehegatten insgesamt sieben Kinder, fünf Söhne und zwei Töchter. In Metz entwickelte sich Christian Steckler vom Tischler zum Instrumentenbauer. Wahrscheinlich hatte er diesen Beruf bei Simon Gilbert, einem angesehenen Instrumentenmacher aus der Fournirue, erlernt. Steckler baute dann überwiegend Cembali. 1813 trat er in den Ruhestand und verstarb am 14.2.1838 in Paris; seine Frau war zuvor am 6.9.1827 verstorben.73
Krumpholtz wird sich bei Christian Steckler mit dem Handwerk des Baus von Saiteninstrumenten – so insbesondere auch mit dem Harfenbau74 – vertraut gemacht haben.75 Er unterrichtete ferner sogleich dessen Tochter Anne-Marie, die eine einzigartige Begabung für das Harfenspiel zeigte.76 Außerdem lernte er seine spätere erste Ehefrau Marguerite, eine Tochter des Metzer Instrumentenbauers Simon Gilbert, kennen.77 Schon dessen Vater hatte Instrumente erzeugt. Erzeugnisse dieser Manufaktur waren mit dem Aufdruck „Simon-Gilbert, luthier, musicien de la Cathédrale, à Metz“ etikettiert.78
Es mangelt an aussagekräftigen Quellen zu Marguerite Gilbert und deren Verehelichung. Krumpholtz könnte sie aber in der ersten Hälfte des Jahres 1777 – vielleicht noch während seines Aufenthalts in Metz – geheiratet haben. Allenfalls fand die Verehelichung aber doch erst am 6.12.1777 statt.79
6. Künstlerische Entfaltung in Paris
Das Zeitalter, währenddessen Krumpholtz am 14.2.1777 wahrscheinlich mit seiner Frau oder Braut – und begleitet von seiner Schülerin Anne-Marie Steckler – in Paris angekommen war, erwies sich als vorteilhaft für seine Bestrebungen, dort als Harfenist Fuß zu fassen und überdies die künstlerische Entwicklung seiner hochbegabten Schülerin zu fördern. Paris war damals das Zentrum der „Harfenwelt“, die Harfe das Instrument en vogue. Viele Komponisten, Solisten, Pädagogen und Instrumentenbauer mit der Harfe als Mittelpunkt ihres Schaffens wirkten damals in Paris.80
Krumpholtz hatte Gönner. Zunächst präsentierte er sein Können als Harfenist in privaten Gesellschaftskreisen, bevorzugt mit eigenen Kompositionen, die schlussendlich manche für zu schwierig oder zu melancholisch hielten. Alsbald begann er auch als Harfenlehrer zu agieren. Wenig später hatte er jene Anzahl an Schülern, die er unterrichten konnte und wollte. Insofern wurde hervorgehoben, seine Schüler hätten durch ihre Talente jene Begeisterung gefördert, die er durch sein Harfenspiel selbst erregt und die sich in ganz Europa verbreitet habe.81 Krumpoltz‘ Fähigkeiten wirkten somit als Multiplikator der damals für Harfenmusik vor allem in Paris, aber wohl auch anderswo in Frankreich und in manch anderem Land Europas bestehenden Neigung.
Anders war hingegen damals die Lage für Harfenisten als Berufsmusiker in Deutschland. So wurde in einem musikalischen Almanach des Jahres 1782 berichtet:82 „11) Harfe.
Dies Instrument ist, als Solo- oder Concert-Instrument betrachtet, sehr abgekommen. Nur selten findet man noch jemand, der es zu einem Concertinstrument erhebt. In großen Kapellen wird es zur Verstärkung der Bässe, neben die Laute und Theorbe gestellt, übrigens aber nicht mehr viel darnach gefragt. Als starker Harfenist ist gegenwärtig nur ein gebohrner Deutscher, Namens Meyer in London bekannt.“
Die Aussage, es sei nur ein Deutscher als „starker Harfenist“ bekannt, beruhte auf einem Informationsmangel, wirkten doch seinerzeit etwa die namhaften deutschen Harfenisten Philipp Joseph Hinner,83 der Harfenlehrer der französischen Königin Marie-Antoinette,84 und Christian Hochbrucker in Paris. Der damalige Rang der Harfe in der musikalischen Praxis in Deutschland wird aber richtig beurteilt worden sein. Das verdeutlicht, dass Krumpholtz Paris als Ziel gewählt hatte, um für seine künstlerische Entfaltung als Harfenist günstige Bedingungen vorzufinden.
Ob sich 1778 die Wege Krumpholtz‘ und W. A. Mozarts in Paris gekreuzt haben, ist fraglich. Ersterer hatte sein Op. 2 (“Recueil de douze Préludes & petits Airs pour la harpe” [Cousineau/Sieber Paris 1778]) „Mlle. de Guines“ gewidmet.85 Diese spielte Harfe, deren Vater Graf, später Herzog de Guines musizierte an der Flöte. Mozart war während seines Aufenthalts in Paris von März bis September 1778 eine Zeit lang Kompositionslehrer der Tochter des Grafen, und er hatte, beauftragt durch deren Vater, das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299 komponiert.86 Wortreich beklagte er sich in seiner Korrespondenz über die Knauserigkeit und Saumseligkeit seines Auftraggebers in der Entlohnung des Unterrichts, obgleich er „alle Tage kommen und 2 Stunden bleiben mußte“ und seine Schülerin kompositorisch untalentiert war. Ferner habe der „Duc de Guines“ – so Mozart – „schon 4 Monate ein Konzert auf die Flöte und Harfe …, welches er mir noch nicht bezahlt hat“.87
Krumpholtz könnte, wie seine Widmung nahelegt, „Mlle. de Guines“ 1778 an der Harfe unterrichtet haben.88 Dann wäre ihm wohl zwangsläufig auch Mozart begegnet. Unterstellte man das, so wäre die Annahme eines künstlerischen Ideenaustausches zwischen den beiden dennoch nicht mehr als eine Hypothese.
Für seinen öffentlichen Auftritt als Harfenist beim Pariser Concert Spirituel am Donnerstag, den 24.12.1778 (Weihnachtsabend), hatte Krumpholtz das von Rigel dem Älteren orchestrierte fünfte Harfenkonzert komponiert.89 Das gesamte Programm der Konzerte zur Weihnachtszeit 1778 war auf zwei aufeinander folgende Tage, Donnerstag, den 24., und Freitag, den 25.12.1778, aufgeteilt. Im Mercure de France, Ausgabe 5.1.1779, war darüber zu lesen:90 „… Die am Donnerstag aufgeführten Konzerte, für Jagdhorn durch Herrn Léopoldo – Colle, für Violine durch Herrn le Févre und für Harfe durch Herrn Krumpholtz, schienen weniger geschaffen, um zu rühren als um die kleine Zahl an Kennern in Erstaunen zu versetzen. Die am Folgetag gespielten drei Konzerte, auf der Klarinette durch Herrn Baer, auf der Geige durch Herrn Capron und auf dem Violoncello durch Herrn Duport, waren von gleicher Art; dennoch ist es nötig, die Herren Duport und Krumpholtz auszunehmen, deren Kompositionen, wenngleich kunstvoll und gespickt mit Schwierigkeiten, noch eine schätzenswerte Melodie bewahrten, geschaffen, um ungeübten Ohren sowie den der Gelehrten zu gefallen. …“
Diese Rezension verdeutlicht, dass Krumpholtz nicht als Epigone, sondern als Komponist beurteilt wurde, der das Harfenspiel durch innovative, an die Grenzen der musikalischen Ausdrucksfähigkeit des Instruments gehende Werke bereicherte. Er paarte in seinen Kompositionen außerdem deutsche Formenstrenge mit französischem Geschmack, um so seine musikalische Phantasie in Weiterentwicklung der Harfenkunst wirksam zu Gehör zu bringen. Davon zeugt auch die autobiografische Überlieferung.
Nach seiner Darbietung beim Concert Spirituel am Weihnachtsabend 1778 schuf er in rascher Abfolge mehrere Werke für die Harfe, die oft Personen aus der Aristokratie gewidmet waren.91
6.1 Krumpholtz‘ eminente Schülerin
Ein besonderes Anliegen als Pädagoge verfolgte Krumpholtz in der Entwicklung der Begabung Anne-Marie Stecklers, um ihre solistischen Fähigkeiten in der Hauptstadt zur Blüte zu bringen.92 Anne-Marie war gerade erst dreizehn Jahre alt, als sie sich am 8.12.1779 in Paris mit einer Komposition Krumpholtz‘ bei einem Concert Spirituel hatte hören lassen. Der Mercure de France berichtete:93
„Unter den beim Concert Spirituel am 8. Dezember aufgetretenen Virtuosen erblickte man Fräulein Stehler,94 im Alter von 13 Jahren; sie spielte zum ersten Mal auf der Harfe ein von ihrem Lehrer Herrn Krumpholtz komponiertes Konzert: Den Talenten der Schülerin und des Lehrers wurde einhelliger Beifall gezollt. …“
Dass Marie-Antoinette, die französische Königin mit einer Neigung für das Harfenspiel,95 dieses Concert Spirituel besucht habe, wie im Schrifttum behauptet wird,96 ist der Presseschilderung über das Konzert, in dem es noch weitere Programmpunkte gab, nicht zu entnehmen. Eine Anwesenheit von Marie-Antoinette wäre freilich nicht unbemerkt und unerwähnt geblieben.
Wenig später war im Jänner 1780 über die beiden Konzerte am Weihnachtsabend und am Weihnachtstag 1779, bei denen auch Anne-Marie Steckler aufgetreten war, im Mercure de France unter anderem zu lesen:97 „…, Mlle Steckler, Schülerin von M. Krumpoltz [sic], deren außergewöhnliche Ausführung die der meisten unserer Harfenmeister in den Schatten stellt.“
Es gelang Krumpholtz, das Harfenspiel Anne-Maries, seiner in künstlerischer Hinsicht wichtigsten Schülerin, immer mehr zu vervollkommnen. Diese war auf Grund ihrer außergewöhnlichen Begabung bald zur spieltechnisch perfekten Interpretin mit einem unvergleichlichen musikalischen Ausdruck gereift. Im Jahr 1781 kehrte sie für insgesamt fünf Solistenkonzerte zwischen Jänner und Juli nach Metz zurück. Das Publikum war nach Berichten beeindruckt.98 Am Sonntag, den 2.2.1783, hatte sie in Paris als Harfenistin wieder einmal mit einer Komposition Krumpholtz‘ in einem Concert Spirituel brilliert. Danach wurde im Mercure de France ihre Darbietung und Wirkung so beschrieben:99
„Diese junge Virtuosin, die unendliche Anmut mit erstaunlicher Kraft, Klarheit und Präzision vereint, vermittelt einen großartigen Eindruck über die Begabung des Herrn Krumpholtz, dessen Schülerin sie ist.“
In der Folge wurde sie nach Auftritten100 immer wieder mit Lob überschüttet, und es setzte sich bald die Ansicht durch, sie sei eine unübertreffliche Harfenistin, deren solistische Begabung die ihres Lehrers weit übertreffe.101 Diese Wertung teilte Krumpholtz selbst, der das in Technik und Ausdruck überlegene und einzigartige Harfenspiel seiner Schülerin neidlos anerkannte.
Krumpholtz, der mehr als zwanzig Mal in einem Concert Spirituel als Harfenist aufgetreten sein soll,102 und der sich aufgrund der überlegenen Spielkunst seiner hochbegabten Schülerin schließlich selbst nur mehr als mittelmäßig empfunden hatte,103 zog sich infolgedessen als Solist – unter Behauptung seines in der Öffentlichkeit anerkannten Ranges als hochangesehener Komponist und Lehrer104 – immer mehr zurück, während er gleichzeitig Anne-Marie in der steten Nuancierung ihrer Spieltechnik und ihres künstlerischen Gestaltungsvermögens unterstützte.
[...]
1 Krumpholtz, Principes pour la harpe (1800) (Google Play). Ein Nachdruck der Originalquelle findet sich bei Müller, Krumpholtz 202 ff. Eine Übersetzung in die englische Sprache besorgte Piana, Krumpholtz in His Own Words, AHJ Vol. 25 No. 4 Winter 2017, 40 ff.
2 Der Lehrer könnte der Harfenist Jan Schwarz gewesen sein. Eine solche Vermutung äußert Marešová in Müller, Krumpholtz 157.
3 Vermutlich Christian Hochbrucker, deutscher Komponist, Harfenist und Harfenlehrer (1733-1800 [?]). Karge biografische Daten finden sich in: Highfill u. a., A biographical Dictionary, Vol. 7 (1982) 344 f (ohne den vermutlichen Zeitpunkt des Ablebens) (HathiTrust Digital Library). Einige weitere Informationen zu den „Hochbruckers“, insbesondere zu Christian, bei: Rensch, Harps and Harpists (2017) 133 ff, 143; Cleary, Harpe Organisée, AHJ Vol. 26 No. 2 Winter 2018, 23 f; Kinsky, Musikhistorisches Museum (1912) 11 f (Internet Archive). Müller, Krumpholtz 20, lässt offen, welcher „berühmte Hochbrucker“ – Jean-Baptiste oder Christian – Jan Křtitel Harfenunterricht erteilt hat.
4 Jean-Philippe Rameau (1683-1764), französischer Komponist, auch ein Musiktheoretiker von Rang, https://www.britannica.com/biography/Jean-Philippe-Rameau, Zugriff 10.7.2020.
5 Jean-Joseph Rodolphe (1730-1812), elsässischer Komponist, Hornist, Geiger und Musikpädagoge, https://french-horn.net/index.php/biographien/110-jean-joseph-rodolphe.html, Zugriff 10.7.2020.
6 „…des sons aigres; …“
7 Georg Christoph Wagenseil (1715-1777), österreichischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge. Kaiserlicher Hofkomponist. Er lebte und arbeitete in Wien. Näheres bei: Fastl, Art. „Wagenseil, Georg Christoph‟, in: Österreichisches Musiklexikon online, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_W/Wagenseil_Georg_Christoph.xml, Zugriff 10.7.2020.
8 Václav (Wenzel) Pichl (auch Püchel) (1741-1805), böhmischer Komponist und Geiger. Näheres bei: Boisits, Art. „Pichl (Pichel), Wenzel (Václav, Venceslaus)‟, in: Österreichisches Musiklexikon online, https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_P/Pichl_Wenzel.xml, Zugriff 10.7.2020.
9 Quelle: „…, se chargea des accompagnemen[t]s.“
10 Quelle: „…, à voler de mes propres ailes.“
11 Öffentliche Konzerte, die von 1725 bis 1790 in Paris neben einem sonst bestehenden Veranstaltungsprivileg der königlichen Musikakademie an katholischen Feiertagen stattfanden. Dazu: Origin and History of the Concert Spirituel, The Harmonicon 1824, Part I., Vol. II. 57 (Google Play). Das wahrscheinlich letzte dieser traditionellen Konzerte fand am Donnerstag, den 13.5.1790, statt. – Journal de Paris, Ausgabe Donnerstag 13.5.1790, Sammelband 535 (Seitenzahl verstümmelt, aber wohl 535) (Google Play).
12 Offenkundig jemand, der im Zuge der Instrumentierung Töne in harmonisch abgestimmten Klangfarben zur Begleitung des Soloparts beisteuert.
13 Henri-Joseph Rigel (1741-1799), deutscher Komponist, Pianist und Musikpädagoge, der in Paris lebte und arbeitete. Siehe zu biografischen Daten: Ewen, Composers of Yesterday (1937) 359 (Internet Archive).
14 Müller, Krumpholtz 21 f, 170, 172, 174.
15 Französischer Komponist, Harfenist und Harfenpädagoge (1774 – bis nach 1827), siehe: Fétis, Biographie universelle, Band 7 (1878) 69 (Google Play).
16 Krumpholtz, Principes pour la harpe (Google Play). Eine Stellungnahme zu J. M. Plane, https://imslp.org/wiki/Category:Plane,_Jean_Marie, Zugriff 10.7.2020, nennt als Datum der Veröffentlichung des Lehrbuchs „1809“. Die Informationen zum digitalisierten Werk widerlegen diese Annahme. Soweit in jener Äußerung noch auf eine „Detaillierte Biographie: Fetis, vol. 6“ zu J. M. Plane verwiesen wird, ist vermutlich die Kurzbiografie in Fétis, Biographie universelle, Band 7 (1878) 69 (Google Play) gemeint.
17 „…, qu'ils ont été écrits par lui-même.”
18 Sammelband 1461 (Google Play).
19 Biographie universelle, Band 5 (1863) 123 („… ce n’est qu‘une fraude mercantile“.) (Google Play).
20 Biographie universelle, Band 7 (1878) 69 (Google Play).
21 Die korrekte Schreibweise des Familiennamens ist „Krumpholtz“, wie die in mehreren Punkten bahnbrechenden Forschungsarbeiten von Marie Marešová belegen (Pražský rodák Jan Křtitel Krumpholtz 1994 in: Miloš Müller, Jan Křtitel Krumpholtz: Život a dílo harfového virtuóza a skladatele 1999 146 ff 146). Krumpholtz verwendete diese Schreibweise in Unterschriften auch selbst. Als Beispiele dafür mögen Unterschriften auf gestochenen Ausgaben seiner Werke dienen: L'Amante abandonnée. Air parodié en français et en italien sur l'Adagio de l'Œvre XIV (1788) (Google Play); Quatre Sonates en forme de Scenes de differens Caractères et d’une difficulté graduelle pour La Harpe (Internet Archive).
22 Die wahren Daten wurden – gestützt auf eine verlässliche Quelle (Geburts- und Taufmatrikel) – erst durch die Forschungsarbeiten Marešovás enthüllt. Müller, Krumpholtz 18, 182 (Faksimile der Geburts- und Taufmatrikel), beruft sich auf Marešová, deren Aufsatz (Pražský rodák Jan Křtitel Krumpholtz 1994) auch den transkribierter Wortlaut der Registereintragung enthält, in: Müller, Krumpholtz 152. In der tschechischen Wikipedia ist ein Link zur (schwer lesbaren) Eintragung in die Geburts- und Taufmatrikel zu finden, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99titel_Krumpholtz, Zugriff 11.7.2020. Im Rahmen einer Auflistung biografischer Daten der Familie Krumpholtz nennt Müller, Krumpholtz 167, 168, 169, als Geburtsdatum schließlich den 5.7.1747. Das ist jedoch ein offenkundiger Schreibfehler.
23 Insofern verweist Müller, Krumpholtz 17, auf den damaligen Stand des Werks “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”.
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptist_Krumpholz, Zugriff 11.7.2020; https://www.deutsche-biographie.de/sfz46408.html, Zugriff 11.7.2020.
25 Bernsdorf, Universal-Lexikon der Tonkunst, Band 2 (1857) 670 („Krumpholz“) (Google Play); Fétis, Biographie universelle, Band 5 (1863) 122 (“Krumpholz”, „vers 1745“) (Google Play); Wurzbach, Biographisches Lexikon, Band 13 (1865) 278 („um das Jahr 1945“) (Google Play); Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz” „about 1745“) (Internet Archive); Remy, Baker’s Biographical Dictionary of Musicians, 3. Auflage (1919) 491 („circa 1745“) (Internet Archive); Rensch, Harps and Harpists (2017) 138 („1945?“).
26 Müller, Krumpholtz 17 (unter Hinweis auf „M. F. Thiernesse-Baux “).
27 Müller, Krumpholtz 17 f, erörtert, was im Schrifttum alles an Geburtsdaten und an Geburtsorten kursiert hatte, ehe Marešová in Müller, Krumpholtz 146 ff, Licht ins Dunkel brachte.
28 Beispielsweise: Rensch, Harps and Harpists (2017) 138 („1945?“); Adelson u. a., Erard (2015) Band I, 26 („Chržín“).
29 Marešová in Müller, Krumpholtz 147 f.
30 Rensch, The Harp (1950) 47 (“The elder Haydn … taught the young Johan Baptist Krumpholz to play the Harp. This Hungarian musician was a friend of both the younger Haydn, and also of Beethoven.”) (Internet Archive).
31 Müller, Krumpholtz 19.
32 Naderman, École de Harpe in quatre parties (1800 [?]) Vorwort III (Internet Archive) und École ou méthode raisonnée pour la harpe (1862) Vorwort III (Google Play): “Hochbrucker” wird als Vorläufer des genialen Krumpholtz erwähnt, es mangelt jedoch an einem Vornamen („Après Hochbrucker qui ne fit que la montrer, pour ainsi dire, vint Krumpholtz: …“). Nach einer alphabetisch geordneten Liste an Personen samt deren Adressen wirkte 1789 eine große Anzahl an „Maitres de Harpe“ – darunter ein gewisser „Hochbruck“ – in Paris: Calendrier Musical Universel (Nachdruck 1972 aus 1789) 662 ff (Scan-Seitenzählung) (HathiTrust Digital Library). Bei der Bezeichnung „Hochbruck“ wird es sich um eine Verstümmelung des Namens „Hochbrucker“ handeln. Aber auch in dieser Quelle fehlt ein Vorname.
33 Müller, Krumpholtz 21; Marešová in Müller, Krumpholtz 149, spricht von einer Rückkehr nach Prag im Alter von einundzwanzig Jahren, somit erst 1768.
34 Marešová in Müller, Krumpholtz 151, 154; Müller, Krumpholtz 19.
35 Müller, Krumpholtz 167, 168, 169.
36 Nicht bekannt ist, wann die erste Ehefrau Eleonora verstorben ist: Müller, Krumpholtz 167-169.
37 Müller, Krumpholtz 21, 167, 169, 174.
38 Müller, Krumpholtz 21, 170, 172, 174.
39 Die Erfindung der Pedalharfe wird gewöhnlich Jakob Hochbrucker (1673-1763) zugeschrieben. Dazu und im Übrigen ausführlich zur Erfindung, Beschaffenheit und Entwicklung der Pedalharfe: Cleary, Harpe Organisée, AHJ Vol. 26 No. 2 Winter 2018, 23 f, 22-38; siehe ferner Kinsky, Musikhistorisches Museum (1912) 11 f (Internet Archive).
40 Müller, Krumpholtz 22, 170, 172, 174.
41 Israël, Frankfurter Concert-Chronik von 1713 – 1780 (1876) 50 f (Google Play).
42 Israël, Frankfurter Concert-Chronik von 1713 – 1780 (1876) 51 (Google Play). Müller, Krumpholtz 22, nennt in seiner biografischen Erzählung einen zweiten Konzerttermin am „22. záři 1770“ (22.9.1770). In den Zeittafeln in tschechischer, französischer und englischer Sprache wird schließlich als zweiter Konzerttermin jeweils der 22.8.1770 angeführt (170: „srpna“, 172: „août“, 174: „August“). Richtig ist indes weder das eine noch das andere. Der angeblich zweite Auftritt bei einem Konzert 1770 in Frankfurt/Main hat nämlich nicht stattgefunden. Krumpholtz hat sich vielmehr erst wieder am 22.9.1776 in Frankfurt/Main als Harfenist präsentiert. Siehe dazu: Israël, Frankfurter Concert-Chronik von 1713 – 1780 (1876) 59 (Google Play).
43 Müller, Krumpholtz 22, 170, 172, 174.
44 Müller, Krumpholtz 22.
45 Wiener „Kais. Königl. Allergnädigst privilegirte Realzeitung“, Ausgabe 17. Oktober („Weinmonat“) 1772, Sammelband 650 (Google Play). Auf diesen Auftritt wird augenscheinlich Bezug genommen in: Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz”) (Internet Archive).
46 “Böheim” = Böhmen.
47 Cleary, Harpe Organisée, AHJ Vol. 26 No. 2 Winter 2018, 26.
48 Wiener „Kais. Königl. allergnädigst privilegirte Realzeitung“, Ausgabe 7. November („Wintermonat“) 1772, Sammelband 709 (Google Play).
49 Anhänge zu „Wienerisches Diarium“ Nr. 89 und Nr. 91, 4. und 11. November („Wintermonat“) 1772, (ÖNB-ANNO). Diese Anzeigen dürften einer Aussage im Schrifttum zugrunde liegen, dass „Krumpholz“ die Erteilung von Unterricht an der Pedalharfe in Wien (wohl 1772) inseriert hatte, in: Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (Internet Archive).
50 Davidson, Fanny Krumpholtz (c. 1850), The Keep, Reference HIC/1059b.
51 Neue Wiener Musik-Zeitung, Ausgabe Donnerstag 13.8.1857 („Krumpholz“) (ÖNB-ANNO); Jahres-Bericht des Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (1870) 4 f (Google Play); Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz”) (Internet Archive); Schuster, Die Musik, Band XII (1903–1904) 47 (Internet Archive); Riemann, Musik-Lexikon, 9. Auflage (1919) 630 (Internet Archive); Müller, Krumpholtz 19.
52 Schuster, Die Musik, Band XII (1903–1904) 47 („Krumpholz“) (Internet Archive).
53 Wiener allgemeine Musik-Zeitung, Ausgabe Di[e]nstag 31.3.1846 („Krumpholz“) (ÖNB-ANNO); Neue Zeitschrift für Musik, Ausgabe Freitag 20.8.1880 („Krumpholz“ – Einzelheiten zur Komposition und zu ihrer Notation) (ÖNB-ANNO). Nach den zuvor zitierten Quellen war der Todestag der 2. oder der 3.5.1817. Beethovens Komposition wurde am 3.5.1817 notiert. Das weist bereits auf den 2.5.1817 als Todestag hin. Klarheit schafft eine Nachricht über „Verstorbene zu Wien“ in der Wiener Zeitung, Ausgabe Montag 2.6.1817 (ÖNB-ANNO): Danach ist „Den 2. May 1817 … Wenzel Krumholz [sic], k. k. Hofmusikus, alt 67 J. von Nr. 269 auf der Landstrasse, … am Schlagfluss gähe [sic] gestorben.“ Dieses Datum als Todestag findet sich etwa auch in: Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz”) (Internet Archive); Riemann, Musik-Lexikon, 9. Auflage (1919) 630 (Internet Archive). Das Manuskript Beethovens für die Komposition soll die Widmung tragen: „‘Zur Erinnerung an den schnellen unverhofften Tod unseres Krumpholz am 3. Mai 1817‘“. Siehe dazu: Schuster, Die Musik, Band XII (1903–1904) 47 („Krumpholz“) (Internet Archive).
54 Flood, The Story of the Harp (1905) 117 (“J. B. Krumpholz, of Prague, the friend of Haydn and Beethoven, was not only a remarkable Hungarian harpist, …”) (Internet Archive); Rensch, The Harp (1950) 47 (“The elder Haydn … taught the young Johan Baptist Krumpholz to play the Harp. This Hungarian musician was a friend of both the younger Haydn, and also of Beethoven.”) (Internet Archive).
55 Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten, Band 5 (1901) 461 (Internet Archive). Václav (Wenzel) „Krumpholz“ spielte vielmehr ab 1796 eine der ersten Geigen im Orchester der Wiener „court-opera“: Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz”) (Internet Archive).
56 Eine Beschreibung der Schlossanlage mit Park und Nebengebäuden („Esterhaß“), so auch des Opernhauses und des Marionettentheaters, der Schloss- und der Opernausstattung sowie des Opern- und Theaterbetriebs etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Engagement Krumpholtz‘, findet sich in einer historischen Buchrezension in: „Kais. Königl. allergnädigst privilegirte Realzeitung“, Ausgabe 15.6.1784, Sammelband 384 ff (Google Play). Danach bot das Opernhaus etwa 400 Besuchern Platz. Die Aufführungen, die bei freiem Eintritt besucht werden konnten, begannen gewöhnlich um 18 Uhr. Im Einzelnen zur Geschichte von „Esterház“ (heute: Eszterháza), zur Schlossanlage mit Park samt Nebengebäuden sowie zum künstlerischen Betrieb: Pohl, Joseph Haydn, Band 2 (1882) 3 ff (Google Play). Nach dieser Quelle (7 f) fanden in „Esterház“, solange sich der Fürst dort aufgehalten hatte, täglich Vorstellungen statt; „zweimal in der Woche (Donnerstag und Sonntag) war Oper, die übrigen Tage Schau- oder Lustspiel; der Anfang war um sechs Uhr; Zutritt hatten alle fürstlichen Beamten und Diener, wie auch die zufällig anwesenden Fremden.“ Näheres zur Baugeschichte und zu einer detailreichen Beschreibung der Schlossanlage, insbesondere auch des Opernhauses, mit Plänen und Gemälden bei: Horányi, The Magnificence of Eszterháza (1962) 44 ff (Internet Archive).
57 Müller, Krumpholtz 22 (aber nicht erst am 1.9.1773 wie dort behauptet); Griffiths, Krumpholtz. Eine verlässliche Stütze für diese Ansicht fehlt. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass sich Krumpholtz als Harfenist mit diesem Konzert präsentierte.
58 Pohl, Joseph Haydn, Band 2 (1882) 101 (Google Play); Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten, Band 5 (1901) 461 (Internet Archive); Fuller-Maitland, Grove’s Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1906) 605 („Krumpholz“ – „August 1773“) (Internet Archive); Pratl/Scheck, Regesten (2004) 50; Pratl, Acta Forchtensteiniana (2009) 60f. Unzutreffend sind andere Daten, die im Schrifttum genannt werden: Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz” – Beginn des Engagements ab „Oct. 1773“) (Internet Archive); Müller, Krumpholtz 22 (Beginn des Engagements ab 1.9.1773). Bei Griffiths, Krumpholtz, ist die Rede von einem den Quellen nicht zu entnehmenden Ausbildungsvertrag („indenture“). In der Dokumentation über den fürstlichen Musikbetrieb, den Acta Musicalia, findet sich im schlagwortartig zusammengefassten Text des Dokuments Nr. 10 der Begriff „Convention des Harfenisten Johann Baptist Krumpholtz“. Siehe dazu: Pratl/Scheck, Regesten (2004) 50. Unter „Convention“ verstand man die Besoldung in Geld und Naturalien aufgrund eines Dienstvertrags. Siehe dazu: Pratl/Scheck, Musik-Dokumente (2017) 249; d ies, Regesten (2004) 15 (Glossar).
59 Pratl, Acta Forchtensteiniana (2009) 59 f.
60 Pratl, Acta Forchtensteiniana (2009) 58.
61 Pratl/Scheck, Musik-Dokumente (2017) 13.
62 Pratl, Acta Forchtensteiniana (2009) 63; Pohl, Joseph Haydn, Band 2 (1882) 101 (bis “März”) (Google Play).
63 Pratl, Acta Forchtensteiniana (2009) 62 f.
64 Bartha, Josef Haydn 501 (Internet Archive).
65 Näheres zum Marionettentheater in Eszterház und den vom Gastgeber organisierten Festlichkeiten anlässlich des Besuchs der Kaiserin Maria Theresia bei: Asztalos, Theatrical Life, Studia Ubb Musica 2012, 132 f; Horányi, The Magnificence of Eszterháza (1962) 87 ff (Internet Archive).
66 Golddukaten ungarischer Prägung, die häufig als fürstliche Geschenke dienten. Siehe dazu: Pratl/Scheck, Musik-Dokumente (2017) 242.
67 Bartha, Josef Haydn 71 (Internet Archive).
68 Müller, Krumpholtz 23.
69 Zu einzelnen Stationen, jedoch vermutlich in der oben bezeichneten Reihenfolge: Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 135. Fétis, Biographie universelle, Band 5 (Paris 1863) 122, nennt auf der Reise nach Metz nur Dresden, Leipzig, Frankfurt am Main und Koblenz als Orte, an denen Krumpholtz konzertierte. Bei Adelson u. a., Erard (2015) Band I, 26 Fn. 89, ist ganz allgemein von einer „concert tour through Europe“ die Rede. Riemann, Musik-Lexikon, 9. Auflage (1919) 630 (Internet Archive), erwähnt „eine große Konzerttour durch Deutschland und Frankreich“. Im Großen und Ganzen richtig wird dort auch der Aufenthalt Krumpholtz‘ in Eszterház von „1773–76“ referiert.
70 In Dresden, Gotha und Koblenz gab es allerdings höfische Orchester und einen Musikbetrieb, in dessen Rahmen Krumpholtz ohne Weiteres als Harfenist aufgetreten sein kann. Siehe dazu: Forkel, Musikalischer Almanach für Deutschland auf das Jahr 1782 (Nachdruck 1974 aus 1782) 143 ff, 140 f, 151 ff (HathiTrust Digital Library).
71 Pohl, Joseph Haydn, Band 2 (1882) 101 (genaues Datum, Spiel auf einer „‘organisirten Harfe‘“) (Google Play); Grove, A Dictionary of Music and Musicians, Vol. II (1900) 74 (“Krumpholz” – Spiel „on an ‘organisirten Harfe‘“) (Internet Archive); Müller, Krumpholtz 23. Im Detail auch zur Harfenart: Cleary, Harpe Organisée, AHJ Vol. 26 No. 2 Winter 2018, 26 f.
72 Israël, Frankfurter Concert-Chronik von 1713 – 1780 (1876) 59 (Google Play).
73 Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 133 ff.
74 Adelson u. a., Erard (2015) Band I, 26 Fn. 89.
75 Rensch, Harps and Harpists (2017) 139 f (“… worked for six months at the shop of … Christian Steckler; …”).
76 Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 135; Griffiths, Krumpholtz.
77 Les amours du fils Gossec, Revue musicale S.I.M. (section de Paris), 15.1.1913, 9 Fn. 5, Gallica ; Griffiths, Krumpholtz; Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 138.
78 Vidal, La Lutherie et Les Lutiers (1889) 235 (bezogen auf das Jahr 1737) (Internet Archive); Stainer, A Dictionary of Violin Makers (1896) 37 (bezogen auf die Jahre 1737, 1744, 1749 und 1765) (Internet Archive); Kinsky, Musikhistorisches Museum (1912) 445 (bezogen auf das Jahr 175?) (Internet Archive).
79 „6 Dec 1777 in Paris, St Roch, France“, in: Gilbert Marguerite, https://www.wikitree.com/wiki/Gilbert-1388, Zugriff 12.7.2020. Ohne Zitierung einer Quelle.
80 Griffiths, Krumpholtz. Nach einer alphabetisch geordneten Liste an Personen samt deren Adressen wirkte 1789 eine große Anzahl an „Maitres de Harpe“ – darunter „Krumpholtz“ – in Paris: Calendrier Musical Universel (Nachdruck 1972 aus 1789) 662 ff (Scan-Seitenzählung) (HathiTrust Digital Library).
81 Naderman, École de Harpe in quatre parties (1800 [?]) Vorwort III (Internet Archive).
82 Forkel, Musikalischer Almanach für Deutschland auf das Jahr 1782 (Nachdruck 1974 aus 1782) 111 (HathiTrust Digital Library).
83 In den musikalischen Almanach für 1783 wurde sodann noch „Hinner (–) ein Deutscher in Paris“ als Harfenist aufgenommen: Forkel, Musikalischer Almanach für Deutschland auf das Jahr 1783 (Nachdruck 1974 aus 1783) 96 (HathiTrust Digital Library).
84 Rensch, Harps and Harpists (2017) 134.
85 Journal de Paris, Ausgabe Dienstag, 15.12.1778, Sammelband 1409 (Google Play); Bibliothèque nationale de France, https://data.bnf.fr/fr/16609678/jean-baptiste_krumpholtz_douze_preludes_et_petits_airs__op__2/, Zugriff 12.7.2020.
86 https://de.wikipedia.org/wiki/Konzert_f%C3%BCr_Fl%C3%B6te,_Harfe_und_Orchester_(Mozart), Zugriff 12.7.2020.
87 Nohl Ludwig, Mozarts Briefe (1865) 186 f, 156 f (HathiTrust Digital Library).
88 Griffiths, Krumpholtz, bezeichnet eine solche Vermutung als „verlockend“ („tempting“). Die Autorin wähnt im Übrigen Dussek bereits 1778 in Paris. Dieser kam indes erst Jahre später dorthin.
89 Nach dem Titelblatt der gestochenen Originalpartitur dieses Konzerts hätte der Auftritt Krumpholtz‘ am Weihnachtstag („le jour de Noël de l’année 1778“), somit am Freitag, den 25.12.1778, stattgefunden, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52501223m?rk=236052;4, Zugriff 12.7.2020. Das widerspricht dem Konzertbericht im Mercure de France, der sich auf den Weihnachtsabend („la veille“) und auf den Weihnachstag bezieht. Danach fand der Auftritt Krumpholtz‘ am Donnerstag, den 24.12.1778, statt. Das steht im Einklang mit der Ankündigung im Journal de Paris, Ausgabe Dienstag 22.12.1778, Herr Krumpholtz werde am nächsten Donnerstag, den 24.12. 1778 zum ersten Mal ein Harfenkonzert aufführen, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1050011b/f3.item, Zugriff 12.7.2020. Somit beruht die Verwendung des Begriffs „Weihnachtstag“ auf dem Titelblatt der gestochenen Originalpartitur und in der autobiografischen Überlieferung auf einer unpräzisen Ausdrucksweise. Diese veranlasste einen Irrtum etwa auch bei Müller, Krumpholtz 23. Dort ist gleichfalls die Rede von einem Auftritt beim Weihnachtskonzert am 25. Dezember 1778.
90 Sammelband 46 f (Google Play).
91 Griffiths, Krumpholtz.
92 Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 135.
93 Sammelband 150 (Google Play).
94 Der Schreibweise „Stehler“ beruht auf einem Mangel an journalistischer Sorgfalt. Richtig ist natürlich: „Steckler“.
95 Rensch, Harps and Harpists (2017) 131 f, 134.
96 Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 135; Griffiths, Krumpholtz: Nach dieser Autorin soll das Konzert am „13 December 1779“ stattgefunden haben. Dieser Tag war ein Montag und kein religiöser Feiertag, sodass ein solcher Aufführungstag allein wegen der Organisationsstruktur des Konzerttypus hätte Bedenken hervorrufen müssen. Eine korrekte Wiedergabe des Konzerttermins findet man dagegen in: Les amours du fils Gossec, Revue musicale S.I.M. (section de Paris), 15.1.1913, 9, Gallica: „Madame Krumpholtz débuta au Concert Spirituel le 8 décembre 1779.“ Allerdings war die Solistin damals noch nicht „Madame Krumpholtz“.
97 Sammelband Jänner 1780, 32 (HathiTrust Digital Library).
98 Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 136 f.
99 Sammelband 127 (Google Play).
100 So hatte sie etwa im Rahmen eines Concert Spirituel mehrmals Krumpholtz‘ sechstes Konzert für Harfe und Orchester (mit zwei Violinen, zwei Oboen, zwei Hörnern, einer Flöte, einer Barockoboe und einem Bass) Op. 9 interpretiert, ein Werk, das der Komponist ihr gewidmet hatte („Sixième concerto pour la harpe … Œuvre IX.“) (Titelblatt) (Google Play).
101 Tribout de Morembert, Anne-Marie Steckler 138 f.
102 Adelson u. a., Erard (2015) Band I, 26 Fn. 89.
103 Vereinzelt wird substanzlos und mit einer wohl abwertenden Konnotation vertreten, „Krumpholz“ habe – im Unterschied zu seiner zweiten Frau – die deutsche Art des Harfenspiels gepflegt: A Dictionary of Musicians, Vol. II (1827) 27 f (Google Play). Im Dunkeln bleibt, welche Merkmale für diese Art des Harfenspiels typisch gewesen sein sollen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Texts "Inhalt:"?
Der Text "Inhalt:" ist eine biographische Abhandlung über Jean-Baptiste (Jan Křtitel) Krumpholtz, Madame (Anne-Marie, Anne-Marguerite, Julie) Krumpholtz, und Fanny (Louise Françoise) Pittar-Krumpholtz. Er enthält detaillierte Informationen über ihr Leben, ihre Karriere, ihre Beziehungen und ihren Einfluss auf die Musikwelt.
Was sind die Hauptabschnitte über Jean-Baptiste Krumpholtz?
Die Hauptabschnitte über Jean-Baptiste Krumpholtz umfassen seine autobiografische Überlieferung, die Perspektive seines Schülers J. M. Plane, eine ausführliche biografische Erzählung, sowie Informationen über seine Werke.
Was behandelt die autobiografische Überlieferung von Jean-Baptiste Krumpholtz?
Die autobiografische Überlieferung behandelt Krumpholtz' Jugend, seine musikalische Ausbildung, seine Reisen, seine Erfahrungen als Musiker und Komponist, sowie seine Beziehungen zu anderen Musikern wie Wagenseil, Haydn und Rigel. Sie beinhaltet auch seine Reflexionen über das Harfenspiel und seine Frau Anne-Marie.
Was ist die Bedeutung von J. M. Planes Bericht über seinen Lehrer?
J. M. Plane gibt Einblicke in Krumpholtz' künstlerische Bedeutung, sein persönliches Schicksal und die Entstehung der Krumpholtz'schen Harfenschule. Er betont die Ehrlichkeit und Bescheidenheit von Krumpholtz' Charakter.
Welche Ereignisse werden in der Biografie von Jean-Baptiste Krumpholtz behandelt?
Die Biografie behandelt Krumpholtz' Jugend, Ausbildung, frühe Wanderjahre, Aufenthalte in Wien und Eszterház, seine Konzerttournee, Zeit in Metz, künstlerische Entfaltung in Paris, persönliche und familiäre Entwicklungen sowie seinen Tod.
Was sind die zentralen Aspekte von Madame Krumpholtz' Biografie?
Die Biografie von Madame Krumpholtz behandelt ihre Zeit in Frankreich, ihre Karriere in London als Harfenistin und Pädagogin, ihr Privatleben, Gerüchte über Liebhaber, ihr Konkubinat mit Sturt, sowie den Ausklang ihrer Karriere und ihren Tod.
Was erfahren wir über Fanny Pittar-Krumpholtz?
Die Biografie von Fanny Pittar-Krumpholtz behandelt ihre Abstammung, Kindheit und Jugend, Übersiedlung nach England, Aufenthalt in Irland, Umgang mit Madame Krumpholtz, ihre Familie, berufliche Entfaltung und ihren Tod.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text verwendet verschiedene Quellen, darunter Krumpholtz' autobiografische Schriften, J. M. Planes Bearbeitung der Krumpholtz'schen Harfenschule, historische Zeitungsartikel, biografische Lexika, wissenschaftliche Abhandlungen und digitalisierte Quellen von Google Books, Google Play und der Österreichischen Nationalbibliothek.
Was wird über Krumpholtz' Aufenthalt in Eszterház berichtet?
Sein Engagement als Harfenist im fürstlichen Orchester unter Joseph Haydn wird geschildert. Es werden Einzelheiten zu seinem Gehalt, seinen Aufgaben und seiner musikalischen Entwicklung unter Haydns Einfluss aufgeführt.
Welche Rolle spielte Anne-Marie Steckler (später Krumpholtz) in Krumpholtz' Leben und Werk?
Anne-Marie Steckler war Krumpholtz' Schülerin und später seine Frau. Sie entwickelte sich zu einer herausragenden Harfenistin und beeinflusste Krumpholtz' kompositorisches Schaffen. Sie wird als spieltechnisch perfekt und ausdrucksstark beschrieben, und Krumpholtz erkannte ihr Talent neidlos an.
- Quote paper
- Alfons Zechner (Author), 2020, Der Harfenist Jean Baptiste Krumpholtz und seine Familie. Biografische Skizzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/981521