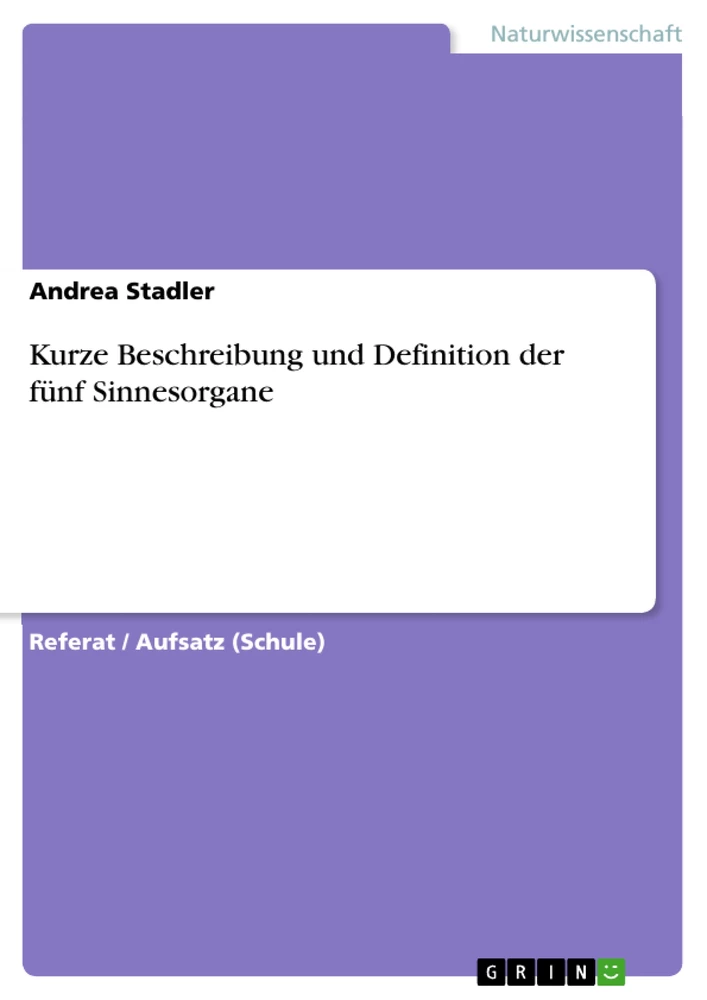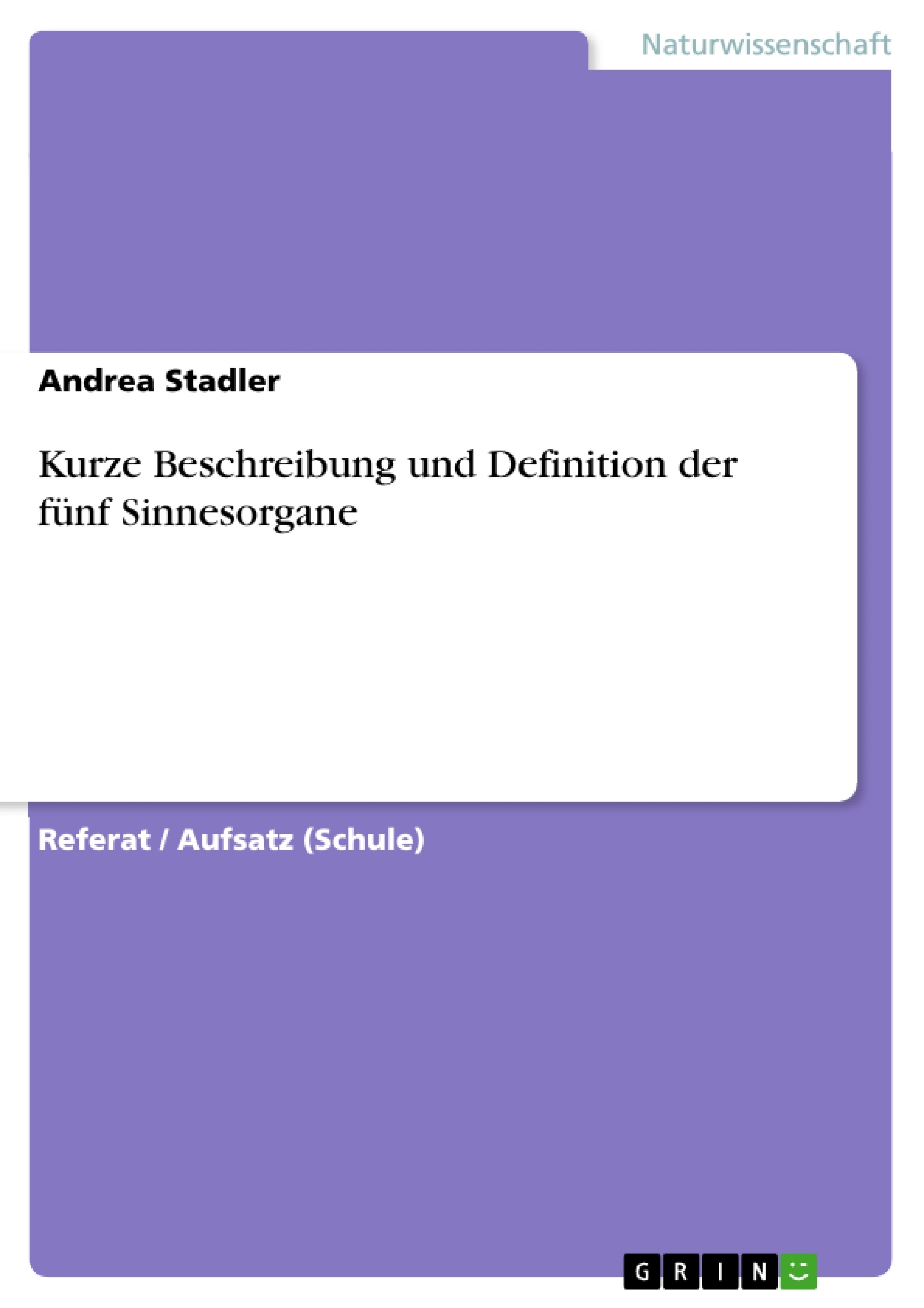Die klassischen fünf Sinne sind Riechen, Schmecken, Tasten, Hören und Sehen. Sinnesorgane ermöglichen es den Lebewesen, mit der Umwelt Kontakt aufzunehmen. Die Sinneszellen sind auf chemische, mechanische, thermische oder elektromagnetische Reize spezialisiert. Sie arbeiten aber nach einem einheitlichen Prinzip: Nur Reize von bestimmter Intensität (Schwellenintensität) und von einer gewissen Dauer werden als elektrische Signale weitergeleitet. Ein einwirkender Reiz wird dabei verstärkt. Auch ein (falscher) inadaaequater Reiz kann zu einer Empfindung führen, braucht dazu aber eine deutlich höhere Intensität. Der ausgelöste Sinneseindruck bleibt jedoch derselbe.
Andrea Stadler
DIE SINNESORGANE
Die klassischen fünf Sinne sind Riechen, Schmecken, Tasten, Hören und Sehen. Sinnesorgane ermöglichen es den Lebewesen mit der Umwelt Kontakt aufzunehmen. Es gibt Tiere bei denen sich gewisse Sinnesqualitäten an ihre Lebensweise angepasst hat. Z.B Insekten, die Lockstoffe abgeben, welche die Männchen anlocken, wenn sie sich paaren wollen, oder die Fledermäuse, die Ultraschallwellen aussenden.
Die Sinneszellen sind auf chemische, mechanische, thermische oder elektromagnetische Reize spezialisiert. Sie arbeiten aber nach einem einheitlichen Prinzip:
Nur Reize von bestimmter Intensität (Schwellenintensität) und von einer gewissen Dauer werden als elektrische Signale weitergeleitet. Ein einwirkender Reiz wird dabei verstärkt. Auch ein (falscher)inadaaequater Reizkann zu einer Empfindung führen, braucht dazu aber eine deutlich höhere Intensität. Der ausgelöste Sinneseindruck bleibt jedoch derselbe. Bsp: Wenn die Sinneszellen des menschlichen Auges durch einen harten Schlag gereizt werden, löst dies auch eine Lichtempfindlichkeit aus.
Adaption von Sinneszellen: Sinneszellen ändern ihre Empfindlichkeit für einen Reiz ziemlich rasch (Adaption). Bei unverändert starkem Reiz nimmt nach einer gewissen Zeit ihre Bereitschaft ab, elektrische Signale zu bilden. So wird ein Geruch, der dauernd ausgesendet wird, mit der Zeit kaum mehr wahrgenommen. Der Bildeindruck würde mit der Zeit bald verschwinden, wenn die Augen nicht dauernd kleinste Bewegungen machen würden, um die Sinneszellen immer wieder neu zu erregen.
1. Die Augen, Sehen
Voraussetzung für die Wahrnehmung von Licht ist das Vorhandensein von Sinneszellen. Das Lichtspektrum welches wahrgenommen werden kann ist nicht bei allen Lebewesen gleich. (Ratten und Kaninchen sehen keine Farbe, Bienen nur kurzwellige Strahlung).
Beim menschl. Auge unterscheiden wir zwei Typen von Sinneszellen;
Stäbchen (beim Menschen ca. 120 Mio.), welche die Wahrnehmung von verschiedenen Helligkeitsstufen bei Dämmerung und Nacht ermöglichen.
Zapfen (6 Mio.), welche für das scharfe Sehen und das Sehen von verschiedenen Farbkontraste bei Tag da sind.
Die Stelle des schärfsten Sehens enthältmehr Zapfen (gelbe Fleck)Vögel, die besonders gut sehen können aus weiter Entfernung haben zwei solche Stellen. Wasser- und Steppenvögel können den gelben Fleck sogar als horizontales Band ausgebildet haben.
Gegen dieNetzhausperipheriefinden sich dagegenmehr Stäbchen. Eine differenzierte Gestaltenwahrnehmung ist dort nicht möglich.
Das Auge besitzt ein optisches System (=Hornhaut, Augenkammer, Linse (Ziliarmuskel), Glaskörper), welches die Lichtstrahlen bündeln, dass sie auf der Netzhaut auftreffen. Der Lichtstrahl trifft auf die Aderhaut, welche das Auge durchblutet und ihm Nährstoffe zuführt. Die Pigmentschicht ist ein Teil der Aderhaut. Nun kommt der eigentliche Sehvorgang: kommt ein Lichtreiz, so tauchen die Sinneszellen in die Pigmentschichte ein, und das Licht wird reflektiert. Alle Sinneszellen enthalten einen Sehfarbstoff, das Sehpurpur.Trifft nun Licht auf die SInneszellen, so zerfällt der Farbstoff in einer chem. Kettenreaktion. Das Sehpurpur spaltet sich in Opsin und Retinal. Dieser Reiz löst den Sehimpulse aus. Damit dieser Vorgang dauernd ablaufen kann, muss das Sehpurpur wieder hergestellt werden. Dies geschieht durch das Vitamin A.
Der Impuls wird also weitergeleitet an die Schaltzellen und Nervenzellen, und den Axon. Die Axone dieser Nervenzellen verlassen das Augeninnere im Bereich des sogenannten blinden Flecks und bilden den Sehnverv. Die eintreffenden Lichtstrahlen entwerfen auf der Netzhaut ein umgekehrtes und verkleinertes Bild. Durch die Verarbeitungsweise der Bildinformation im Gehirn, sehen wir doch alles richtig.
Akkomodation: Nah-Fernsicht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Adaption: Hell-Dunkel Anpassung durch Irismuskel und Pupille.
Legende:
a) Axone (alle zus.ergeben Sehnerv
b) Nervenzellen mit Synapsen
c) Schlatzellen (NZ) Bündelung der Reize
d) Zapfen, e) Stäbchen
f) Pigmentschicht; Lichtabsorption
g) Pigmentzellen
h) Aderhaut (viele davon=dunkle Augen
Achtung: bei viel Licht können die Stäbchen und Zäpfchen in die P. eintauchen. Ist das Licht aber zu hell, können sie sich nicht mehr schützen· Verletzung der SZ . Ein Schutz ist deshalb unerlässlich. Auch bei Schnee ist Vorsicht geboten: Das Licht wird im Schnee reflektiert, und es entsteht in so grosser Reiz, dass zu viel Sehpurpur gespaltet wird. ES braucht lange bis sich die Pigmentschicht regeneriert hat.
2. Das Ohr, Hören
Das Ohr des Menschen und der Säugetiere wird in Innenohr, Mittelohr und Aussenohr gegliedert.
Das Innenohr ist auch der Sitz des Gleichgewichtsinns. Es ist ein häutiges Gebilde aus verschiedenen flüssigkeitsgefüllten Blasen und Kanälchen (=Labyrinth). Dort sitzen die Hörsinneszellen. In der Schnecke befindet sich das sogenannte Cortische Organ mit den Hörsinneszellen, das einem dünnen Häutchen aufsitzt und allseitig von Flüssigkeit umgeben ist. Die Erregung der Hörsinneszellen durch Schalldruck löst eine Hörempfindung aus. Der Schalldruck bestimmt auch die Lautstärke eines Tons. Die Frequenz (Tonhöhe) ist abhängig von der Anzahl Schwingungen pro Sekunde). Gesunde junge Leute hören im Bereich von 20 bis 16000 Hertz. Der Hörbereich nimmt im Alter ab. Die Lautstärke wird in dezibel angegeben. Bei längeren dauernden Belastung des Gehörs mit Schallpegeln ab 90 dB muss man mit bleibenden Hörverlusten rechen, da die Sinneszellen mechanisch geschädigt werden.
Der Hörvorgang:Die Schallwellen werden vom äusseren Ohr aufgefangen und zum Trommelfell geleitet. Einige Tiere können ihre Ohrmuschel sogar aktiv auf die Schallwelle ausrichten. Das Trommelfell wird durch die Schallwelle pn in Bewegung versetzt und überträgt seine Schwingungsenergie auf die Gehörknöchelchenkette des Mittelohrs. Diese ist luftgefüllt und mit einer Schleimhaut aussgekleidet. Damit die Gehörknöchelchen frei schwingen können, dass der Luftdruck im Mittelohr demjenigen der Aussenwelt entsprechen. Die Ohrtrompete ermöglicht vom Rachenraum her eine regelmässige Belüftung. Dieser Druckausgleich geschieht jedesmal, wenn wir schlucken. Das letzte Gehörknöchelchen heisst Steigbügel. Da nun die Fläche des Trommelfells grösser ist als diejenige der Steigbügelfusspaltte und dank der Hebelwirkung der Gehörknöchelchen wird der Schalldruck durch die Übertragung etwa 20 mal verstärkt. Durch die Schwingungen des Steigbügels wird die Flüssigkeit des Innenohrs in Bewegung versetzt. Dadurch wird zu Beginn der Schneckenwindung das dünne Häutchen mit den Hörsinneszellen aus seiner Ruhelage ausgelenkt. Von dort aus läuft nun eine Wanderwelle in Richtung Scheckenspitze. Hohe Töne werden in der Nähe des Steigbügels aufgefangen, tiefe Töne in der Schneckenspitze.
2.1 Gleichgewicht:Wenn die Information von Auge und Innenohr nicht übereinstimmen, wird dies als Schwindel (Übelkeit) empfunden. Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr von Mensch und Säuger gliedert sich in zwei Teile:
- zwei sackartige Gebilde, von denen eines waagrecht und das andere senkrecht orientiert ist. Die Sinneshaare der Sinneszellen werden bei geradliniger Beschleunigung ausgelenkt und vermitteln dem Gehirn entsprechende Informationen über die Stellung des Kopfes im Raum.
- Drei Bogengänge, welche in den drei Ebenen des Raums liegen; ihre Sinneszellen werden durch Drehbeschleunigungen erregt.
Gleichgewichtsorgan, optische Eindrücke und mechanische Sinne informieren das Nervensystem laufend über jede Körperstellung. Als Antwort können dann über Nervenbahnen, die Skelettmuskulatur zeihen, allfällige Korrekturen der Körperhaltung vorgenommen werden. Zentrale Bedeutung bei der Steuerung des Gleichgewichts hat dabei das Kleinhirn.
3. Schmecken und Riechen:
Einfache Einzeller meiden Wassergebiete, in denen sich giftige Stoffe befinden. Sie registrieren den chem. Aufbau der Stoffe.
In Wirklichkeit können wir Menschen nur iver Geschmacksqualitäten unterscheiden: süss, sauer, bitter und salzig. Süss wird mit der Zungenspitze empfunden, bitter im hinteren Zungenbereich. Beim Kauen werden durch den Speichel Bestandteile der Nahrung aufgelöst. Sinneszellen in der Zungenhaut werden durch diese Stoffe gereizt und melden die Infos über den Geschmacksstoff an das Gehirn. Ähnliche Sinneszellen gibt es auch in der Nasenschleimhaut, die allerdings auf Gase reagieren. Der Mensch kann 1000e von Gerüchen
wahrnehmen und unterscheiden. Die Sinneszellen der Nase spielen eine wichtige Rolle für die Geschmacksqualität einer Speise. Beim Kauen treten immer auch einige Teilchen der Nahrungsstoffe in die Atemluft und gelangen an die Nasenschleimhaut.
4. Die Haut, Tasten:
Die Haut schliesst unseren Körper nach aussen ab und steht in dauernder Berührung mit unserer Umgebung.
Schon sanfte Berührungen spüren wir mit den Tastkörperchen, die direkt unter der Oberhaut liegen. Sie sind so empfindlich, dass sie schon das geringe Gewicht einer Fliege registrieren. Die Tastkörperchen werden dabei von feinen Härchen unterstützt die aus der Haut ragen und ganz schwache Berührungen durch Hebelwirkung verstärken. Dem Tastsinn dienen auch noch die Lamellenkörperchen, die etwas tiefer liegen. Sie reagieren auf Druckreize.
Wir können sehr viele Infos nur mit dem Tastsinn aus unserer Umgebung gewinnen. Vorallem für Blinde hat er eine grosse Bedeutung, das sie dadurch die Blindenschrift lesen können.
In der Haut finden wir auch freie Nervenendungen ohne besondere Reizaufnahmeeinrichtungen wie z. B. bei den Tastkörperchen. Diese spielen eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung mit der Umwelt: sie melden, ob die Haut irgendeinem gefährlichen oder schädlichen Einfluss ausgesetzt ist. Darauf verarbeitet das Gehirn diese Meldung dann mit der unangenehmen Empfindung Schmerz.
Häufig gestellte Fragen zu DIE SINNESORGANE
Was sind die fünf klassischen Sinne?
Die fünf klassischen Sinne sind Riechen, Schmecken, Tasten, Hören und Sehen.
Wie nehmen Sinneszellen Reize wahr?
Sinneszellen sind auf chemische, mechanische, thermische oder elektromagnetische Reize spezialisiert und arbeiten nach dem Prinzip, dass nur Reize von bestimmter Intensität (Schwellenintensität) und Dauer als elektrische Signale weitergeleitet werden. Sie können sich auch an Reize anpassen (Adaption), wodurch ihre Empfindlichkeit abnimmt.
Was ist Adaption von Sinneszellen?
Adaption bedeutet, dass Sinneszellen ihre Empfindlichkeit für einen Reiz schnell ändern. Bei unverändert starkem Reiz nimmt die Bereitschaft ab, elektrische Signale zu bilden. Ein Beispiel ist, dass ein dauernd ausgesendeter Geruch mit der Zeit kaum mehr wahrgenommen wird.
Welche Arten von Sinneszellen gibt es im Auge?
Das menschliche Auge hat zwei Typen von Sinneszellen: Stäbchen (ca. 120 Mio.) für die Wahrnehmung von Helligkeitsstufen bei Dämmerung und Nacht, und Zapfen (6 Mio.) für scharfes Sehen und Farbkontraste bei Tag.
Was ist der gelbe Fleck im Auge?
Der gelbe Fleck ist die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut und enthält besonders viele Zapfen.
Wie funktioniert der Sehvorgang?
Licht trifft auf die Sinneszellen und zerfällt den Sehfarbstoff (Sehpurpur) in einer chemischen Reaktion. Dieser Reiz löst den Sehimpuls aus. Das Sehpurpur wird dann durch Vitamin A wiederhergestellt. Der Impuls wird an Schalt- und Nervenzellen weitergeleitet und über den Sehnerv ins Gehirn gesendet.
Was ist Akkomodation und Adaption im Zusammenhang mit dem Sehen?
Akkomodation bezieht sich auf die Nah-Fernsichtanpassung des Auges. Adaption bezieht sich auf die Hell-Dunkel-Anpassung, die durch den Irismuskel und die Pupille reguliert wird.
Wie ist das Ohr aufgebaut?
Das Ohr des Menschen und der Säugetiere ist in Innenohr, Mittelohr und Aussenohr gegliedert. Das Innenohr enthält auch das Gleichgewichtsorgan.
Wie funktioniert das Hören?
Schallwellen werden vom äusseren Ohr aufgefangen und zum Trommelfell geleitet. Die Schwingungen des Trommelfells werden durch die Gehörknöchelchenkette des Mittelohrs verstärkt und auf die Flüssigkeit des Innenohrs übertragen, wodurch die Hörsinneszellen im Cortischen Organ erregt werden. Hohe Töne werden am Anfang der Schnecke wahrgenommen, tiefe Töne an der Schneckenspitze.
Wie funktioniert das Gleichgewichtsorgan?
Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr besteht aus zwei sackartigen Gebilden und drei Bogengängen. Die Sinneshaare der Sinneszellen werden bei geradliniger Beschleunigung und Drehbeschleunigungen ausgelenkt und vermitteln dem Gehirn Informationen über die Stellung des Kopfes im Raum.
Welche Geschmacksqualitäten können wir unterscheiden?
Wir Menschen können nur vier Geschmacksqualitäten unterscheiden: süss, sauer, bitter und salzig.
Wie funktioniert der Tastsinn?
Sanfte Berührungen werden von den Tastkörperchen unter der Oberhaut wahrgenommen. Lamellenkörperchen reagieren auf Druckreize. Freie Nervenendigungen melden gefährliche oder schädliche Einflüsse und lösen die Empfindung Schmerz aus.
Wie ist die Verteilung der Sinneskörperchen in der Haut?
Die Sinneskörperchen in der Haut sind nicht gleichmässig verteilt. Es gibt Bereiche mit hoher Dichte (Lippen, Gesichtshaut, Handinnenfläche) und solche mit geringerer Dichte (Rücken).
- Arbeit zitieren
- Andrea Stadler (Autor:in), 2000, Kurze Beschreibung und Definition der fünf Sinnesorgane, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97897