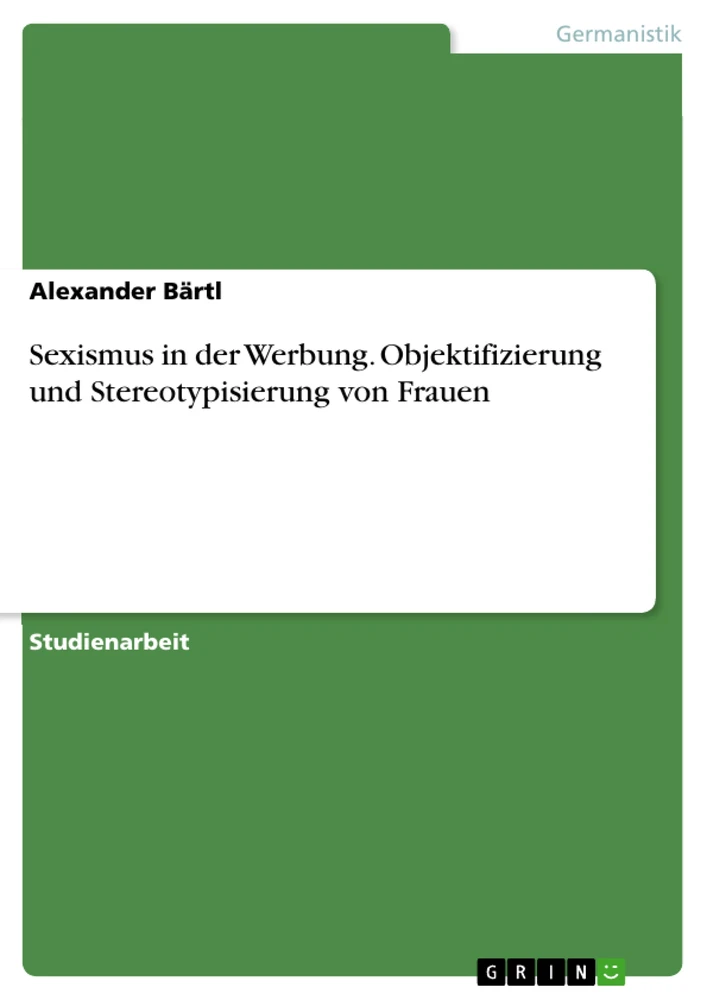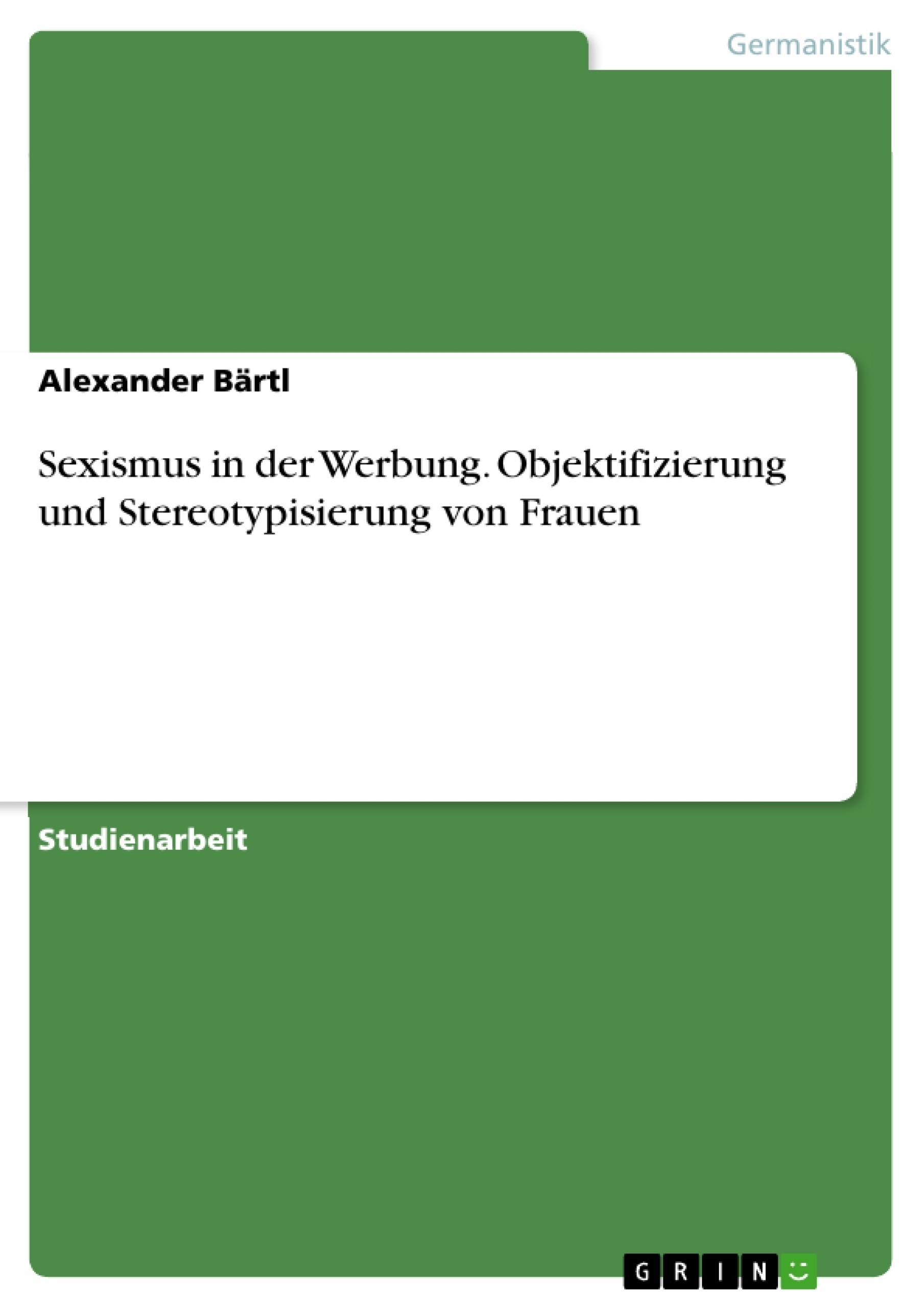In der vorliegenden Arbeit soll den sexistischen Darstellungen in visueller, unbeweglicher Werbung linguistisch nachgegangen werden. Es wird davon ausgegangen, dass sexistische Botschaften sowohl schriftlich als auch materiell-bildlich realisiert werden und dass sich diese durch das Verhältnis zwischen Text und Bild potenzieren lassen. Daher gilt als Forschungsfrage: Wie tritt Sexismus in aktuellen Werbeanzeigen auf? Aufgrund des linguistischen Ansatzes resultieren als weitere Fragen: Welche sprachlichen und bildlichen Mittel werden genutzt? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Welche Rollenbilder und Stereotype werden in den Anzeigen aufgegriffen und gefestigt?
Als Merkmale sexistischer Werbung dient der von der Werbewatchgroup-Wien (2013) aufgestellte Kriterienkatalog. Für die Auswahl der Untersuchungsgegenstände wurde zum einen auf Google nach Schlagwörtern wie "Sexismus in Werbung" oder "Frauenfeindlichkeit in Werbung" gesucht. Aus den Ergebnissen wurde dann eine subjektive Auswahl von Anzeigen getroffen, die bereits bei oberflächlicher Betrachtung sexistische Kriterien erfüllen. Zum anderen diente das Tool Werbemelder.in als Korpus, da davon auszugehen ist, dass dort die Faktoren "Sexismus" und "Aktualität der Anzeige" aufgrund der Zweckmäßigkeit des Tools den Beispielen immanent sind. Jedoch kann bei beiden Vorgehensweisen die Aktualität der Anzeigen nicht garantiert werden, da die Anzeigen oftmals nicht vollständig rückverfolgt werden können und die jeweiligen Unternehmen nicht selten die heftig kritisierten Anzeigen entfern(t)en.
Für die systematische Analyse wird sich an das von Nina Janich (2013) vorgeschlagene Modell ihres praxisorientierten Arbeitsbuches orientiert, das den multimodalen Zugang zur Analyse von Werbung erleichtert. Zudem dient ein an die Analyse vorangehender theoretischer Teil zu Multimodalität nach Hartmut Stöckl (2004, 2016) dazu, die Besonderheiten des Sprache-Bild-Bezugs herauszustellen. Zweck dieser Arbeit ist es also, sich in die Reihe der werbekritischen Abhandlungen einzufügen und mittels eigener Schwerpunktsetzung einen textlinguistischen Zugang für eine multimodale Analyse von sexistischer Werbung zu geben. Die Abgrenzung der Kapitel ist nicht als trennscharf zu betrachten, sodass es thematisch zu Überschneidungen kommen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Multimodalität und Funktion von Werbung
- Die Objektifizierung und Stereotypisierung der Frau
- Die sexistische Metaphorik von „Alte“
- Die Frau als Stück Fleisch
- Der Mann als Held
- Der „perfekte“ Körper als Lebensziel
- Gewalt, Macht und Dominanz des Mannes
- Frauen versus Technik
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht sexistische Darstellungen in visueller Werbung mit einem linguistischen Fokus. Die Hauptziele sind die Analyse der verwendeten sprachlichen und bildlichen Mittel, ihres gegenseitigen Einflusses und die aufgegriffenen Rollenbilder und Stereotype. Die Arbeit fragt nach der Art und Weise, wie Sexismus in aktuellen Werbeanzeigen auftritt und wie sprachliche und bildliche Elemente zusammenwirken, um sexistische Botschaften zu verstärken.
- Multimodale Analyse sexistischer Werbung
- Analyse sprachlicher und bildlicher Mittel in der Werbung
- Rollenbilder und Stereotypen von Frauen und Männern in der Werbung
- Der Einfluss von Text und Bild auf die Wirkung sexistischer Botschaften
- Anwendung eines multimodalen Analysemodells auf Werbeanzeigen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sexismus in der Werbung ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Auftreten von Sexismus in aktuellen Werbeanzeigen. Sie beschreibt die gesellschaftliche Rolle von Werbung bei der Konstruktion von Lebenswirklichkeit und Identität und begründet die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit sexistischen Darstellungen in der Werbung. Die Einleitung legt die Forschungsfragen fest und beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf einem multimodalen Ansatz basiert und den Kriterienkatalog der Werbewatchgroup-Wien verwendet. Die Auswahl der Untersuchungsgegenstände erfolgt mittels Google-Suche und dem Tool „Werbemelder.in“. Die Arbeit zielt darauf ab, einen textlinguistischen Zugang für eine multimodale Analyse sexistischer Werbung zu liefern.
Zur Multimodalität und Funktion von Werbung: Dieses Kapitel beleuchtet die Multimodalität von Werbung nach Stöckl, fokussiert auf Sprache und Bild. Es erklärt die Bedeutung von Zeichenmodalitäten nach Peirce (emotionale, energetische und logische Bedeutung) und deren jeweilige Wirkung in der Werbung. Der Unterschied in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Sprache und Bild wird herausgestellt, wobei die Wirkung von Bildern als aufmerksamkeitslenkend, ganzheitlich und leichter im Gedächtnis verankerbar hervorgehoben wird. Die persuasive und manipulative Funktion von Werbung wird im Kontext der multimodalen Gestaltung diskutiert. Die starke Intentionalität und Inszenierung werblicher Botschaften wird betont.
Schlüsselwörter
Sexismus, Werbung, Multimodalität, Objektifizierung, Stereotypisierung, Geschlechterrollen, Sprachliche Analyse, Bildanalyse, Rollenbilder, Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse sexistischer Werbung
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert sexistische Darstellungen in visueller Werbung mit einem linguistischen Fokus. Sie untersucht die verwendeten sprachlichen und bildlichen Mittel, ihren gegenseitigen Einfluss und die aufgegriffenen Rollenbilder und Stereotype. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Sexismus in aktuellen Werbeanzeigen auftritt und wie sprachliche und bildliche Elemente zusammenwirken, um sexistische Botschaften zu verstärken.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einem multimodalen Ansatz und verwendet den Kriterienkatalog der Werbewatchgroup-Wien. Die Auswahl der Untersuchungsgegenstände erfolgt mittels Google-Suche und dem Tool „Werbemelder.in“. Es wird ein textlinguistischer Zugang für eine multimodale Analyse sexistischer Werbung geliefert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Multimodalität und Funktion von Werbung, ein Kapitel zur Objektifizierung und Stereotypisierung der Frau (inkl. Unterkapiteln zu sexistischer Metaphorik, Frauendarstellung, Männerrollen, dem "perfekten" Körper, Gewalt und Frauen versus Technik) und ein Fazit mit Ausblick.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die multimodale Analyse sexistischer Werbung, die Analyse sprachlicher und bildlicher Mittel, Rollenbilder und Stereotype von Frauen und Männern, den Einfluss von Text und Bild auf die Wirkung sexistischer Botschaften und die Anwendung eines multimodalen Analysemodells.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in die Thematik des Sexismus in der Werbung ein, stellt die Forschungsfrage, beschreibt die gesellschaftliche Rolle von Werbung und begründet die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit sexistischen Darstellungen. Sie legt die Forschungsfragen fest und beschreibt die Methodik der Arbeit.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Zur Multimodalität und Funktion von Werbung"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Multimodalität von Werbung nach Stöckl, fokussiert auf Sprache und Bild. Es erklärt die Bedeutung von Zeichenmodalitäten nach Peirce und deren Wirkung in der Werbung. Der Unterschied in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Sprache und Bild wird herausgestellt, und die persuasive und manipulative Funktion von Werbung im Kontext der multimodalen Gestaltung wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Sexismus, Werbung, Multimodalität, Objektifizierung, Stereotypisierung, Geschlechterrollen, Sprachliche Analyse, Bildanalyse, Rollenbilder, Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Linguistik.
Welche konkreten Beispiele für sexistische Darstellungen werden analysiert?
Die konkreten Beispiele werden nicht im Inhaltsverzeichnis aufgeführt. Die Arbeit analysiert jedoch verschiedene Arten der Objektifizierung und Stereotypisierung der Frau in der Werbung, wie z.B. die sexistische Metaphorik, die Darstellung der Frau als Stück Fleisch, die Darstellung des Mannes als Held und die Thematik des "perfekten" Körpers.
- Quote paper
- Alexander Bärtl (Author), 2020, Sexismus in der Werbung. Objektifizierung und Stereotypisierung von Frauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/977877