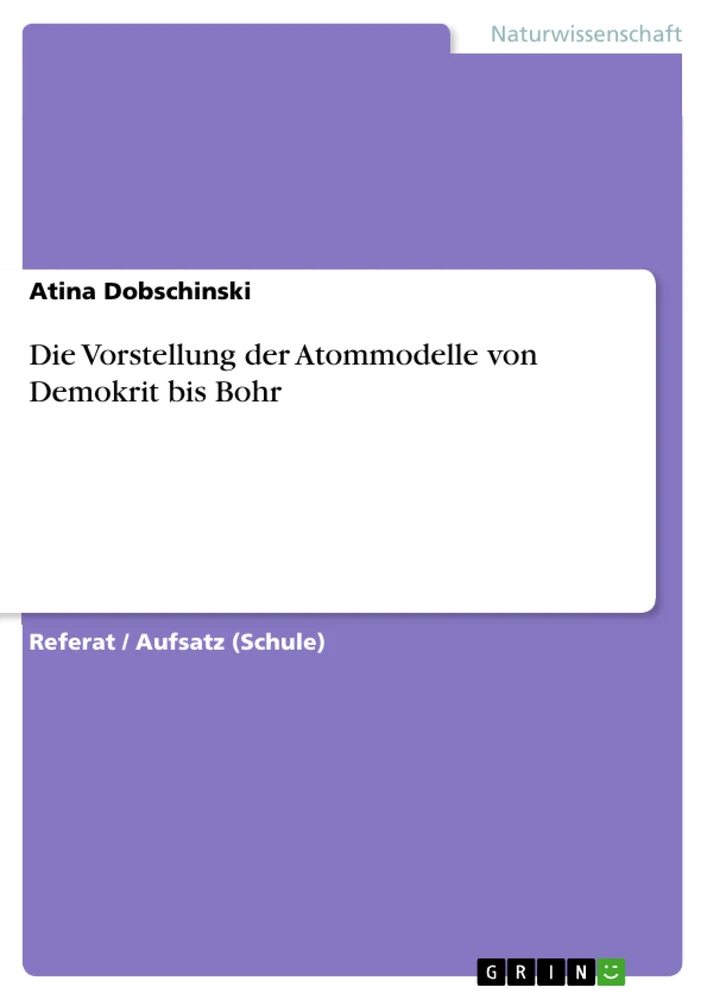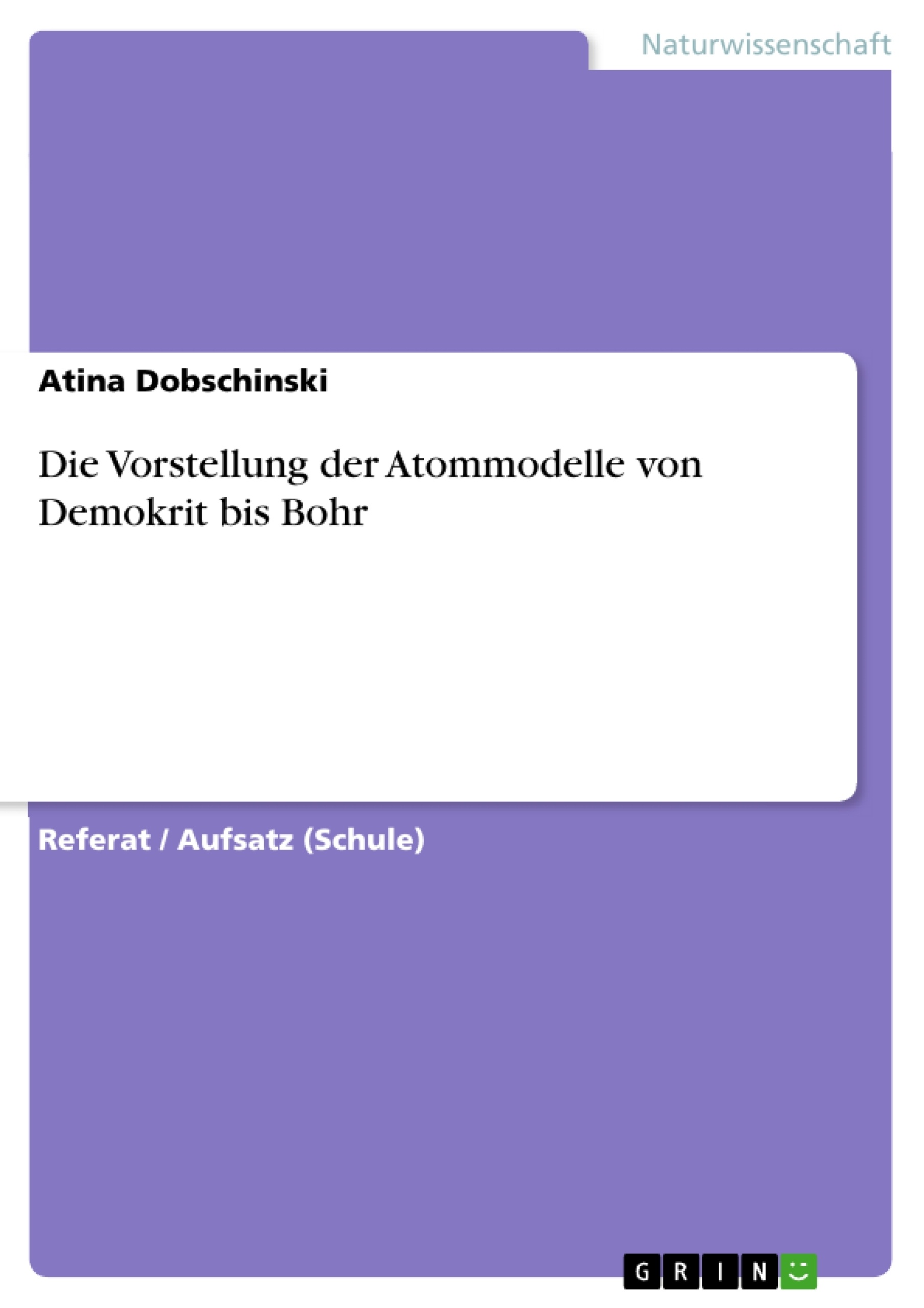Der Atomismus nahm an, dass alle Dinge dieser Welt, auch die immateriellen Dinge (z.B. die Götter), aus verschiedenen, dicht geladenen, unveränderlichen, unsichtbar kleinen und nur in Gastalt und Größe, nicht aber in qualitativ unterscheidbaren Größen, Teilchen bestehen. Insofern nahm der Atomismus die Mittelstellung zwischen der Lehre des Parmendis vom unveränderlichen Sein und der des Heraklit von den ständigen Veränderungen ein. Zahl und Gestalt der Atome galten als unendlich; sie bewegen sich von selbst, aber auch durch sogenannte "Wirbel".
Ca. 600 v. Chr. Behauptete Thales von Milet fest, dass Wasser der Ursprung aller Dinge sei. Dadurch entstanden zum ersten Mal zwei neue entscheidende Grundgedanken, die für die weitere Entwicklung der Atomphysik sehr bedeutungsvoll werden sollte.
1. Der Ursprung aller Dinge wird in etwas materiellem, dem Wasser, gesucht. Dies war für die damalige Zeit neu und ungewöhnlich, da die Menschen nur das walten der mystischen Kräfte sahen.
2. Es tauchte zum ersten mal der Gedanke auf, dass die Welt aus einem einheitlichen Grundstoff besteht.
Seitdem wurde die Frage nach dem Ursprung der erde immer wieder neu gestellt. Auch die Physiker beschäftigten sich immer laufend mit dieser Frage und genau von dieser Wissenschaft kommen die wesentlichen Beiträge zur Klärung der Fragestellung oder ihrer zumindest teilweisen Beantwortung.
Begründer des atomistischen Weltbildes sind die Philosophen Leukipp von Milet (etwa 450 v. Chr.) und sein Schüler Demokrit von Adbera (etwa 460 v. Chr. Bis 370 v. Chr.). Nach Leukipp bestehen alle Stoffe aus einzelnen voneinander abgegrenzten Teilchen, den Atomen, zwischen denen sich leerer Raum befindet. Diese letzten unteilbaren Bausteine sind sämtlich aus dem gleichen Urstoff gebildet und unterscheiden sich lediglich durch ihre Gestalt und Grösse.
Hierdurch sowie durch ihre verschiedene Lage und Anordnung soll nach Leukipp die ganze Vielgestaltigkeit der Wirklichkeit zustande kommen.
Atina Dobschinski
Die Vorstellung der Atommodelle von Demokrit bis Bohr
Der Atomismus nahm an, dass alle Dinge dieser Welt, auch die immateriellen Dinge (z.B. die Götter), aus verschiedenen, dicht geladenen, unveränderlichen, unsichtbar kleinen und nur in Gastalt und Größe, nicht aber in qualitativ unterscheidbaren Größen, Teilchen bestehen. Insofern nahm der Atomismus die Mittelstellung zwischen der Lehre des Parmendis vom unveränderlichen Sein und der des Heraklit von den ständigen Veränderungen ein. Zahl und Gestalt der Atome galten als unendlich; sie bewegen sich von selbst, aber auch durch sogenannte "Wirbel".
Ca. 600 v. Chr. Behauptete Thales von Milet fest, dass Wasser der Ursprung aller Dinge sei. Dadurch entstanden zum ersten Mal zwei neue entscheidende Grundgedanken, die für die weitere Entwicklung der Atomphysik sehr bedeutungsvoll werden sollte.
1. Der Ursprung aller Dinge wird in etwas materiellem, dem Wasser, gesucht. Dies war für die damalige Zeit neu und ungewöhnlich, da die Menschen nur das walten der mystischen Kräfte sahen.
2. Es tauchte zum ersten mal der Gedanke auf, dass die Welt aus einem einheitlichen Grundstoff besteht.
Seitdem wurde die Frage nach dem Ursprung der erde immer wieder neu gestellt. Auch die Physiker beschäftigten sich immer laufend mit dieser Frage und genau von dieser Wissenschaft kommen die wesentlichen Beiträge zur Klärung der Fragestellung oder ihrer zumindest teilweisen Beantwortung.
Begründer des atomistischen Weltbildes sind die Philosophen Leukipp von Milet (etwa 450 v. Chr.) und sein Schüler Demokrit von Adbera (etwa 460 v. Chr. Bis 370 v. Chr.). Nach Leukipp bestehen alle Stoffe aus einzelnen voneinander abgegrenzten Teilchen, den Atomen, zwischen denen sich leerer Raum befindet. Diese letzten unteilbaren Bausteine sind sämtlich aus dem gleichen Urstoff gebildet und unterscheiden sich lediglich durch ihre Gestalt und Grösse.
Hierdurch sowie durch ihre verschiedene Lage und Anordnung soll nach Leukipp die ganze Vielgestaltigkeit der Wirklichkeit zustande kommen.
Demokrit ging noch einen Schritt weiter, indem er annahm, dass die Atome sich im leeren Raum bewegen. Sie können dabei zusammenstoßen, sich vereinigen und sich auch wieder trennen; bei allen diesen Vorgängen bleiben die Atome selbst jedoch erhalten. Gleichzeitig wies Demokrit darauf hin, dass der Mensch nicht in der Lage ist die Atome in ihrer wirklichen Beschaffenheit zu erkennen sondern nur die Wirkung in getrübter Weise erkennen kann. Nach seiner Aussage ist die Wahrnehmung aller Sinne nur Schein und nur die Atome und der leere Raum existieren wirklich. Die damit existierende geometrische Gestalt und die geregelte Bewegung der Atome diente später als Grundlage das mechanischen Weltbildes. Für die von Leukipp und Demokrit folgende Entwicklung der griechischen Naturforschung sind die Ideen der Atomistik jedoch ohne große Wirkung geblieben.
Im Laufe der folgenden Entwicklung ging die Atomvorstellung wieder weitgehend verloren. Zwar wurde sie von Epikur und Lukrez noch einmal aufgegriffen, jedoch herrschten zu dieser Zeit die Gedanken des Aristoteles, in dessen Bereich der Atomismus keinen Platz hatte.
R. Boyle verband als erster den antiken Atombegriff mit den experimentellen
Naturwissenschaften des 17. Jahrhunderts und gelangte zur Vorstellung von aus gleichartigen Atomen bestehenden chemischen Elementen. Der Atomismus dieser zeit besaß ausgesprochen mechanische Züge und suchte z.B. den Zusammenhalt chemischer Verbindungen durch die Annahme besonders gestalteter Atome zu erklären. Erst die von Newton, einem entscheidenden Anhänger des Atomismus, vertretene Auffassung, dass Atome träger von Anziehungskräften seien, änderte zu Beginn des 18. Jahrhunderts den überkommenen Atombegriff ab, und ließ einen "dynamischen Atomismus" entstehen. J. Dalton (1766-1844) knüpfte dann zu Beginn des 19 Jh. An Newtons Vorstellungen an, und fasste die Atome als gleichwertige, kugelförmige Teilchen auf, die sich von Element zu Element nur durch ihr Atomgewicht unterscheiden. Damit begründete er die chemische Atomlehre. Durch die Vielseitigen Erfolge der Atomvorstellung hatten sich die Physiker des vergangenen Jahrhunderts daran gewöhnt, an die Existenz der Atome zu glauben, obwohl es sich hierbei nur um eine Hypothese handelte. Erst kurz nach 1900 konnten dann die ersten experimentellen Beweise für die Realität der Atome erbracht werden. Im Verlauf der weiteren Forschung konnte dann eine Fülle von neuen Erfahrungen gesammelt werden, die sich nur so deuten ließ, dass Atome keineswegs jene letzten unwandelbaren Bausteine der Materie sind, als die sie bis dahin gegolten hatten. Sie erwiesen sich vielmehr als zerstörbar und wandelbar. Es mussten also Erkenntnisse über die Zusammensetzung und den Aufbau der Atome gewonnen werden. Dazu wurden zunächst einfache, dann kompliziertere Atommodelle aufgestellt.
In der kinetischen Gastheorie wird ein besonders einfaches Teilchenmodell verwendet. Man stellt sich die Gasteilchen als kleine hochelastische kugeln vor. 1904 baute Thomson das einfache Kugelmodell aus. Nach seiner Vorstellung besteht ein Atom aus einer homogenen positiv geladenen grunsubstanz, in die punktförmige negative Ladungen, die Elektronen, eingebettet sind.
Lenard gelang es schon 1894 schnelle Elektronen aus einer Entladungsröhre durch eine sehr dünne Aluminiumfolie in die Luft austreten zu lassen. Ihre einige Zentimeter langen bahnen ließen sich mit Hilfe eines Leuchtschirms verfolgen. Dabei zeigte sich, dass die Elektronen kaum aus ihrer ursprünglichen Bahn geworfen wurden. Als er später vom Kugelmodell Thomsons hörte, bemerkte er den Widerspruch, da es unmöglich schien, dass sich die Elektronen durch so dichte Atome drängen konnten. Dies ließ Lenard zu folgender Vereinfachung des Kugelmodells kommen:
In Atomen ist die Masse nicht gleichmäßig verteilt, sondern nur in einem kleinen Teil des Atomvolumens. D,h. das der größte Teil des Volumens praktisch leer ist.
Rutherford fand 1911 die Weiterführung des Lenardschen Atommodells heraus. Er beschoss Metallfolien mit a-Teilchen und stellte fest, dass der überwiegende Teil der Geschosse ohne merkliche Ablenkung und ohne nennenswerten Verlust an kinetischer Energie die Folien durchdringen konnte. Bei einzelnen geschossen konnte rutherford aber auch mehr oder weniger starke Ablenkungen aus der ursprünglichen Richtung feststellen, besonders wenn er Folien aus schwerem Metall benutzte. Gelegentlich wurden sogar einige Teilchen genau entgegengesetzt zur Auftreffrichtung zurückgeworfen.
Aufgrund dieser Ergebnisse entwickelte Rutherford ein neues Atommodell, welches vom Aufbau her folgendes Bild abgibt: Die gesamte positive Atomladung und nahezu die gesamte Atommasse sind auf einen kleinen Bereich von der Grössenmenge 10-14 m im Mittelpunkt des Atoms konzentriert. Dies ist der Atomkern. Da das Atom nach aussen hin neutral ist, muss die positive Kernladung durch eine entsprechende Anzahl von Elektronen kompensiert werden. Diese Elektronen werden durch die Coulumb-Kräfte von dem positiv geladenem Kern angezogen und im Atomverband festgehalten. Damit sie nicht in den Kern hineinstürzen, muss angenommen werden, dass sie sich - ähnlich wie die Planeten um die Sonne- um den Kern bewegen. Da der Durchmesser des Atoms nach früheren Feststellungen von der Grössenordnung 10-10 m ist, müssen die Elektronen sich in einem Abstand von max. rund 10-10 m bewegen. Die Gesamteinheit dieser Elektronen bildet die Atomhülle.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hiernach beträgt der Kerndurchmesser nur rund 1/1000 des Atomdurchmessers. Das bedeutet aber, dass der überwiegende Teil das Atoms leerer Raum ist.
Das Rutherford- Atommodell macht den Durchgang und die Steuung von a-Teilchen durch Metallfolien verständlich. Die a-Teilchen, die dem positiven Kern genügend nahe kommen, werden abgelenkt oder sogar zur Umkehr gezwungen. Durch genaue Messung gelang es sogar die Grösse der Kernladung zu bestimmen.
Jedoch ergaben sich trotzt des Erfolges dieses Atommodells auch Schwierigkeiten, da nach Rutherford das Atom ein recht instabiles Gebilde wäre, das es laufend Energie verlieren würde.
Das bleibende Ergebnis der Rutherfordschen Untersuchung ist die Erkenntnis, dass fast die gesamte Masse auf den kleinen Raum des Atomkerns lokalisiert ist und dass dieser Kern positiv geladen ist.
Die Arbeiten von Rutherford führten zu der Erkenntnis, dass jedes Atommodell zwei wesentlich verschiedene Teile beschreiben muss, die man als
Atomhülle und Atomkern
bezeichnet.
1913 gelang es Niels Bohr das Rutherfordsche Atommodell zu verbessern. Er veröffentlichte folgende Annahme:
Ein Elektron kann nur auf einer bestimmten Bahn um den Atomkern kreisen. Solange es dort verweilt, wird keine Energie abgestrahlt. Es kann allerdings auf eine der anderen Bahnen Übergehen. Dies gelingt nur, wenn ihm die entsprechende Energiedifferenz zum Atomkern
zugeführt wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Die Vorstellung der Atommodelle von Demokrit bis Bohr"?
Der Text beschreibt die Entwicklung der Atommodelle von den antiken Vorstellungen von Demokrit bis zum Modell von Niels Bohr. Er beleuchtet die verschiedenen Theorien und Experimente, die zur Entwicklung unseres heutigen Verständnisses der Atomstruktur geführt haben.
Wer waren die wichtigsten Philosophen und Wissenschaftler, die zur Entwicklung der Atommodelle beigetragen haben?
Der Text nennt unter anderem Demokrit, Leukipp, Thales von Milet, R. Boyle, Isaac Newton, J. Dalton, J.J. Thomson, Philipp Lenard, Ernest Rutherford und Niels Bohr.
Was war die grundlegende Idee des Atomismus nach Demokrit?
Demokrit glaubte, dass alle Stoffe aus unteilbaren Teilchen, den Atomen, bestehen, die sich im leeren Raum bewegen und sich durch ihre Form, Größe und Anordnung unterscheiden.
Welche Bedeutung hatte Thales von Milet für die Entwicklung der Atomphysik?
Thales von Milet postulierte, dass Wasser der Ursprung aller Dinge sei. Dies führte zu der Idee, dass der Ursprung aller Dinge in etwas Materiellem gesucht werden kann und dass die Welt aus einem einheitlichen Grundstoff besteht.
Was war das Atommodell von Thomson?
Thomson stellte sich das Atom als eine homogene, positiv geladene Grundsubstanz vor, in die negativ geladene Elektronen eingebettet sind.
Wie widerlegte Lenard das Atommodell von Thomson?
Lenard führte Experimente durch, bei denen er schnelle Elektronen durch dünne Metallfolien schoss. Er stellte fest, dass die Elektronen kaum abgelenkt wurden, was im Widerspruch zu Thomsons Modell stand, da die Atome nach Thomson relativ dicht sein sollten.
Was war das Atommodell von Rutherford und wie kam er dazu?
Rutherford beschoss Metallfolien mit Alpha-Teilchen und beobachtete, dass die meisten Teilchen ohne Ablenkung durch die Folie hindurchgingen, während einige abgelenkt oder sogar zurückgeworfen wurden. Daraus schloss er, dass die gesamte positive Ladung und fast die gesamte Masse des Atoms in einem kleinen Bereich, dem Atomkern, konzentriert ist, um den sich die Elektronen bewegen.
Welche Schwächen hatte das Atommodell von Rutherford?
Nach dem Rutherford-Modell wäre das Atom ein instabiles Gebilde, das kontinuierlich Energie verlieren würde.
Was war die Verbesserung von Bohr am Rutherfordschen Atommodell?
Bohr postulierte, dass Elektronen nur auf bestimmten Bahnen um den Atomkern kreisen können und keine Energie abstrahlen, solange sie sich auf diesen Bahnen befinden. Sie können nur dann auf eine andere Bahn übergehen, wenn ihnen die entsprechende Energiedifferenz zugeführt wird.
Was sind Atomhülle und Atomkern?
Die Atomhülle beschreibt den Bereich um den Atomkern, in dem sich die Elektronen bewegen. Der Atomkern ist der zentrale, positiv geladene Teil des Atoms, in dem fast die gesamte Masse konzentriert ist.
- Quote paper
- Atina Dobschinski (Author), 2000, Die Vorstellung der Atommodelle von Demokrit bis Bohr, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97695