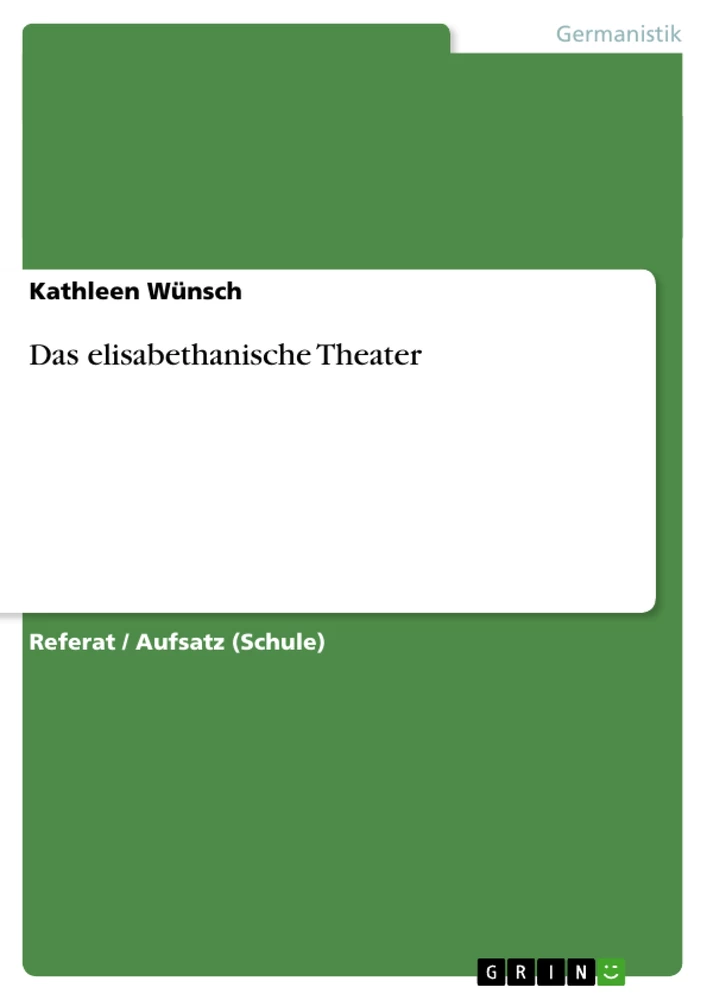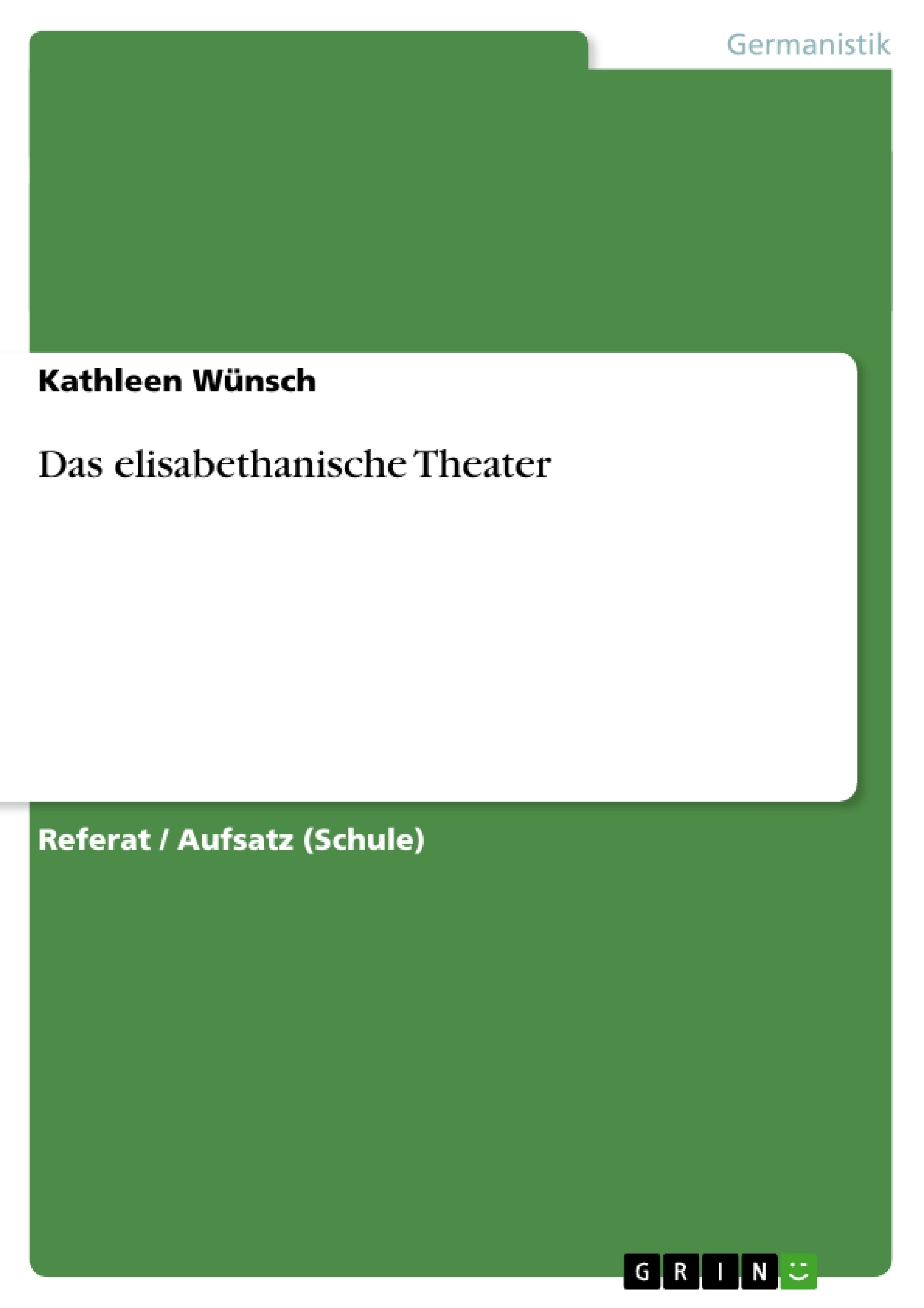Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des elisabethanischen Theaters, eine Epoche, in der London zum pulsierenden Zentrum dramatischer Innovation und gesellschaftlicher Reflexion wurde. Diese Blütezeit des englischen Renaissance-Theaters, von etwa 1570 bis 1625, erlebte die Entstehung legendärer Bühnen wie das Globe, das Rose und das Theatre, Orte, an denen sich Adel und Bürgerliche gleichermaßen versammelten, um in die Tiefen menschlicher Emotionen und historischer Ereignisse einzutauchen. Entdecken Sie, wie sich aus bescheidenen Anfängen, mit wandernden Schauspielertruppen und Aufführungen in Gasthöfen, eine hochprofessionelle Kunstform entwickelte, die von der Krone und dem aufstrebenden Bürgertum gleichermaßen gefördert wurde. Erforschen Sie die einzigartige Struktur dieser Theater, von den offenen Arenen mit ihren einfachen Bühnenbildern bis hin zu den privaten, geschlossenen Häusern, die den Weg für das moderne Theater ebneten. Erleben Sie die Vielfalt der dargebotenen Stücke, von ergreifenden Tragödien über packende Historiendramen bis hin zu urkomischen Komödien, die das Publikum zum Lachen brachten und gleichzeitig moralische und soziale Missstände aufdeckten. Erfahren Sie, wie Meisterdramatiker wie Shakespeare, Marlowe und Jonson das Publikum fesselten, indem sie Unterhaltung mit tiefgründigen Einblicken in die menschliche Natur und die großen Fragen der Existenz verbanden. Analysieren Sie, wie das elisabethanische Theater das Selbstbewusstsein des Bürgertums beflügelte und den Weg für die Aufklärung und den Sturm und Drang ebnete, indem es neue Heldenfiguren schuf und gesellschaftliche Konventionen in Frage stellte. Begeben Sie sich auf eine Reise durch eine Ära, in der das Theater nicht nur ein Ort der Unterhaltung, sondern auch ein Spiegel der Welt und ein Schmelztiegel der Ideen war, ein Ort, an dem jeder Mensch, ob König oder Bettler, seine Rolle im großen Spiel des Lebens fand. Untersuchen Sie die vielfältigen Einflüsse dieser Epoche auf die darstellenden Künste und die anhaltende Bedeutung des elisabethanischen Theaters für unser Verständnis von Kultur, Gesellschaft und der menschlichen Seele.
Das elisabethanische Theater
- Bezeichnung für engl. Renaissance-Theater von ca. 1570-1625 während Regentschaft Elisabeth I. (1558-1603)
Entwicklung: - bereits im frühen 16. Jh. beginnende Professionalisierung der Schauspieler _ Zusammenschluss erwerbsloser Bürger mit bereits berufsmäßigen Künstlern oder Akrobaten zu kleinen, vielseitigen Truppen
- Schutz des Vagabundenlebens durch Schirmherrschaft eines Adligen _ exkl. Vorstellungen
- außerdem öffentl. Schauspiele in Gasthöfen und auf öffentl. Plätzen (z.B. auf Jahrmärkten)
- durch Verschärfung der Gesetze 1572 Untergang zahlreicher Truppen
- übereinstimmende kult. Interessen zw. Krone, Adel und aufstrebendem Bürgertum _ kleine Elite der Schauspieltruppen überlebt und teilweise gesell. Status verbessert
- 1576 erstes feststehendes und öffentl. zugängliches Theatergebäude in London ,,The Theatre"
- in rascher Abfolge weitere Schauspielhäuser - ,,The Rose" 1587, ,,The Swan" 1595, ,,The Globe" 1599 und ,,The Hope" 1613
- Theater außerhalb der Stadt in der Nähe großer öffentl. Parkanlagen oder
Unterhaltungsstätten _ billigere Grundstücke und mehr Platz, Entzug des unmittelbaren Zugriffs der Londoner Stadtverwaltung
- nach 1625 rapider Rückgang des Interesses am Theater _ 1642 durch erwirktes Verbot der Theatergegner vollständig zum Erliegen
- elisabeth. Dramen lange Zeit unbeachtet _ erst im 19. Jh. Rückkehr auf engl. Bühnen Das Innere des Theaters: - öffentl. Theater offen (arenaartig) - Bühne im Hof _ auf Tageslicht angewiesen
- Bühne - relativ große Bretterplattform auf Holzblöcken oder festen Ständern errichtet, Einteilung in Vorder-, Hinter- und Seitenbühne
- vorderer Teil offen, hinterer Teil überdacht _ rückwärtiger Abschluss Wand des Garderobenhauses mit zwei zweiflügeligen Toren für Auftritte und Abgänge und einem breiten Balkon (Loge) darüber
- am oberen, hüttenähnl. Teil des Garderobenhauses Fahne, die anzeigt, dass gespielt wird
- vorwiegend im vorderen Bühnenteil gespielt, Hinterbühne seltener mit Vorhang für sog. gezogene Szene oder Entdeckungszenen genutzt _ durch Ziehen des Vorhangs Offenbarung etwas bisher Unsichtbarem (z.B. einen Lauscher, einen Leichnam auf einer Totenbahre ...)
- Loge für Szenen an erhöhten Orten genutzt (z.B. auf Balkon oder Stadtmauer)
- bei Aufführungen nur wenige Requisiten (z.B. Thronsessel, Tische oder Hocker) keine großartigen Kulissen oder sperrige Aufbauten, um Leuten Sicht nicht zu versperren
- weniger zahlungskräftiges Publikum Stehplätze im Hof - ansonsten über Treppe zu einer der drei Galerien rings um Bühne, für hochrangige Besucher teil in unterer Galerie oder Balkon (wenn nicht benötigt) zur Verfügung · insg. Platz für bis zu 3000 Zuschauer
- ab 1600 Herausbildung privater Theater - kleinere Bühnen in geschlossenen Gebäuden für max. 500 Besucher
(auch öffentl. aber höhere Eintrittspreise) _ Bühne nur auf einer Seite von Zuschauern umgeben, durch künstl. Beleuchtung nicht auf Tageslicht angewiesen · Vorform des heutigen Theaters
Ziele des Theaters: - Zeitvertreib einziger Auftrag an Theater von Seiten jener
Bevölkerungsteile, die es unterstützten _ versch. Unterhaltungselemente, um vielfältige Interessen und Unterhaltungserwartungen zu erfüllen · prächtige Kostüme gegen karge Requisitenausstattung
- instrumentale und gesungene Musik, Tänze, Witzereißer und Liedersänger im Anschluss an eigentl. Vorstellung _ Nachspiel zum Ausklang bis nach 1600 üblich
- ,,Actionszenen" aller Art (z.B. Prügeleien, Fechtpartien, Feldschlachten, Mord und Totschlag)
- Wahnsinn als populäres Unterhaltungselement
- Demonstrationen übersinnlicher Kräfte (z.B. Geister, Hexen und Zauberer)
- meisten Dramatiker Publikum jedoch mehr als verlangt dargeboten _ Unterhaltungselemente zwar Eigenwert doch auch Basis für Ausweitung der allg. Aussage des Stückes durch · Anreicherung der Handlung mit Bedeutung
- genaues Charakterbild der handelnden Personen und Darstellung der Beziehungen zw. ihnen · Auswertung des dargestellten Einzelfalls als Modellfall
- Drama als Grundlage für Auseinandersetzungen mit Grundfragen der individuellen und
gesell. Existenz des Menschen _ Theater komplexe und höchst anspruchsvolle Literaturform Das Publikum: - Zuschauer des elisabeth. Theaters gemischt _ Zusammenschluss versch. Gruppen einer sonst in getrennten Bereichen lebenden Gesellschaft aufgrund ähnlicher kult. Interessen
- im Theater keine soziale Rangordnung - Sitzplätze nur untersch. Preiskategorien
- für eliabeth. Theater typisches, einmalig breites Publikum aller sozialen Schichten
Gattungen des elisabethanischen Theaters: - Gattungssystem wichtig Für Gestaltung des Theaterangebots
- 3 grundlegende Gattungen - jedoch auch Teil- und Mischgattung
- Tragödie - für Engländer der damaligen Zeit Geschichten von hochstehenden Personen, die zu Fall kommen
und ein elendes Ende nehmen _ Lehre an jedermann, nichts als ewig zu betrachten; an
Mächtige, nicht dem Hochmut zu verfallen; an Niedrige, nicht auf Höheres neidisch zu sein - tiefer Fall mögl.
- Vertreter - Shakespeare, Ben Johnson, George Chapman, John Webster
- Historie - Darstellung der nationalen engl. Geschichte besonders durch Störungen der gottgegebenen staatl. Ordnung durch Aufruhr, Krieg und Schuld der Herrschenden _ Feier der eigenen Nation und Festigung des nat. Selbstbildes, Vergegenwärtigung überstandener Notzeiten und Katastrophen
- Vertreter - Shakespeare, Christopher Marlowe
- Komödie - Oberbegriff für alle Stücke, die nicht unter Tragödie oder Historie fallen, in denen am Ende alle
Personen noch am Leben sind, Handlungsverlauf in der Gegenwart und im privaten, nationalen
Raum, Produktion von Gelächter durch Lächerlichmachen von Unsitten und Torheiten _ Nachahmung des Lebens - Vermittlung von Einsichten in Komik menschlicher Natur und menschlicher Verhaltensweisen
- Vertreter - Ben Johnson, Shakespeare
Auswirkungen des elisabethanischen Theaters auf Aufklärung und Sturm und Drang
Aufklärung: - neues, vom bürgerl. Selbstbewußtsein geprägtes Weltbild - Durchbrechen ständischer
Schranken, uneingeschränkte Erkenntnisfähigkeit des Menschen _ bürgerliches Selbstgefühl von England
ausgehend (in Theater keine gesell. Diskriminierung) - wachsende geistige Bedürfnisse des dritten Standes;
Forderung nach bürgerl. Helden, da bürgerl. Publikum mit ihnen eher mitleidet als mit Adligen, und nach
wirklichkeitsgetreuer Handlung und Bühnensprache · in Theatern Komödie als witzige, satirische Zeitkritik;
aus Tragödie bürgerl. Trauerspiel als Anklage gegen die ständischen Gesellschaftsverhältnisse
Vertreter: - Gotthold Ephraim Lessing, Johann Christoph Gottsched, Friedrich Gottlieb Klopstock, Christian
Felix Weiße
Sturm und Drang: - Forderung nach uneingeschränkter Selbstverwirklichung des Individuums durch Kollision
des natürlich empfindenden Menschen mit seiner Umwelt - schöpferische, aktive Helden, die als Kämpfer,
Rächer oder Räuber zum Selbsthelfer werden, Bühnensprache volkstümlich und auf Wesentliches verknappt _
Shakespeare Dramen als Vorbild für bürgerliches Drama, da alle sozialen Schichten auf Bühne dargestellt ·
Trauerspiel als in aktuelles Geschehen eingreifende Form, Tragikomödien als sozial- und moralkritische Sicht
auf Adel und angepaßtes Bürgertum - Verlassen des Theaters mit Gewissheit, dass Volk sich
erheben und
gegen Obrigkeit ankämpfen kann
Vertreter: - Friedrich Schiller, Jakob Michael Reinhold Lenz, Friedrich Maximilian Klinger, Johann Wolfgang
Goethe
,,Das Theater ist ein Spiegel der Welt, weil die ganze Welt Theater ist und jeder Mensch ein Rollenspieler."
Häufig gestellte Fragen zu Das elisabethanische Theater
Was ist das elisabethanische Theater?
Das elisabethanische Theater bezeichnet das englische Renaissance-Theater von etwa 1570 bis 1625 während der Regentschaft Elisabeth I. (1558-1603).
Wie hat sich das elisabethanische Theater entwickelt?
Die Entwicklung begann im frühen 16. Jahrhundert mit der Professionalisierung der Schauspieler. Erwerbslose Bürger schlossen sich mit berufsmäßigen Künstlern oder Akrobaten zu kleinen, vielseitigen Truppen zusammen. Diese Truppen wurden durch die Schirmherrschaft eines Adligen vor dem Vagabundenleben geschützt und gaben exklusive Vorstellungen. Es gab auch öffentliche Schauspiele in Gasthöfen und auf öffentlichen Plätzen, z.B. auf Jahrmärkten. Nach einer Verschärfung der Gesetze im Jahr 1572 gingen viele Truppen unter. Durch übereinstimmende kulturelle Interessen zwischen Krone, Adel und aufstrebendem Bürgertum überlebte eine kleine Elite der Schauspieltruppen und verbesserte teilweise ihren gesellschaftlichen Status. 1576 entstand das erste feststehende und öffentlich zugängliche Theatergebäude in London, ,,The Theatre". In rascher Abfolge folgten weitere Schauspielhäuser wie ,,The Rose" (1587), ,,The Swan" (1595), ,,The Globe" (1599) und ,,The Hope" (1613). Die Theater befanden sich außerhalb der Stadt in der Nähe großer öffentlicher Parkanlagen oder Unterhaltungsstätten, um billigere Grundstücke und mehr Platz zu haben und dem unmittelbaren Zugriff der Londoner Stadtverwaltung zu entgehen. Nach 1625 ging das Interesse am Theater rapide zurück, und 1642 wurde es durch ein erwirktes Verbot der Theatergegner vollständig zum Erliegen gebracht. Elisabethanische Dramen wurden lange Zeit unbeachtet, erst im 19. Jahrhundert kehrten sie auf englische Bühnen zurück.
Wie war das Innere eines elisabethanischen Theaters beschaffen?
Die öffentlichen Theater waren offen (arenaartig) und die Bühne befand sich im Hof, wodurch sie auf Tageslicht angewiesen waren. Die Bühne war eine relativ große Bretterplattform, die auf Holzblöcken oder festen Ständern errichtet wurde und in Vorder-, Hinter- und Seitenbühne eingeteilt war. Der vordere Teil war offen, der hintere Teil überdacht. Der rückwärtige Abschluss war die Wand des Garderobenhauses mit zwei zweiflügeligen Toren für Auftritte und Abgänge und einem breiten Balkon (Loge) darüber. Am oberen, hüttenähnlichen Teil des Garderobenhauses befand sich eine Fahne, die anzeigte, dass gespielt wird. Vorwiegend wurde im vorderen Bühnenteil gespielt, die Hinterbühne wurde seltener mit einem Vorhang für sogenannte gezogene Szenen oder Entdeckungszenen genutzt. Durch Ziehen des Vorhangs wurde etwas bisher Unsichtbares offenbart (z.B. ein Lauscher, ein Leichnam auf einer Totenbahre...). Die Loge wurde für Szenen an erhöhten Orten genutzt (z.B. auf einem Balkon oder einer Stadtmauer). Bei Aufführungen gab es nur wenige Requisiten (z.B. Thronsessel, Tische oder Hocker), keine großartigen Kulissen oder sperrige Aufbauten, um den Zuschauern die Sicht nicht zu versperren. Das weniger zahlungskräftige Publikum hatte Stehplätze im Hof, während man über eine Treppe zu einer der drei Galerien rings um die Bühne gelangte. Für hochrangige Besucher standen teils Plätze in der unteren Galerie oder auf dem Balkon zur Verfügung, wenn dieser nicht für Szenen benötigt wurde. Insgesamt gab es Platz für bis zu 3000 Zuschauer. Ab 1600 entstanden private Theater, kleinere Bühnen in geschlossenen Gebäuden für maximal 500 Besucher (auch öffentlich, aber höhere Eintrittspreise). Die Bühne war nur auf einer Seite von Zuschauern umgeben und war durch künstliche Beleuchtung nicht auf Tageslicht angewiesen – eine Vorform des heutigen Theaters.
Welche Ziele verfolgte das elisabethanische Theater?
Der Zeitvertreib war der einzige Auftrag an das Theater von Seiten jener Bevölkerungsteile, die es unterstützten. Es gab verschiedene Unterhaltungselemente, um vielfältige Interessen und Unterhaltungserwartungen zu erfüllen. Dazu gehörten prächtige Kostüme im Kontrast zu karger Requisitenausstattung, instrumentale und gesungene Musik, Tänze, Witzereißer und Liedersänger im Anschluss an die eigentliche Vorstellung (Nachspiel zum Ausklang bis nach 1600 üblich), ,,Actionszenen" aller Art (z.B. Prügeleien, Fechtpartien, Feldschlachten, Mord und Totschlag), Wahnsinn als populäres Unterhaltungselement und Demonstrationen übersinnlicher Kräfte (z.B. Geister, Hexen und Zauberer). Die meisten Dramatiker boten dem Publikum jedoch mehr als verlangt. Die Unterhaltungselemente hatten zwar einen Eigenwert, waren aber auch die Basis für die Ausweitung der allgemeinen Aussage des Stückes durch Anreicherung der Handlung mit Bedeutung, ein genaues Charakterbild der handelnden Personen und die Darstellung der Beziehungen zwischen ihnen, sowie die Auswertung des dargestellten Einzelfalls als Modellfall. Das Drama diente als Grundlage für Auseinandersetzungen mit Grundfragen der individuellen und gesellschaftlichen Existenz des Menschen. Das Theater war somit eine komplexe und höchst anspruchsvolle Literaturform.
Wie war das Publikum des elisabethanischen Theaters zusammengesetzt?
Das Publikum des elisabethanischen Theaters war gemischt, ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen einer sonst in getrennten Bereichen lebenden Gesellschaft aufgrund ähnlicher kultureller Interessen. Im Theater gab es keine soziale Rangordnung, die Sitzplätze waren lediglich in unterschiedliche Preiskategorien unterteilt. Das elisabethanische Theater zeichnete sich durch ein einmalig breites Publikum aller sozialen Schichten aus.
Welche Gattungen gab es im elisabethanischen Theater?
Das Gattungssystem war wichtig für die Gestaltung des Theaterangebots. Es gab drei grundlegende Gattungen, jedoch auch Teil- und Mischgattungen. Die Tragödie war für die Engländer der damaligen Zeit eine Geschichte von hochstehenden Personen, die zu Fall kommen und ein elendes Ende nehmen. Dies sollte eine Lehre für jedermann sein, nichts als ewig zu betrachten; für Mächtige, nicht dem Hochmut zu verfallen; für Niedrige, nicht auf Höheres neidisch zu sein - da ein tiefer Fall möglich ist. Vertreter waren Shakespeare, Ben Johnson, George Chapman, John Webster. Die Historie stellte die nationale englische Geschichte dar, besonders durch Störungen der gottgegebenen staatlichen Ordnung durch Aufruhr, Krieg und Schuld der Herrschenden. Sie diente der Feier der eigenen Nation und der Festigung des nationalen Selbstbildes, sowie der Vergegenwärtigung überstandener Notzeiten und Katastrophen. Vertreter waren Shakespeare, Christopher Marlowe. Die Komödie war ein Oberbegriff für alle Stücke, die nicht unter Tragödie oder Historie fielen, in denen am Ende alle Personen noch am Leben waren. Der Handlungsverlauf spielte in der Gegenwart und im privaten, nationalen Raum. Ziel war die Produktion von Gelächter durch Lächerlichmachen von Unsitten und Torheiten. Sie sollte die Nachahmung des Lebens darstellen und Einsichten in die Komik menschlicher Natur und menschlicher Verhaltensweisen vermitteln. Vertreter waren Ben Johnson, Shakespeare.
Welche Auswirkungen hatte das elisabethanische Theater auf die Aufklärung und den Sturm und Drang?
Aufklärung: Die Aufklärung war geprägt von einem neuen, vom bürgerlichen Selbstbewusstsein geprägten Weltbild. Es kam zu einem Durchbrechen ständischer Schranken und einer uneingeschränkten Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Das bürgerliche Selbstgefühl ging von England aus (im Theater gab es keine gesellschaftliche Diskriminierung). Es gab wachsende geistige Bedürfnisse des dritten Standes; die Forderung nach bürgerlichen Helden, da das bürgerliche Publikum mit ihnen eher mitleidet als mit Adligen, und nach wirklichkeitsgetreuer Handlung und Bühnensprache. In Theatern fand Komödie als witzige, satirische Zeitkritik statt; aus der Tragödie entstand das bürgerliche Trauerspiel als Anklage gegen die ständischen Gesellschaftsverhältnisse. Vertreter waren Gotthold Ephraim Lessing, Johann Christoph Gottsched, Friedrich Gottlieb Klopstock, Christian Felix Weiße.
Sturm und Drang: Der Sturm und Drang forderte die uneingeschränkte Selbstverwirklichung des Individuums durch die Kollision des natürlich empfindenden Menschen mit seiner Umwelt. Es gab schöpferische, aktive Helden, die als Kämpfer, Rächer oder Räuber zum Selbsthelfer wurden. Die Bühnensprache war volkstümlich und auf Wesentliches verknappt. Shakespeare Dramen dienten als Vorbild für bürgerliches Drama, da alle sozialen Schichten auf der Bühne dargestellt wurden. Das Trauerspiel wurde als in das aktuelle Geschehen eingreifende Form genutzt, Tragikomödien als sozial- und moralkritische Sicht auf Adel und angepasstes Bürgertum. Das Verlassen des Theaters sollte mit der Gewissheit einhergehen, dass das Volk sich erheben und gegen die Obrigkeit ankämpfen kann. Vertreter waren Friedrich Schiller, Jakob Michael Reinhold Lenz, Friedrich Maximilian Klinger, Johann Wolfgang Goethe.
Was bedeutet der Ausspruch ,,Das Theater ist ein Spiegel der Welt, weil die ganze Welt Theater ist und jeder Mensch ein Rollenspieler."?
Dieser Ausspruch war der bekannteste und bedeutendste für die Londoner der elisabethanischen Zeit.
- Quote paper
- Kathleen Wünsch (Author), 2000, Das elisabethanische Theater, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97651