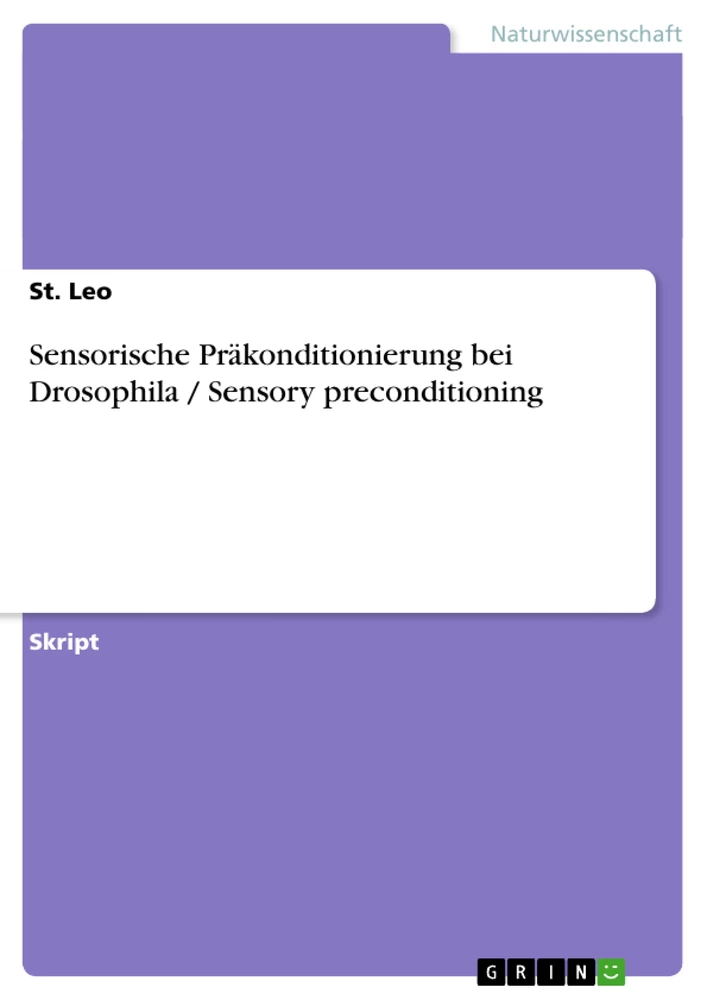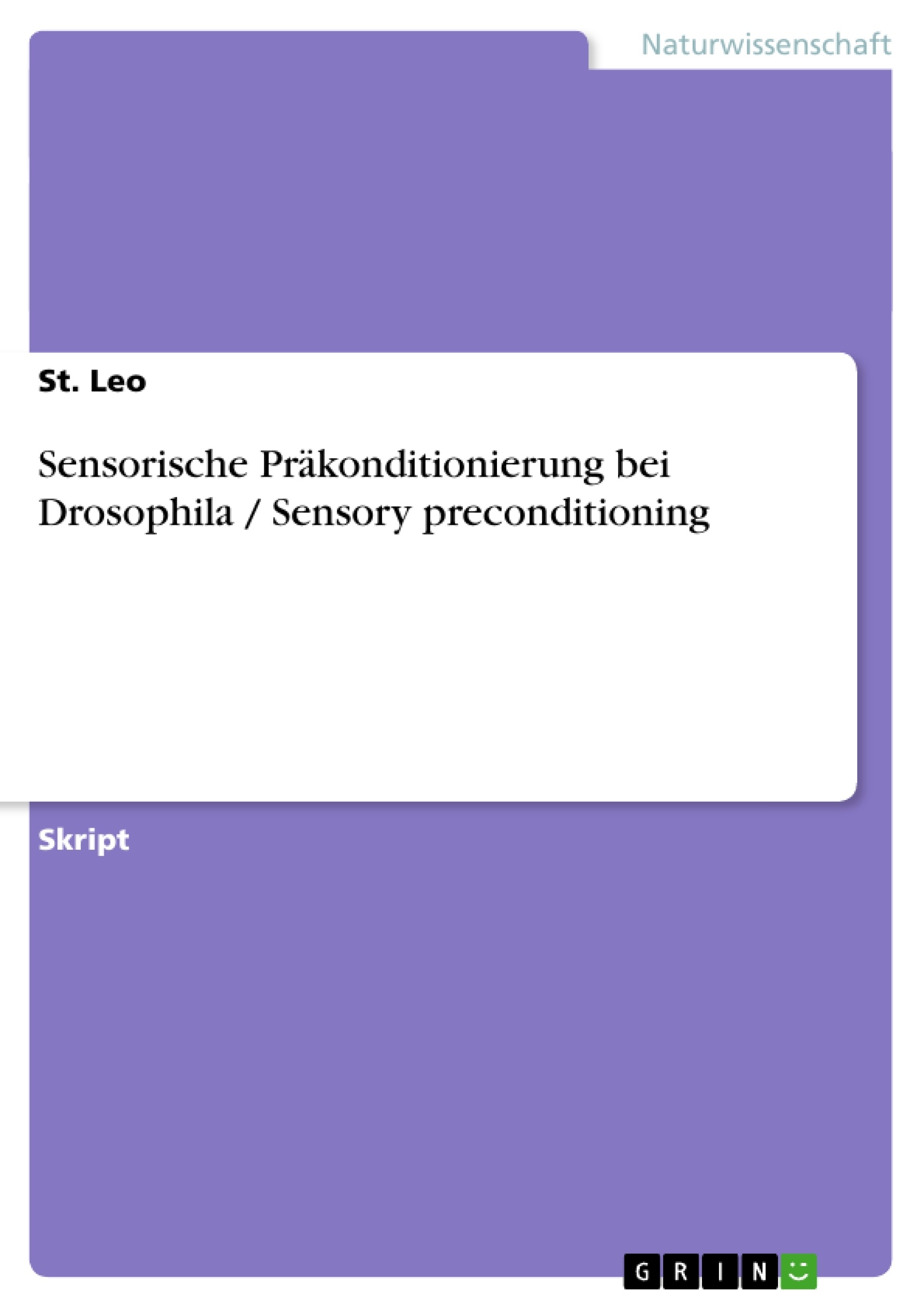Stellen Sie sich vor, die Welt durch die Augen einer Fruchtfliege zu sehen, deren winziges Gehirn komplexe Entscheidungen treffen muss, um zu überleben. Diese faszinierende Studie taucht tief in die Mechanismen des Lernens und der Gedächtnisbildung bei Drosophila melanogaster ein, wobei der Fokus insbesondere auf der sensorischen Präkonditionierung liegt. Können Fliegen lernen, Zusammenhänge zwischen Reizen herzustellen, bevor überhaupt eine Belohnung oder Bestrafung ins Spiel kommt? Die vorliegende Arbeit untersucht diese Frage anhand eines Flugsimulators, in dem die Fliegen operant konditioniert werden, um Muster und Farben zu meiden, die mit einem negativen Reiz assoziiert sind. Die Ergebnisse der Experimente, die verschiedene Versuchsdesigns und Kontrollgruppen umfassen, geben Aufschluss über die Herausforderungen und potenziellen Fallstricke bei der Untersuchung komplexer Lernprozesse in einem Modellorganismus. Obwohl die Ergebnisse keine eindeutige Bestätigung der sensorischen Präkonditionierung liefern, eröffnen sie dennoch interessante Perspektiven auf die neuronalen Grundlagen des assoziativen Lernens und die Bedeutung von Versuchsaufbau und Umweltfaktoren. Die detaillierte Beschreibung der verwendeten Methoden, von der Zucht der Fliegen bis zur statistischen Auswertung der Daten, ermöglicht es dem Leser, die Ergebnisse kritisch zu bewerten und eigene Experimente zu planen. Diese Arbeit ist somit nicht nur ein Beitrag zur Verhaltensforschung, sondern auch eine wertvolle Ressource für Studierende und Wissenschaftler, die sich für die Neurobiologie des Lernens interessieren. Schlüsselwörter: Drosophila melanogaster, Lernen, Gedächtnis, sensorische Präkonditionierung, klassische Konditionierung, operante Konditionierung, Flugsimulator, Verhaltensforschung, Neurobiologie, assoziatives Lernen, Reizverarbeitung, Konditionierung, Genetik, Behaviorismus, Biologie, Zoologie, Neurobiologie des Lernens, invertebrate learning, animal behavior, learning paradigms, olfactory learning, visual learning.
Einleitung
Organismen können ihr Verhalten auf Grund gewonnener Erfahrung verändern, Erlerntes für einen spezifischen Zeitraum speichern und zur Verhaltensoptimierung verwenden. Lernen ist motivations- oder emotionsgesteuert (Wolf, 1988). Notwendig für den Lernprozeß ist das Vorhandensein von Strukturen zur Reizaufnahme, Reizverarbeitung, etc..
Das assoziative Lernen wird in zwei Formen unterschieden.
Die Erste ist die klassische Konditionierung, die Pavlov zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei Konditionierungsversuchen mit Tieren gefunden hat. Ein unkonditionierter Reiz (UCS; z.B. der Anblick von Futter) löste bei Hunden eine unkonditionierte Reaktion (UCR; Speichelfluß) aus. Ein konditionierter Reiz (CS; Ton oder Lichtsignal: ein neutraler Reiz) löst vor dem Experiment keine CR aus. Im Training wird der CS mit dem UCS gekoppelt und im anschließenden Test sollte dann auch der CS das CR-Ereignis auslösen (Wehner und Gehring, 1995).
Die operante Konditionierung („Lernen am Erfolg“) ist eine weitere Form des assoziativen Lernens. Hier wird nicht ein neuer Reiz an ein bestehendes Verhalten gekoppelt, sondern das Verhalten mit der bestehenden Reizsituation in Verbindung gebracht. Wiederholte Lernakte verstärken die Assoziation zwischen Reizsituation und Verhalten (Wehner und Gehring, 1995). Nach Krech und Crutchfield (1992) muß die Konditionierungapparatur so arrangiert sein, daß das Tier erfährt, daß sein Verhalten das US - Ereignis auslösen kann. Das Tier hat also Einfluß auf seine Umwelt in der Form, daß es bei negativem Reinforcer ein bestimmtes Verhalten zu vermeiden versucht oder bei positivem Reinforcer dieses häufiger ausführt. Ein praktisches Beispiel sei die Skinnerbox: eine Ratte soll beim Aufleuchten einer Lampe (CS) einen Hebel betätigen (CR), um Futter als Belohnung zu bekommen. Die Belohnung über das Futter wirkt dabei als Verstärker (positiver Reinforcer) bei der Konditionierung.
Für beide Formen des assoziativen Lernens gilt, daß zwischen einer Situation und einem Verhalten eine Assoziation hergestellt wird, ein CS wird arrangiert, um einen UCS vorherzusagen.
Es gibt neben den einfachen, eindimensionalen Konditionierungsformen (nur ein CS) noch komplexere, mehrdimensionale Konditionierungsformen, bei denen mindestens zwei verschiedene CS eingesetzt werden. Je nach Versuchsdesign können Phänomene wie Blockieren, zweitrangige Konditionierung, Überschatten oder sensorisches Präkonditionieren untersucht werden.
Pavlov demonstrierte sensorische Präkonditionierung erstmals 1931/32 an Mäusen, beschrieben wurde sie jedoch erst 1939 von Brogden ( Kimmel, 1977).
Bei der sensorischen Präkonditionierung wird der Konditionierungsprozeß in zwei Stufen gegliedert. Im ersten Schritt werden zwei neutrale Reize CS1 und CS2 gepaart dem Versuchstier ohne Reinforcer präsentiert, so daß CS1 mit dem CS2 assoziiert werden kann. CS2 wird anschließend im zweiten Schritt mit Reinforcer auf den UCS konditioniert. Der UCS löst dabei die UCR (z.B. Fluchtverhalten) aus. Das Versuchstier weiß in der ersten Stufe nicht, welcher CS mit welchem Ereignis in Stufe zwei gepaart sein wird, sollte also beide gleichwertig behandeln (Morris, 1990). Im Test wird dann geprüft, ob auch der CS1 mit dem UCS assoziiert wird und mit einem entsprechenden Verhalten (UCR) beantwortet wird. Ist dieser Test positiv, war die sensorische Präkonditionierung erfolgreich. Das Versuchstier lernte nicht einfach auf einen Stimulus zu reagieren, sondern verband mehrere Stimuli miteinander (Krech und Crutchfield, 1992).
Zusätzlich zum Konditionierungsversuch sind Kontrollversuche notwendig, die zeigen, daß CS1 und CS2 neutrale, gleichwertige Reize sind und gut konditioniert werden können.
Bei Lernversuchen an Bienen konnte bereits erfolgreich sensorische Präkonditionierung gezeigt werden (Brembs, pers. Mitteilung). Die Erwartung wäre nun, daß auch bei Drosophila zwei neutrale Reize sensorisch präkonditioniert werden können. Dies zu Untersuchen war die Grundlage des Praktikums.
Materialien und Methoden
Versuchstiere
Als Versuchstiere wurden Weibchen der Fruchtfliege Drosophila melanogaster (Wildtyp Berlin, WTB) verwendet.
Als Aufzuchtbehälter dienten auf einer Seite offene Hohlzylinder (d = 5cm, h = 10 cm) aus Plastik. Sie wurden mit einem Schaumstoffstopfen (d = 5cm, h = 3cm) verschlossen. Auf dem Boden des Aufzuchtbehälters befand sich eine ca. 2 cm dicke Schicht Futterbrei (Hefeextrakt). Die Temperatur in der Aufzucht - Klimakammer betrug 25°C (Generationsfolge ca. 10 Tage). Frisch geschlüpfte Jungfliegen wurden in einen neuen Aufzuchtbehälter überführt und am folgenden Tag für den Einsatz am Flugsimulator präpariert.
Die Fliegen benötigten einen Bügel, der die im Flugsimulator wirkenden Flugkräfte der Fliege auf die Meßapparatur überträgt und die Fliege in der Arena arretiert.
Dafür wurde ein Kupferdraht (d = 0,1 mm, l = 5mm) zum Haken gebogen und mit unter UV -
Licht polymerisierendem Klebstoff an der Fliege zwischen Kopf und Thorax befestigt. Es war der Fliege nicht mehr möglich, den Kopf zu bewegen.
Nach dem Kleben wurden die Fliegen einzeln in kleine, zylindrische Gefäße (d = 1cm, h = 3 cm) überführt, auf deren Böden Filterpapierstücke mit Glucoselösung befestigt waren. Am Tag darauf (meist nachmittags) wurden dann die Konditionierungsversuche mit diesen Fliegen durchgeführt. Jede Fliege wurde nur einmal für einen der Versuche eingesetzt. Da die Fliegen in ihren Lernleistungen Schwankungen unterlagen, wurden die vier Experimente nebeneinander durchgeführt, um vergleichbare Ergebnisse zu erreichen.
Versuchsaparatur
Es wurde mit einem Flugsimulator nach M. Heisenberg und R. Wolf (1984) gearbeitet. Per Computer konnte ein Wechselfarbfilter mit den Farben grün und blau mit dem in der Arena gezeigten Muster (ein stehendes T und ein liegendes T) synchronisiert werden. Der grüne Arenahintergrund wurde mit dem T präsentiert und der blaue Arenahintergrund mit dem ^. Der Flugsimulator kann das Drehmoment der Fliege messen. Dieses Drehmoment entspricht der motorischen Reaktion der Fliege auf die auf sie einwirkenden Reize der künstlichen Umwelt in der Arena des Flugsimulators. Als negativer Reinforcer diente ein Infrarotstrahl. Der Flugsimulator lief im „closed loop“- Modus, die Konditionierung war operant.
Statistische Methoden
Mit dem Wilcoxon Matched Pairs - Test des Programmes Statistica‚ 5.0 wurden die in den Versuchen erhaltenen Performence - Indices der Abschlußtests geprüft, ob sie signifikant von einem PI = 0 verschieden sind.
Versuchsplanung
Versuch 1
Es handelt sich um einen Test der prüfen soll, ob die verwendeten CS neutral und unabhängig sind. Es wurden 16 Minuten lang die Farbe- und Musterpaare ohne dem in den Versuchen 2 - 4 verwendeten Reinforcer präsentiert. Im anschließenden zweiminütigen Test wurden nur die Muster gezeigt, um zu prüfen, ob die Farbe als Reinforcer wirkt. Vom Muster - CS läßt sich aus dem Versuch 4 schließen, daß er neutral ist.
Versuch 2
Sensorische Präkonditionierung, CS1 = Farbe, CS2 = Muster
Versuch 3
Sensorische Präkonditionierung, CS1 = Muster, CS2 = Farbe Bei den Versuchen 2 und 3 wurden 16 Minuten lang je grün und T bzw. blau und ^ gemeinsam der Fliege ohne Reinforcer angeboten. Anschließend wurde 2 mal 4 Minuten lang, unterbrochen von einem zweiminütigem Zwischentest, CS2 mit Reinforcer konditioniert. Bei 50 % der Testfliegen wurde die komplementäre Farbe bzw. Muster konditioniert, um Präferenzen auszugleichen (50% der Fliegen im Versuch 2 wurden bestraft, wenn sie auf das T zuflogen und 50% wurden bestraft, wenn sie auf das ^ zuflogen; 50% der Fliegen im Versuch 3 wurden bestraft, wenn sie im grünen Sektor flogen und 50 % wurden bestraft, wenn sie im blauen Sektor flogen). Im 4 Minuten dauernden Abschlußtest wurde der CS1 den Fliegen ohne CS2 und ohne Reinforcer gezeigt. Wenn die sensorische Präkonditionierung erfolgreich war, sollten die Fliegen den in der 1.Phase mit dem CS2 gekoppelten CS1 meiden.
Versuch 4
Wieder ein Kontrollversuch; in einer Standardkonditionierung, in der nur das Muster (T als CS oder ^ als CS) konditioniert wird und der Farbfilter entfernt bleibt, wird geprüft, ob die Tiere auf das Muster (als neutralem CS) operant konditioniert werden können.
Ergebnisse
Versuch 1 [16' C + P : 2' P (no heat, only test)]
Die Dateien mit den Meßdaten der Konditionierung geben Auskunft über das Datum und die laufende Nummer des Testes (0302-07 entspricht dem 07. Tagesversuch am 03.02.1999). Die Datensätze wurden mit dem DFS - Programm ausgewertet und gemittelt. Der Performance - Index PI gibt die Bevorzugung einer Flugrichtung im Bezug auf das nicht bestrafte Muster in der Arena an. Er berechnet sich nach der Gleichung :
(Wolf, 1999)
tc entspricht der Aufenthaltszeit im nicht bestraften Sektor und th der Aufenthaltszeit im heißen, also bestraften Sektor. Der PI entspricht im Konditionierungsversuch dem Lernerfolg. Im Vortest kann der PI die Präferenz der Fliege für ein bestimmtes Muster erkennbar machen. Der Fehlerbalken im Diagramm zeigt den Standardfehler (SEM) an.
Datensätze des Versuches 1:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 1.1
In der Grafik 1.1 sind die Ergebnisse des 1. Versuches dargestellt. Es ist zu sehen, daß die gemittelten Fliegen (unter Beachtung des Fehlerbalkens) sich im PI des Testes (Minuten 16 bis 18 im Versuchsablauf) nicht erheblich von dem PI der Konditionierungsphase (Minuten 0 bis 16) abheben. Die Fliegen zeigten jedoch eine leichte Präferenz für die grüne Farbe. Die Stärke dieser Präferenz wurde vom Berechnungsprogramm berücksichtigt und ausgeglichen. Zum Vergleich sind in den Grafiken 1.2 und 1.3 die Versuchsergebnisse von grün und blau bei deaktiviertem Reinforcer getrennt ausgewertet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 1.2 (T/gn ~)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 1.3 (^/bl ~)
An den positiven PI - Werten in Grafik 1.3 ist zu erkennen, daß die Fliegen die grüne Farbe (0° und 180°) gegenüber der blauen Farbe (90° und 270°, Reinforcer inaktiv) bevorzugten. Grafik 1.2 zeigt das umgekehrte Bild, da von einem Reinforcer (inaktiv) bei 0° und 180° ausgegangen wurde. Grün ist wieder die bevorzugte Farbe.
Versuch 2 (P+C : C : P)
Datensätze des Versuches 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 2
In Grafik 2 sind die Ergebnisse des 2. Versuches zu sehen. Es wurde versucht, die Fliegen sensorisch zu Präkonditionieren. Es ist gut zu sehen, daß die Fliegen den bestraften Sektor im zweiten Teil der Konditionierung (rote Darstellung in Grafik 2) mieden und im kurzen Zwischentest (Minuten 20 bis 22) diese Reaktion trotz fehlendem UCS beibehielten. Im Nachtest (Minuten 26 bis 30) fehlt jedoch eine deutliche Assoziation vom CS1 (Muster) mit CS2 (Farbe). Der niedrige PI von 0,247 im Zwischentest (Minuten 20 bis 22) zeigt ein allgemein schlechtes Lernen an, obwohl die Hitzevermeidung im Training (rot) mit einem PI ª 0,6 gut war.
Versuch 3 (C+P : P : C)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 3.1
Grafik 3.1 zeigt die Ergebnisse der sensorischen Präkonditionierung des Versuches 3. Bis auf Ausnahmen (vgl. Grafik 3.2) zeigten auch hier die Fliegen gutes Vermeiden des bestraften Sektors, jedoch ist das Lernergebnis im Abschlußtest sehr schlecht.
In Grafik 3.2 wurden einige Fliegendaten selektiv ausgewertet, um zu zeigen, daß in diesem Versuch schlechtes Vermeiden der Hitze die Ergebnisse beeinflußt haben könnte.
Datensätze der schlecht vermeidenden Fliegen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 3.2
Versuch 4 (Kontrolle, nur Muster) Datensätze des Versuches 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik 4
In Grafik 4 sind die Ergebnisse des Kontrollversuches dargestellt. Die Fliegen sind sehr gut auf das Muster konditionierbar (PI > 0,6). Das T wurde von den Fliegen dem ^ gegenüber nicht bevorzugt..
Statistische Auswertung
Versuch 1
Ein Test des höchsten PI ergab mit einem p = 0,23 kein signifikantes Abweichen von Null.
Versuch 2
Der PI des Zwischentestes war mit einem p = 0,05 signifikant von Null verschieden und der PI des ersten Schlußtestes (Minuten 26 bis 28) zeigte mit p = 0,29 keine Signifikanz.
Versuch 3
Der PI des Zwischentestes war mit einem p = 0,002 signifikant von Null verschieden und der PI des ersten Schlußtestes zeigte mit p = 0,17 keine Signifikanz.
Versuch 4
Der PI des Zwischentestes war mit einem p = 0,09 nicht signifikant von Null verschieden und der PI des ersten Schlußtestes zeigte mit p = 0,0003 eine Signifikanz.
Diskussion
Wie aus den Daten der Versuche und deren statistischer Auswertung zu sehen ist, ist die sensorische Präkonditionierung nicht erfolgreich gewesen. Da es aber bereits gelungen ist, Drosophila sensorisch zu präkonditionieren (Brembs, pers. Mitteilung) lagen die Fehler vermutlich im Versuchsaufbau bzw. der Durchführung. Es gab Tage, an denen die Fliegen so passiv waren, daß sie kaum auf den Reinforcer reagierten. Auch eine schlechte Einstellung der Infrarotquelle kann durch eine für einen Reinforcer zu schwache Strahlung die Versuche stören. Beide sensorischen Präkonditionierungs - Versuche zeigen aber ansatzweise ein Lernen der CS1
- CS2 Verknüpfung.
So sei hier noch auf die von Brembs (1999) erzielten Ergebnisse zu verweisen, die aussagen, daß die Kombination CS1 = Muster und CS2 = Farbe (entspricht hier dem Versuch 2) erfolgreich sensorisch präkonditioniert werden kann. Im Fall CS1 = Farbe und CS2 = Muster fand keine Assoziation statt, was darauf deuten könnte, daß Farbe ein wichtigerer Reiz als das Muster ist, also im Nachtest eine für die Fliege „neue“ Situation entsteht. Durch die Farbe verliert die Fliege dann die gespeicherte Musterkonditionierung (vgl. auch Blocking - Experimente, Brembs, 1999).
Literatur
- R. Wolf und M. Heisenberg, Vision in Drosophila, Springerverlag 1984
- R. Wolf 1999, www.biozentrum.uni-wuerzburg.de/reinhardwolf/explanat.htm · B. Brembs 1999, http://brembs.net/lerning/
- Krech und Crutchfield u.a., Grundlagen der Psychologie, Band III: Lern und Gedächtnispsychologie, Psychologie Verlags Union, Weinheim 1992
- H. D. Kimmel, Notes from „Pavlov`s Wednesdays“: Sensory preconditioning, American Jurnal of Psychology, June 1977 vol 90 No.2 319-332
- G. Wolf, BI - Lexikon Neurobiologie, Bibliographisches Institut Leipzig 1988
- R. Wehner und W. Gehring, Zoologie, Thieme Verlag Stuttgart, New York 1995
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Studie?
Die Studie untersucht die sensorische Präkonditionierung bei Drosophila melanogaster (Fruchtfliege). Ziel ist es, zu überprüfen, ob zwei neutrale Reize (Farbe und Muster) von den Fliegen assoziativ verknüpft werden können.
Was ist klassische Konditionierung?
Klassische Konditionierung ist eine Form des assoziativen Lernens, bei der ein unkonditionierter Reiz (UCS), der eine unkonditionierte Reaktion (UCR) auslöst, mit einem konditionierten Reiz (CS) gekoppelt wird. Nach wiederholter Koppelung löst der CS die CR aus.
Was ist operante Konditionierung?
Operante Konditionierung ist eine weitere Form des assoziativen Lernens, bei der ein Verhalten mit einer Reizsituation in Verbindung gebracht wird. Wiederholte Lernakte verstärken die Assoziation zwischen Reizsituation und Verhalten. Das Tier lernt, ein bestimmtes Verhalten auszuführen oder zu vermeiden, um positive oder negative Konsequenzen zu erzielen.
Was ist sensorische Präkonditionierung?
Bei der sensorischen Präkonditionierung werden in einem ersten Schritt zwei neutrale Reize (CS1 und CS2) gepaart präsentiert, so dass eine Assoziation zwischen ihnen entsteht. Im zweiten Schritt wird CS2 mit einem UCS konditioniert. Ziel ist es, zu prüfen, ob CS1 später auch die durch den UCS ausgelöste Reaktion (UCR) hervorrufen kann, obwohl CS1 nie direkt mit dem UCS gekoppelt wurde. Dies würde zeigen, dass die Fliegen die beiden Reize miteinander verbunden haben.
Welche Materialien und Methoden wurden in der Studie verwendet?
Es wurden Weibchen der Fruchtfliege Drosophila melanogaster (Wildtyp Berlin, WTB) verwendet. Die Fliegen wurden in einem Flugsimulator nach M. Heisenberg und R. Wolf (1984) trainiert. Als Reinforcer diente ein Infrarotstrahl. Die Konditionierung war operant.
Wie war der Versuchsaufbau?
Es gab vier Versuche:
- Versuch 1: Test der Neutralität und Unabhängigkeit der CS (Farbe und Muster)
- Versuch 2: Sensorische Präkonditionierung, CS1 = Farbe, CS2 = Muster
- Versuch 3: Sensorische Präkonditionierung, CS1 = Muster, CS2 = Farbe
- Versuch 4: Kontrollversuch; Standardkonditionierung mit nur dem Muster
Was sind die Ergebnisse der Studie?
Die sensorische Präkonditionierung war in den Versuchen nicht erfolgreich. Die Fliegen konnten aber gut auf das Muster im Kontrollversuch konditioniert werden.
Was sind mögliche Gründe für das Ausbleiben der sensorischen Präkonditionierung?
Mögliche Fehlerursachen könnten im Versuchsaufbau oder der Durchführung liegen. Dazu gehören passive Fliegen, eine schlechte Einstellung der Infrarotquelle oder die unterschiedliche Bedeutung von Farbe und Muster als Reize.
Was sind die Schlussfolgerungen aus der Studie?
Obwohl die sensorische Präkonditionierung in diesem Experiment nicht erfolgreich war, deuten die Ergebnisse auf einen möglichen Lerneffekt der CS1-CS2 Verknüpfung hin. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Farbe als CS wichtiger sein könnte als das Muster.
- Quote paper
- St. Leo (Author), 1999, Sensorische Präkonditionierung bei Drosophila / Sensory preconditioning, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/97217