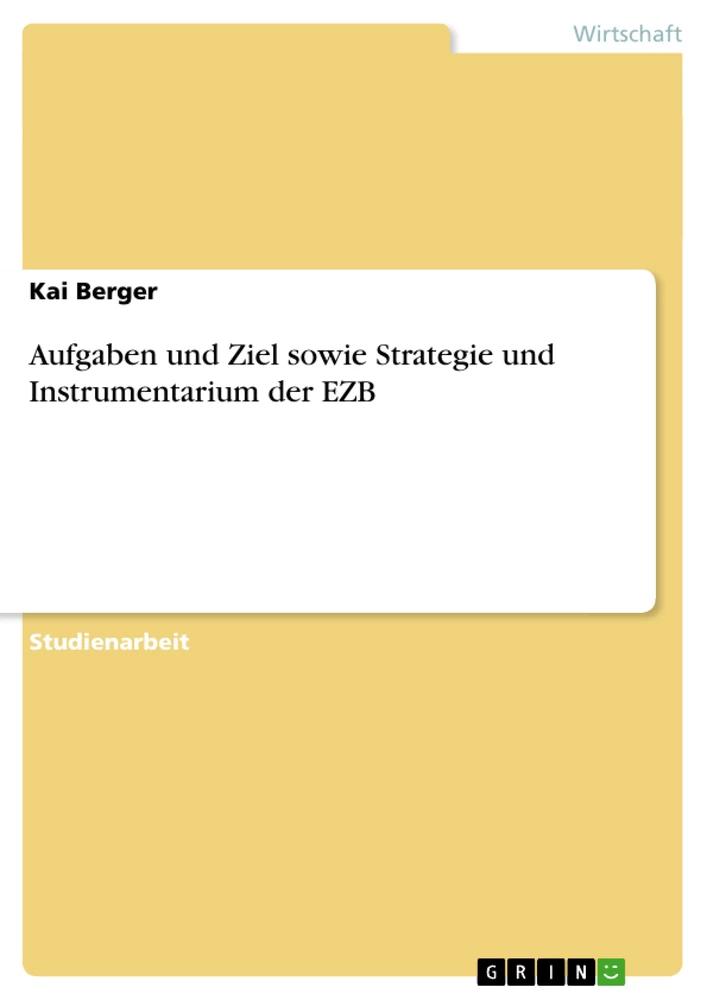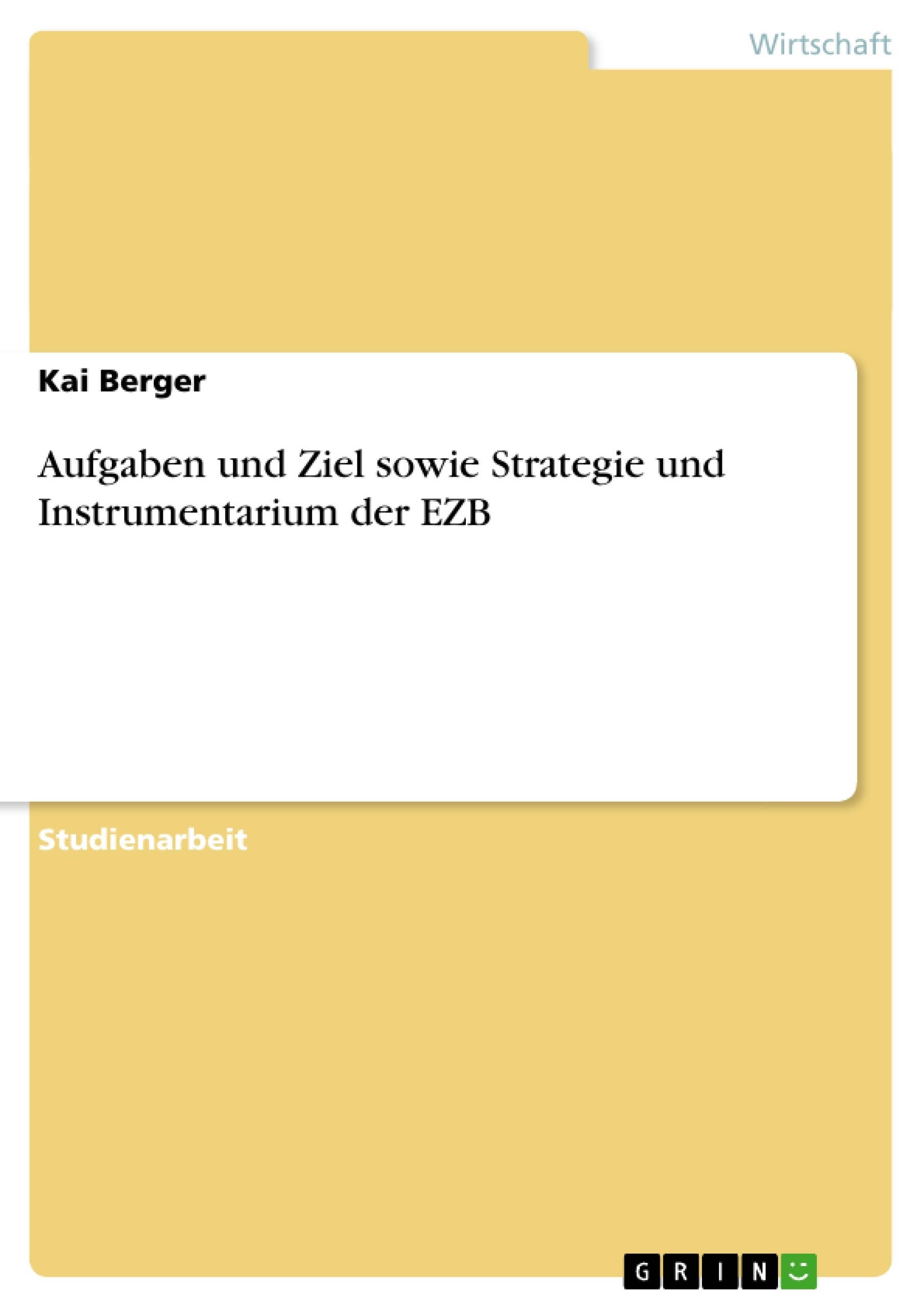Wie beeinflusst die Europäische Zentralbank (EZB) unser tägliches Leben? Tauchen Sie ein in die komplexe Welt der europäischen Geldpolitik und entdecken Sie die Mechanismen, mit denen die EZB die Stabilität des Euro und die Wirtschaft im Euroraum sichert. Diese umfassende Analyse beleuchtet die Ziele, Aufgaben und Funktionen der EZB, von der Gewährleistung der Preisstabilität bis zur Förderung reibungsloser Zahlungsverkehrssysteme. Erfahren Sie mehr über die geldpolitische Strategie der EZB, einschliesslich der berühmten "Zwei-Säulen-Strategie" und der Bedeutung von Geldmengenzielen. Verstehen Sie die geldpolitischen Instrumente, die der EZB zur Verfügung stehen, wie Offenmarktgeschäfte, ständige Fazilitäten und Mindestreserven, und wie diese Instrumente eingesetzt werden, um die Inflation zu kontrollieren und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Untersuchen Sie die Rolle der EZB als "Bank der Banken" und ihre Auswirkungen auf die Kreditversorgung und den Geldumlauf in der Eurozone. Kritische Betrachtungen der EZB-Politik, einschliesslich der Debatte über die Priorisierung der Preisstabilität gegenüber anderen wirtschaftspolitischen Zielen wie der Vollbeschäftigung, bieten einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen und Kompromisse, mit denen die EZB konfrontiert ist. Diese Analyse ist unerlässlich für alle, die ein tiefes Verständnis der Funktionsweise der EZB und ihrer Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft suchen. Entdecken Sie, wie die EZB durch ihre Entscheidungen die Zukunft des Euro und die finanzielle Stabilität Europas prägt. Erhalten Sie Einblicke in die Feinheiten der europäischen Geldpolitik, von den geldpolitischen Instrumenten bis hin zu den strategischen Zielen, die die Entscheidungen der EZB leiten. Diese aufschlussreiche Erkundung der Europäischen Zentralbank bietet eine detaillierte Analyse ihrer Rolle bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Landschaft Europas. Schlüsselwörter: Europäische Zentralbank, EZB, Geldpolitik, Euro, Preisstabilität, Inflation, Geldmenge, Offenmarktgeschäfte, Zinsen, Mindestreserve, Europäische Währungsunion, Finanzstabilität, Konjunktur, Wirtschaftspolitik, geldpolitisches Instrumentarium, europäische Integration. Diese tiefgehende Untersuchung bietet Lesern ein klares Verständnis der komplexen Kräfte, die die europäische Wirtschaft antreiben.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Ziele, Aufgaben und Funktion der Europäischen Zentralbank (EZB)
1.1. Ziele der EZB
1.2. Aufgaben und Funktionen der EZB
2. Die geldpolitische Strategie der EZB
2.1. Der Weg zur endgültigen Strategie
2.2. Die „Zwei-Säulen-Strategie“ der EZB
2.3. Notwendigkeit der Definition von Zwischenzielen
2.4. Geldmengenziel als Zwischenziel
3. Geldpolitische Instrumente
3.1. Offenmarktgeschäfte
3.2. Ständige Fazilitäten
3.2.1. Spitzenrefinanzierungsfazilität
3.2.2. Einlagefazilität
3.3. Mindestreserve
3.4. Zentralbankfähige Sicherheiten
4. Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Einleitung
Mit dem Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) liegt seit dem 1.1.1999 die geldpolitische Verantwortung für elf EU- Teilnehmerstaaten beim Europäischen System der Zentralbanken (ESZB). Das ESZB besteht aus der am 1.6.1998 gegründeten Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken der EU, wobei die Zentralbanken der nicht dem Euro-Währungsraum angehörenden Mitgliedsstaaten der EU nicht an der Entscheidungsfindung hinsichtlich der einheitlichen Geldpolitik und der Umsetzung dieser Entscheidungen teilnehmen.
Aufgrund der strukturellen Unterschiede - unterschiedliche Bankensysteme, verschiedene geldpolitische Strategien und ungleiche Konjunkturverläufe - innerhalb der elf souveränen Staaten der Europäischen Währungsunion (EWU) stand und steht Europa vor einem einzigartigen integrationspolitischen Vorhaben.
Aus der Tatsache, daß Wirkungsverzögerungen zwischen den Maßnahmen und Entscheidungen des ESZB und den entsprechenden Zielen unvermeidbar sind, ergibt sich, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erfolg der EZB und ihrer Maßnahmen noch nicht wirklich beurteilt werden kann, da sie erst seit Anfang 1999 für die Geldpolitik verantwortlich ist.
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den/dem Ziel(en), der Aufgaben, der Strategie und denen der EZB zur Verfügung stehenden geldpolitischen Instrumenten. Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen diese Punkte nacheinander vorgestellt und erläutert werden.
1. Ziele, Aufgaben und Funktion der Europäischen Zentralbank
1.1. Ziele der EZB
Vorrangiges Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) ist gemäß Artikel 105 ihrer Satzung die Gewährleistung der Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet. Preisstabilität wird „als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex für das Euro-Währungsgebiet von unter 2% gegenüber dem Vorjahr“ definiert. Der Präsident der EZB, Willem F. Duisenberg betont ausdrücklich, daß dieser Wert auch „eindeutig die Obergrenze“ der Inflationsrate darstellt und daß auch Deflation mit der Definition von Preisstabilität nicht vereinbar sei1.
Weiterhin heißt es in der Satzung, daß das ESZB, soweit das Ziel der Preisstabilität hiervon nicht beeinträchtigt wird, die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft unterstützt, um zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft beizutragen.
1.2. Aufgaben und Funktionen der EZB
In Artikel 3 der ESZB-Satzung sind die grundlegenden Aufgaben des ESZB festgelegt:
- die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen,
- Devisengeschäfte durchzuführen,
- die offiziellen Währungsreserven der teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu halten und zu verwalten
- das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern, und
- zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen beizutragen.
Eine wichtige Aufgabe der EZB ist es auch, der Öffentlichkeit Rechenschaft über ihre Politik abzulegen und die ergriffenen Maßnahmen und Entscheidungen zu begründen. Die wichtigsten Ergebnisse der Beratungen des EZB-Rates werden nach jeder Sitzung im Rahmen einer Pressekonferenz oder durch schriftliche Kommuniqués mitgeteilt, um dem Grundsatz der
Transparenz zu entsprechen. Diese Form der Kommunikation unterstützt die Glaubwürdigkeit der EZB in der Öffentlichkeit und auf den Märkten und trägt „erheblich zur Stabilisierung der Erwartungen bei“2.
Die Europäische Zentralbank hat verschiedene Funktionen inne:
- Sie ist die erstens die Bank der Union. Gemäß Art. 21.2 ESZB-Satzung ist sie "fiscal agent" und wird "für die Organe und Einrichtungen der Union, die Zentralregierungen, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts und öffentliche Unternehmen der Mitgliedsstaaten tätig". Dies ist jedoch durch die Bestimmung, keine Kredite an öffentliche Stellen zu vergeben, um Finanzierungen von Schulden öffentlicher Einrichtungen zu verhindern, erheblich eingeschränkt.
- Zweitens ist die EZB die Bank der Banken in ihrer Eigenschaft als letzte Refinanzierungsquelle der Geschäftsbanken. Die Europäische Zentralbank steuert den Geldumlauf und die Kreditversorgung des gesamten Banksystems in der Union.
- Drittens hat sie das zentrale Notenausgaberecht. Die nationalen Zentral- banken werden zwar weiterhin befugt sein, Banknoten auszugeben, jedoch in Abhängigkeit vom Genehmigungsverfahren der Europäischen Zentralbank.
- Viertens ermöglicht Art. 105 EG-Vertrag eine Mitwirkung der Europäischen Zentralbank in der Bankenaufsicht.
2. Die geldpolitische Strategie der EZB
Bei der Festlegung einer gemeinsamen geldpolitischen Strategie für elf souveräne Staaten mußten viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Eine neue, gemeinsame Politik muß den geld- und wirtschaftspolitischen Bedürfnissen möglichst aller teilnehmenden Staaten gerecht werden und so auch das psychologisch notwendige Vertrauen gegenüber der neuen Institution schaffen.
2.1. Der Weg zur endgültigen Strategie
Im Vorfeld der Gründung der EZB untersuchte ihr Vorgänger, das Europäische Währungsinstitut, fünf mögliche Strategien. Nach intensiver Prüfung wurden verschiedene Strategien wie die Wechselkurs-, Zins- oder Einkommensorientierung als nicht sinnvoll erachtet3. Übriggeblieben sind zwei Eckpfeiler, die nun auch von der EZB berücksichtigt werden.
2.2. “Zwei-Säulen-Strategie“ der EZB
Die geldpolitische Strategie der EZB stützt sich insbesondere auf zwei „Säulen“:
Die ersten dieser Säulen ist die Geldmengensteuerung, der eine herausragende Rolle zugeschrieben wird. Dies zeigt sich in der Festlegung eines quantitativen Referenzwertes für das Wachstum des monetären Aggregats M3. Unter der Geldmenge M3 versteht man die Summe aus dem Bargeldumlauf, Sichteinlagen, Termineinlagen mit einer Befristung unter vier Jahren und Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist.
Wenn das Wachstum des Bruttosozialproduktes mit der Entwicklung der umlaufenden Geldmenge nicht schritthalten kann, erhöht sich die Gefahr einer steigenden Inflationsrate. Die EZB versucht deshalb auch, die Geldmenge in einem von ihr vorgegebenen Rahmen zu halten. Der erste Referenzwert für das Wachstum von M3 wurde im Dezember 1998 auf 4,5% festgelegt. Dieser Wert wird aus der Beziehung zwischen Geldmengenwachstum einerseits und der Entwicklung der Preise, des realen BIP und der Einkommensumlaufgeschwindigkeit andererseits abgeleitet. Die Ableitung ergibt sich aus der in 1.1. genannten Definition von Preisstabilität und den folgenden Annahmen:
- mittelfristige Wachstumsrate des realen BIP von 2 bis 2,5%
- mittelfristige Verringerung der Einkommensumlaufgeschwindigkeit von M3 um ca. 0,5 bis 1% p.a.
Das mittelfristige Wachstum der realen Bruttoinlandsproduktes entspricht der Entwicklung des realen Produktionspotentials. Somit ist eine Analogie zur Zielableitung der Deutschen Bundesbank gegeben.
Das Verhältnis zwischen tatsächlichem monetären Wachstum und dem vorab bekanntgegebenen Referenzwert4 unterliegt einer regelmäßigen und sorgfältigen Analyse durch den EZB-Rat. Dies geschah zuletzt im Dezember 1999, wobei der Rat die genannten Annahmen für weiterhin gültig befand und den Referenzwert daher unverändert ließ. Wenn es sich nicht um durch Schocks ausgelöste Verzerrungen des Geldmengenwachstums handelt, werden Zielverfehlungen korrigiert5. Ansonsten gilt die Erfahrung, daß kurzfristige Schwankungen der umlaufenden Geldmenge keine Auswirkung auf die mittelfristige Inflationsentwicklung haben. Der Referenzwert ist wichtiger Bestandteil der ersten Säule der Strategie.. Aus der Analyse der monetären Entwicklung ergeben sich Informationen, die in engem Zusammenhang mit der zweiten Säule der Strategie zu betrachten sind.
Parallel zur Analyse des Geldmengenwachstums in Relation zum Referenzwert spielt eine auf breiter Basis erfolgende Beurteilung der Aussichten für die Preisstabilität (Inflationsprognose) im Euro-Währungsgebiet in der Strategie des ESZB eine entscheidende Rolle. Diese Beurteilung basiert auf einem breiten Spektrum wirtschaftlicher und finanzieller Größen als Indikatoren der künftigen Preisentwicklungen. Die EZB verkündet vorab Inflationsziele, um deren Einhaltung sie sich mit Hilfe ihrer Instrumente bemüht. Hierbei ist, wie auch bei der Geldmengensteuerung, die Höhe des Geldmarktzinses von entscheidender Bedeutung.
Beide „Säulen“, das Geldmengenziel wie das Inflationsziel, haben Preisstabilität als oberstes Ziel zum Gegenstand, sind vorausschauend und nutzen eine Reihe von Indikatoren, die zur Beurteilung der Angemessenheit der geldpolitischen Maßnahmen dienen.
2.3. Notwendigkeit der Definition von Zwischenzielen
Bei der Festlegung der Ziele (also etwa einem Inflationsziel) einer Zentralen Notenbank ergibt sich das Problem, daß einerseits die Informationen über den Zusammenhang zwischen ergriffenen Maßnahmen und Endziel unvollständig sind und andererseits Wirkungsverzögerungen zwischen den geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbank und den gewünschten gesamtwirtschaftlichen Endzielen auftreten. In der Zwischenzeit kann es zu Störungen6 kommen, auf die die Notenbank mit ihren Instrumenten nicht rechtzeitig reagieren kann. Unter diesen Voraussetzungen bedarf es direkt steuerbarer Zwischenziele als Orientierungs- und Signalgrößen, die einen engen Zusammenhang mit dem anstrebten Endziel erkennen lassen müssen.
Argumentatorisch problematisch ist die Forderung, ein Zwischenziel zu formulieren, daß von der Notenbank zwar in verläßlicher Weise kontrolliert werden kann, aber auch gleichzeitig eine enge Beziehung zum Endziel aufweisen soll. In diesem Fall wäre dann auch eine direkte Beziehung zwischen den von der Notenbank kontrollierbaren „Operation Targets“7 und dem Endziel zu vermuten. Daher läßt sich die Verwendung von Zwischenzielgrößen „nur mit der Existenz von Wirkungsverzögerungen im Transmissionsprozeß rechtfertigen“8.
Es ist also nicht üblich, daß eine Notenbank das Ziel „Preisstabilität“ direkt ansteuert, sondern eben über das Zwischenziel „Geldmenge“.
Welche Geldmenge ist aber die richtige? Eine auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik darf andere gesamtwirtschaftliche Ziele nicht völlig vernach- lässigen.
2.4. Geldmengenziel als Zwischenziel
Selbstverständlich darf die von der Zentralen Notenbank festgesetzte Geldmenge nicht nur die Geldwertstabilität als alleiniges Ziel berücksichtigen. Gesucht ist vielmehr nach der Geldmenge, die die Investitionsnachfrage deckt und Wachstum ermöglicht, Inflation aber gleichzeitig einschränkt. Im Zuge des Zusammenbruchs des Bretton-Woods-Systems 1973 avancierte das Geldmengenziel zu dem eigentlichen Zwischenziel der Geldpolitik, weil empirische Untersuchungen einen engen, zeitlich verzögerten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisentwicklung nachgewiesen hatten.
3. Geldpolitische Instrumente
Zahlreiche geldpolitische Instrumente, die sich in den verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten bewährt haben, finden sich auch im Instrumentarium der Europäischen Zentralbank wieder. Dies dient einerseits der Limitierung von Unsicherheitsfaktoren und kommt andererseits dem innerhalb der nationalen und internationalen Finanzmärkte gehegten Wunsch nach Kontinuität nach. Es gab und gibt durchaus „eine Konkurrenz verschiedener Traditionen“9 zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten und deren Zentralbanken. Insgesamt ähnelt das jetzige geldpolitische Instrumentarium jedoch sehr dem der Deutschen Bundesbank. Allerdings ist es keine Kopie desselben. So gibt es z.B. im ESZB keine Refinanzierungen über den Rediskont und keinen Lombardkredit mehr.
Die Diskussion um die Wahl der geeigneten Instrumente ist kontrovers geführt worden; so war es lange Zeit ungewiß, ob das ESZB sich für oder gegen das Instrument der Mindestreserve entscheiden würde. Erst im Juli 1998, fünf Monate, bevor die gemeinsame europäische Geldpolitik Realität wurde, entschied man sich dafür.
Natürlich verfügt die EZB nicht über eine grundsätzliche neue Konzeption. Vielmehr mußten aus einer Vielzahl möglicher Instrumente jene herausgefiltert werden, die in der Kombination am ehesten für eine gemeinsame Geldpolitik geeignet erscheinen. Exemplarisch für die teilweise extrem gegensätzlichen Gewichtungen möglicher Instrumente ist die differierende Geldpolitik der beiden potentiellen nationalen Vorbilder England und Deutschland. Während die Instrumente Refinanzierungs- und Mindestreservepolitik in der Politik der Deutschen Bundesbank eine überaus große Bedeutung besaß, ist sie bei der Bank of England sehr gering10.
Der Handlungsrahmen des ESZB besteht aus den folgenden Instrumenten:
3.1. Offenmarktgeschäfte
Der Begriff Offenmarktpolitik betrifft den An- und Verkauf von Wertpapieren zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken. Aufgabe der Offenmarktpolitik ist es, Zinssätze zu steuern, Liquidität abzuschöpfen oder zuzuführen um so die umlaufende Geldmenge zu beeinflussen und letztlich auf diese Weise Signale bezüglich des wirtschaftspolitischen Kurses zu geben.
Offenmarktgeschäfte des ESZB können bezüglich ihrer Zielsetzung, ihres Rhythmus und des Verfahrens in vier Kategorien unterteilt werden11.
- In der Praxis haben befristeten Aktionen mit einer Laufzeit von zwei
Wochen, also Wertpapierpensiongeschäfte als Hauptrefinanzierungs- instrument die größte Bedeutung. Sie haben sich bei allen nationalen Zentralbanken als marktgerechtes und effektives Instrument durchgesetzt12. Die Wertpapierpensionsgeschäfte haben weit mehr Gemeinsamkeiten mit Refinanzierungsfazilitäten als mit echten Offenmarktgeschäften. Der Unterschied zur Refinanzierungsfazilität ist sehr gering, besonders deswegen, weil für derartige Kredite ebenfalls Wertpapiere als Sicherheit hinterlegt werden müssen13. Diese Geschäfte werden, was den entscheidenden Unterschied zur Refinanzierungsfazilität darstellt, wöchentlich über ein Bietungsverfahren mit entweder variablem (Zinstender) oder festem Zinssatz (Mengentender) durchgeführt. Dabei kaufen die nationalen Notenbanken für zwei Wochen umlaufende Wertpapiere von den Geschäftsbanken an und führen ihnen so Liquidität zum vereinbarten Zinssatz14 zu.
- Bei längerfristigen Refinanzierungsgeschäften werden in monatlichem
Abstand Transaktionen mit einer Laufzeit von drei Monaten durchgeführt. Dies geschieht im Wege von Standardtendern und einem vorher festgelegten Zeitplan. Hiermit sollen den Geschäftspartnern der EZB zusätzliche, längerfristige Refinanzierungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Das Instrument erinnert mit seiner Laufzeit von drei Monaten an den Diskontkredit der Deutschen Bundesbank.
- Um die Auswirkungen unerwarteter Liquiditätsschwankungen zu begrenzen, können von Fall zu Fall Feinsteuerungsoperationen zur Steuerung der Marktliquidität und der Zinssätze durchgeführt werden. Dies geschieht vorrangig über befristete Transaktionen, kann aber auch mittels definitiven Käufen oder Verkäufen von Wertpapieren, Devisenswap- geschäften oder die Hereinnahme von Termineinlagen erfolgen. Die Instrumente werden den jeweils verfolgten Zielen angepaßt.
- Wenn die EZB die strukturelle Liquiditätsposition des Finanzsektors gegenüber dem ESZB anpassen will, kann sie „ strukturelle Operationen “ in Form von Schuldverschreibungsemissionen, befristeten Transaktionen und definitiven Käufen oder Verkäufen durchführen.
Die Iniative geht bei allen Offenmarktgeschäften von der EZB aus. Sie legt die einzusetzenden Instrumente und vor allem die Konditionen fest.
3.2. Ständige Fazilitäten
Die sogenannten "ständigen Fazilitäten" dienen dazu, den Banken zum Beispiel bei kurzfristigen Kapitalengpässen auszuhelfen ("Übernacht- liquidität") und überschüssige Gelder kurzfristig bei der Zentralbank parken. Durch Anheben oder Senken der "Fazilitäten", also dieser Kredit- bzw. Einlagezinsen, kann die Zentralbank die Höhe von Tagesgeldzinsen beeinflussen. Die Initiave geht hier von den Banken aus.
3.2.1. Spitzenrefinanzierungsfazilität
Die Geschäftsbanken bedienen sich dieses Instrumentes, um sich von den nationalen Zentralbank Übernachtliquidität gegen refinanzierungfsfähige Sicherheiten zu beschaffen. Für das ESZB ist dies ein wichtiges Mittel, die Ausschläge der Geldmarktsätze nach oben zu begrenzen. Der hierfür anfallende Zinssatz bildet die Obergrenze des Tagesgeldsatzes15. Dieser
Kredit kann als Nachfolger des Lombardkredites der Bundesbank angesehen werden.
3.2.2. Einlagefazilität
Sie ist das Gegenstück zur Spitzenrefinanzierungsfazilität und soll kurzfristige Liquiditätsüberschüsse abfangen. Die Kreditinstitute können bei den nationalen Zentralbanken bis zum nächsten Geschäftstag anlegen. Die EZB zahlt auf die Einlage Zinsen, die im allgemeinen die Untergrenze des Tagesgeldsatzes bilden16.
3.3. Mindestreserve
Weiteres wichtiges Instrument ist das Mindestreservesystem des ESZB. Die Banken müssen bei Mindestreservepflicht zwischen 1,5 und 2,5% der Einlagen von Nichtbanken und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren sowie ihre Geldmarktpapiere bei der EZB hinterlegen. Diese Beträge stehen den Banken somit nicht zur Kreditvergabe zur Verfügung. Nicht reservepflichtig sind Verbindlichkeiten gegenüber Instituten, die selbst reservepflichtig sind und Verbindlichkeiten gegenüber der EZB selbst und den nationalen Notenbanken (also gegenüber dem ESZB insgesamt). Vorläufig freigestellt von der Reservepflicht sind Einlagen mit vereinbarten Laufzeiten oder Kündigungsfristen von über zwei Jahren.
Die bei der EZB hinterlegte Mindestreserve ist, im Gegensatz zur Mindestreserve im System der Deutschen Bundesbank, verzinslich. Die Verzinsung berechnet sich als Durchschnitt des ESZB-Satzes für seine Hauptrefinanzierungsgeschäfte innerhalb der Mindestreserveerfüllungsperiode und ist so marktgerecht. Die EZB will auf diese Weise Wettbewerbsnachteile gegenüber Finanzplätzen ohne Mindestreserveverpflichtung (besonders England und Vereinigte Staaten) vermeiden und das Instrument möglichst kostenneutral halten. Insofern stellt es aus Sicht der Geschäftsbanken auch eine Verbesserung gegenüber der in Deutschland gängigen Praxis dar. Um kleinere Institute zu entlasten, hat die EZB zudem einen nicht mindest- reservepflichtigen „Freibetrag“ in Höhe von EUR 100.000,- eingeführt.
Die EZB nennt drei Vorteile, die ein Mindestreservesystem bietet. Erstens soll es einen Beitrag zur Stabilisierung der Geldmarktsätze beitragen. Zweitens soll es die Nachfrage nach Zentralbankgeld erhöhen und so eine strukturelle Liquiditätsknappheit am Markt herbeiführen bzw. vergrößern. Das ESZB ist so besser in der Lage, effizient als Liquiditätsbereitsteller zu agieren und auf neue Zahlungsverfahren wie elektronisches Geld zu reagieren. Drittens können Angebotsüberhänge am Geldmarkt durch die Erhöhung der Zinselastizität schnell und effizient korrigiert werden.
Der EZB-Rat argumentiert weiter, daß ohne die Einführung eines Mindestreservesystems, was über längere Zeit kontrovers diskutiert wurde, ein häufiger Einsatz von Offenmarkt-Feinsteuerungsoperationen notwendig würde, weil das Fehlen einer Mindestreserve die Geldmarktsätze einer relativ hohen Volatilität (Schwankung) aussetzt17. Dies wäre unvorteilhaft und würde die Effizienz der Geldpolitik beeinträchtigen. Auch die Deutung der von der EZB gesetzten Signale würde erschwert, weil man geldpolitische Signale und technische Anpassungen nur schwer unterscheiden könnte.
Nur Institute, die der Mindestreservepflicht unterworfen sind, dürfen an Offenmarktgeschäften über Standardtender (3.1.) teilnehmen und die ständigen Fazilitäten (3.2.) in Anspruch nehmen18.
3.3. Zentralbankfähige Sicherheiten
Aufgrund Artikel 18.1 der ESZB-Satzung müssen für alle Kreditgeschäfte („liquiditätszuführende Operationen“) des ESZB ausreichende Sicherheiten gestellt werden. Dabei kann unterschieden werden zwischen „Kategorie-1- Sicherheiten“ und „Kategorie-2-Sicherheiten“. Dies trägt den unterschiedlichen Finanzstrukturen der Mitgliedsstaaten Rechnung.
Zur Kategorie 1 gehören marktfähige Schuldtitel, die die von der EZB festgelegten und in der gesamten Währungsunion geltenden Zulassungskriterien erfüllen.
In Kategorie 2 sind weitere marktfähige und nicht marktfähige Sicherheiten enthalten, die für die nationalen Finanzmärkte und Bankensysteme von wichtiger Bedeutung sind und für die die nationalen Zentralbanken die Zulassungskriterien unter Berücksichtigung des EZB-Mindeststandards festlegen. Diese Zulassungskriterien bedürfen der Zustimmung durch die EZB.
Im Hinblick auf die Qualität der Sicherheiten gibt es zwischen den beiden Kategorien keine Unterschiede (außer, daß das ESZB bei definitiven Käufen bzw. Verkäufen üblicherweise keine Kategorie-2-Titel verwendet).
4. Schlussbemerkungen
Die Haltung der EZB, das Ziel „Preisstabilität“ gegenüber allen anderen wirtschaftspolitischen Zielen und Bestrebungen bedingungslos Vorrang zu geben, kann kritisch gesehen werden, weil hierdurch eine Zielhierarchie indirekt manifestiert wird. Eine konsequente Auslegung der Position könnte zu dem Resultat kommen, daß beispielsweise die Vermeidung eines geringen Inflationsanstiegs (auf 2% oder mehr) gegenüber einer beträchtlichen Verringerung der Arbeitslosigkeit bevorzugt würde, unterstellt, daß diese Option bestünde. Nicht an der Währungsunion teilnehmende Mitgliedsstaaten und dabei insbesondere England argumentieren auf diese Weise.
Die englische Regierung bemerkte, das Land befände sich zum Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion „in einem anderen Konjunkturzyklus als der Rest der EU“. Unabhängig davon, ob dies das entscheidende Kriterium war, das England dazu bewogen hat, vorläufig nicht an der Gemeinschaftswährung teilzunehmen, ist die Bemerkung von nicht unerheblicher Bedeutung. Die Zusammenführung der Geldpolitik elf souveräner Staaten erfolgte weltweit erstmalig. Es stand und steht hier tatsächlich kein homogenes geldpolitisches Fundament zur Verfügung.
Schon im Hinblick auf die Erfüllung der Konvergenzkriterien zum Beitritt zur Währungsunion machte sich in Schweden die Meinung breit, der Sparzwang sei für die hohe Arbeitslosigkeit direkt verantwortlich (die finanziellen Schwierigkeiten des Landes hatten allerdings bereits vorher ihren Anfang genommen). So erfüllte das Land die Konvergenzkriterien auch zum Starttermin nicht.
Besonders in den 60er und 70er Jahren prägten die englischen Ökonomen Philips und Lipsey die wirtschaftspolitische Diskussion um die mögliche inverse Beziehung zwischen Geldwertstabilität und Vollbeschäftigung und begeisterten die Fachwelt mit ihren empirischen Untersuchungen zur Untermauerung ihrer These. Es sollte also gelten, daß hohe Lohnsteigerungs- raten mit niedrigen Arbeitslosenquoten korrespondierten und umgekehrt. Heute ist klar, daß die damals aufgestellten Thesen zwar durch tatsächliche Entwicklungen in mehrjährigen Perioden des 19. und 20.Jahrhunderts bestätigt wurden, jedoch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gelten können. Der von von Philips (1958) und Lucas (1960) festgestellte Zusammenhang zwischen Nominallohnänderungsrate und Arbeitslosigkeit bestand nur in Phasen mit sehr geringen und relativ stabilen Inflationsraten. So ist auch die Erwartungsbildung der Wirtschaftssubjekte von wichtiger Bedeutung.
Der EZB-Rat sieht die hohe Arbeitslosigkeit im Euro-Währungsgebiet als „ganz überwiegend strukturell bedingt“19. Seiner Meinung nach müssen dringend Inflexibilitäten durch wirtschaftliche Strukturreformen beseitigt werden, um die Arbeitslosigkeit abzubauen. Gemeint sind hier besonders eine Senkung der Steuer- und Abgabenlast seitens der nationalen Regierungen sowie eine moderate Lohnpolitik der Tarifparteien. Der EZB-Rat beruft sich darauf, daß in Ländern, wo es solche Reformen gegeben hat, die Arbeitslosenquote beträchtlich zurückgegangen sei20. Am Beispiel Deutschland, einem ausgesprochenen Befürworter der Währungsunion, läßt sich erkennen, daß es Jahre oder gar Jahrzehnte dauern kann, nur einzelne Punkte eines Reformkonzeptes umzusetzen.
Ohne eine ausgeprägte Stabilitätskultur und ohne solide Finanz- und
Wirtschaftspolitik ist ein stabiler und international anerkannter Euro auf Dauer nicht möglich. Gewissenhafte, adäquate Beiträge aller Träger der Stabilitätspolitik sind von erheblicher Bedeutung für das mittel- und langfristige Gelingen der Wirtschafts- und Währungsunion.
Literaturverzeichnis
- Bofinger / Reischle / Schächter: Geldpolitik, München 1996
- Duisenberg, Willem F.: Europäische Währungsunion - Garant für Stabilität“, Vortrag vor dem Wirtschaftsbeirat der Union, 1998; aus: Internet, http://www.ecb.int/key/sp980824.htm
- Duisenberg, Willem F.: Die einheitliche europäische Geldpolitik, Vortrag an der Universität Hohenheim, 1999; aus: Internet, http://www.ecb.de/key/sp990209.htm
- Leschke, Martin: Geldmengenpolitik in Deutschland und Europa, Wiesbaden 1999
- Menkhoff, Lukas: Geldpolitische Instrumente der Europäischen Zentralbank, Stuttgart 1995 http://www.ecb.de/key/sp990209.htm
[...]
1 Duisenberg (1999), S. 2
2 Duisenberg (1998), S. 3
3 Duisenberg (1998), S. 4
4 derzeit 4,5% p.a.
5 Leschke (1999), S. 197
6 vor allem exogene (nicht-monetäre) Schocks
7 Geldbasis, Geldmarktzins
8 Bofinger / Reischle / Schächter (1996), S.247
9 Menkhoff (1995), S. 9
10 Menkhoff (1995), S. 40
11 EZB, Internet: http://www.bundesbank.de/ezb/de/ecb/kurzdarstellung/funktionen.htm
12 Duisenberg (1998), S.3
13 Bofinger / Reischle / Schächter (1996), S. 406
14 derzeit 3,5%
15 derzeit 4,5%; vom EZB-Rat am 13.April 2000 bestätigt
16 derzeit 2,5%; vom EZB-Rat am 13.April 2000 bestätigt
17 entnommen aus: Internet; http://www.zew.de/cdrom/EZBAufgaben.html
18 entnommen aus: Internet http://www.bundesbank.de/ezb/de/ecb/kurzdarstellung/funktionen.htm
19 Duisenberg (1999), S.3
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele der Europäischen Zentralbank (EZB)?
Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) ist die Gewährleistung der Preisstabilität im Euro-Währungsgebiet. Preisstabilität wird als ein Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex von unter 2% gegenüber dem Vorjahr definiert. Soweit die Preisstabilität nicht beeinträchtigt wird, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft.
Welche Aufgaben und Funktionen hat die EZB?
Die grundlegenden Aufgaben des ESZB umfassen:
- Festlegung und Ausführung der Geldpolitik der Gemeinschaft
- Durchführung von Devisengeschäften
- Halten und Verwalten der offiziellen Währungsreserven der teilnehmenden Mitgliedsstaaten
- Förderung des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme
- Beitrag zur reibungslosen Durchführung der Maßnahmen im Bereich der Aufsicht über Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems
Die EZB ist auch die Bank der Union, die Bank der Banken, hat das Notenausgaberecht und wirkt in der Bankenaufsicht mit.
Wie ist die geldpolitische Strategie der EZB aufgebaut?
Die geldpolitische Strategie der EZB basiert auf einer "Zwei-Säulen-Strategie":
- Geldmengensteuerung: Festlegung eines quantitativen Referenzwertes für das Wachstum des monetären Aggregats M3 (derzeit 4,5%).
- Beurteilung der Aussichten für die Preisstabilität: Eine breite Beurteilung auf Basis wirtschaftlicher und finanzieller Größen als Indikatoren der künftigen Preisentwicklungen (Inflationsprognose).
Beide Säulen zielen auf Preisstabilität ab und nutzen eine Reihe von Indikatoren zur Beurteilung der Angemessenheit der geldpolitischen Maßnahmen.
Warum definiert die EZB Zwischenziele?
Aufgrund unvollständiger Informationen und Wirkungsverzögerungen zwischen geldpolitischen Maßnahmen und gesamtwirtschaftlichen Endzielen benötigt die EZB direkt steuerbare Zwischenziele als Orientierungs- und Signalgrößen, die einen engen Zusammenhang mit dem Endziel (Preisstabilität) aufweisen.
Welche geldpolitischen Instrumente stehen der EZB zur Verfügung?
Die EZB verfügt über folgende Instrumente:
- Offenmarktgeschäfte: An- und Verkauf von Wertpapieren zur Steuerung der Zinssätze und der Liquidität. Dazu gehören Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen.
- Ständige Fazilitäten: Spitzenrefinanzierungsfazilität zur Beschaffung von Übernachtliquidität und Einlagefazilität zur Anlage von kurzfristigen Liquiditätsüberschüssen.
- Mindestreserve: Verpflichtung für Banken, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einlagen bei der EZB zu hinterlegen.
- Zentralbankfähige Sicherheiten: Für Kreditgeschäfte müssen ausreichende Sicherheiten gestellt werden (Kategorie-1-Sicherheiten und Kategorie-2-Sicherheiten).
Warum wird die Rolle der EZB kritisch gesehen?
Die Haltung der EZB, das Ziel "Preisstabilität" bedingungslos Vorrang zu geben, wird kritisiert, weil hierdurch eine Zielhierarchie manifestiert wird, die möglicherweise andere wirtschaftspolitische Ziele (z.B. Vollbeschäftigung) vernachlässigt.
- Quote paper
- Kai Berger (Author), 2000, Aufgaben und Ziel sowie Strategie und Instrumentarium der EZB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96946