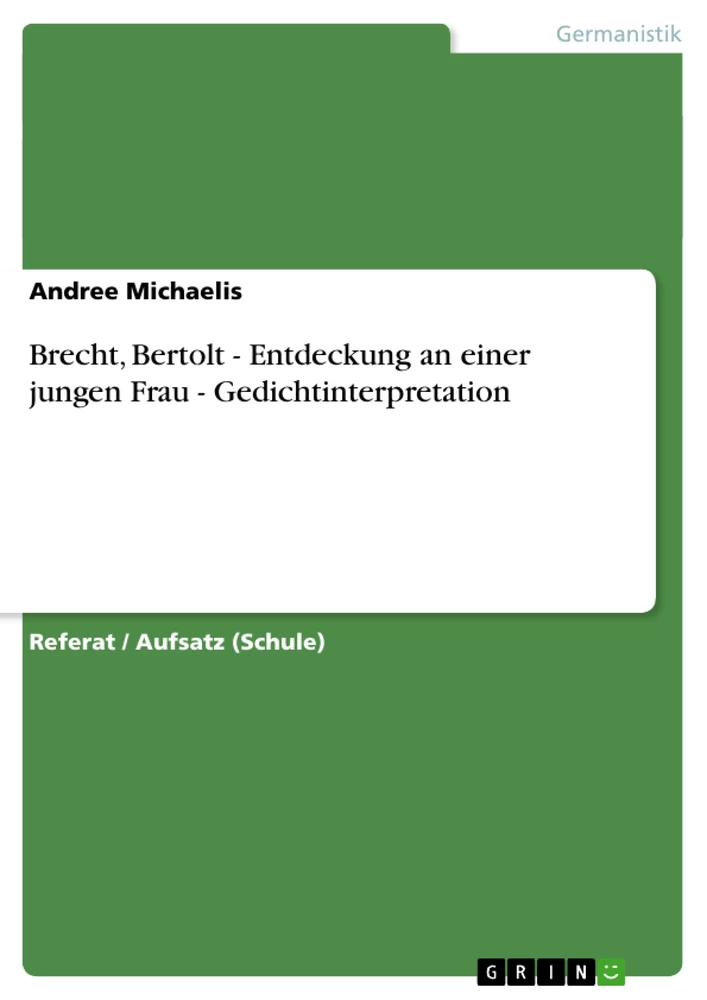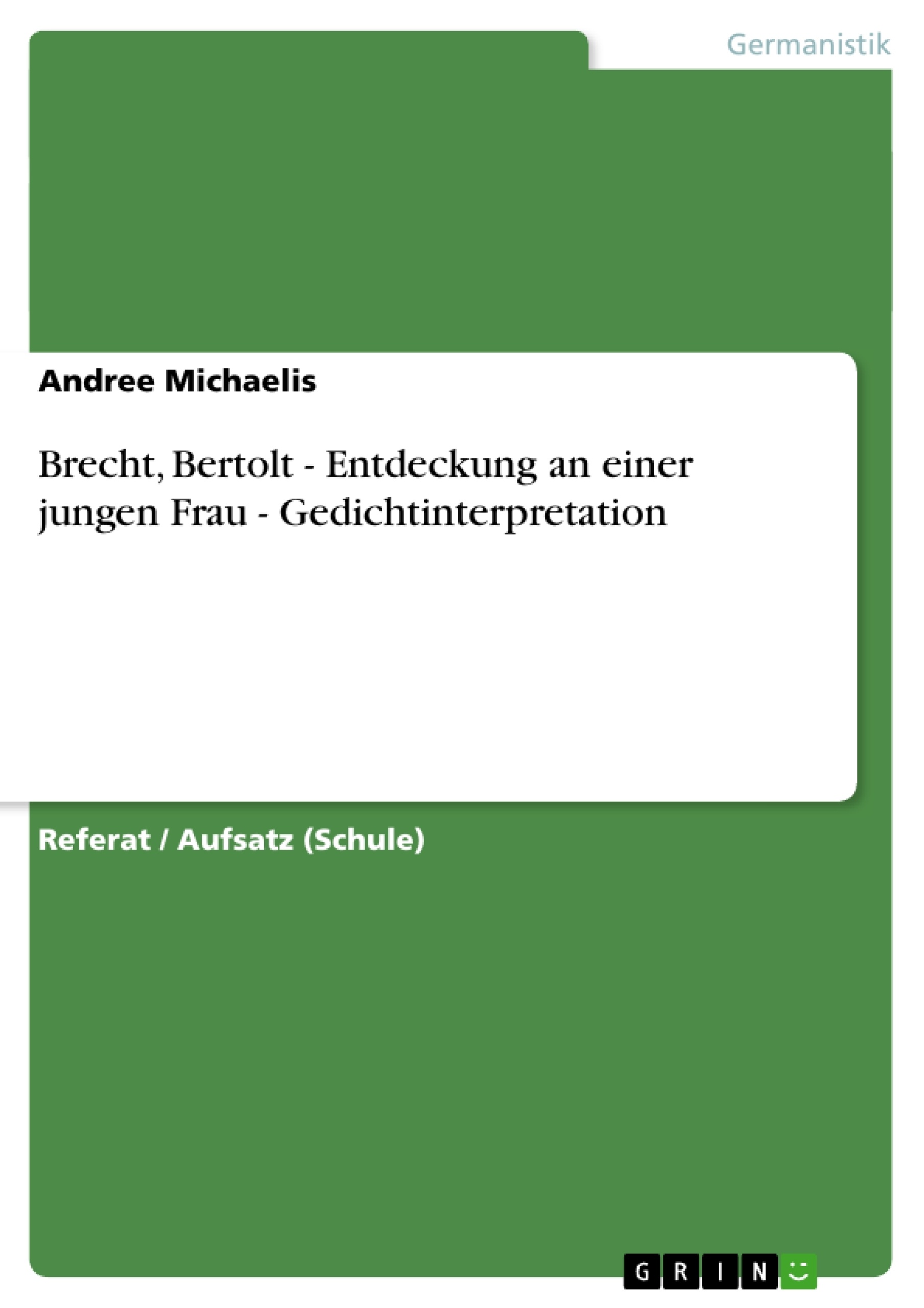In einer Welt flüchtiger Schönheiten und vergänglicher Momente enthüllt Bertolt Brecht in "Entdeckung an einer jungen Frau" eine bittersüße Reflexion über die Zeit und ihre unaufhaltsame Wirkung. Das Gedicht fängt einen entscheidenden Augenblick ein, einen Abschied im Morgengrauen, der durch die Entdeckung eines einzelnen grauen Haares eine tiefgreifende Erkenntnis auslöst. Plötzlich wird die Fassade jugendlicher Anmut brüchig, und die unausweichliche Wahrheit des Alterns tritt schonungslos zutage. Der lyrische Sprecher ringt mit der Vergänglichkeit und dem Wunsch, die Zeit anzuhalten, bevor die Schönheit endgültig verblasst. Doch unter der Oberfläche der Melancholie brodelt eine tiefe Sehnsucht nach Intimität und Verbindung. Die Beziehung zur jungen Frau, gehüllt in den Schleier der Prostitution, offenbart eine überraschende Tiefe, die über bloße körperliche Begierde hinausgeht. Gespräche und ein Gefühl von Vertrautheit weben sich in das Gefüge ihrer Begegnungen und lassen die Grenzen zwischen Käuflichkeit und echter menschlicher Nähe verschwimmen. Brecht verwebt geschickt Form und Inhalt, indem er die traditionelle Sonettform nutzt, um die Vanitas-Thematik des Barock widerzuspiegeln. So entsteht eine Atmosphäre der Vergänglichkeit, die den Leser unweigerlich in ihren Bann zieht. Das Gedicht ist ein Spiegelbild der menschlichen Conditio, der uns alle betrifft. Es regt dazu an, die Gegenwart zu schätzen, die Schönheit im Augenblick zu erkennen und die flüchtigen Momente der Intimität zu bewahren, bevor sie unwiederbringlich entschwinden. "Entdeckung an einer jungen Frau" ist ein eindringliches Plädoyer für die Anerkennung der Vergänglichkeit als integralen Bestandteil des Lebens und für die Wertschätzung der Beziehungen, die uns im Angesicht der Zeit Halt geben. Es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur, die den Leser noch lange nach der letzten Zeile beschäftigt. Dieses Werk ist ein Muss für jeden Liebhaber klassischer Gedichte, der sich von Brechts Sprachgewalt und seiner Fähigkeit, universelle Themen anzusprechen, fesseln lassen möchte. Tauchen Sie ein in die Welt von Brecht und erleben Sie die Magie seiner Worte.
Bertold Brecht: Entdeckung an einer jungen Frau Gedichtinterpretation
Das Sonett „Entdeckung an einer jungen Frau“ wurde von Bertolt Brecht in der Zeit von 1913 bis 1926 geschrieben. Es geht darin offenbar um Vergänglichkeit von Schönheit. Der junge Dichter möchte vermutlich auf die Vergänglichkeit der weiblichen Schönheit hinweisen, wie er sie vielleicht selbst beobachtet hat. In den ersten drei Versen skizziert Brecht eine Szene vor dem Haus einer Frau, die das lyrische Ich verabschiedet. Der Abschied wird als „nüchtern“ (Vers 1) und „kühl“ (Vers 2) dargestellt, wobei anzunehmen ist, dass diese Kühle von der Frau ausgeht, da sie „kühl zwischen Tür und Angel, kühl besehen“ steht (Vers 2). Bei der Frau handelt es sich offensichtlich um eine Prostituierte, deren „Nachtgast“ (Vers. 6) das lyrische Ich war. Die Person des lyrischen Ich darf dahingehend in gewisser Weise mit dem jungen Bertolt Brecht verglichen werden. Es darf angenommen werden, dass der hier noch recht junge Autor Brecht eigene Erfahrungen verarbeitet und womöglich sich selbst im lyrischen Ich sieht.
Der dargestellte Abschied wird für den Nachtgast erschwert, als dieser „eine (graue) Strähne in ihrem Haar“ (Vers 3) sieht, und er kann sich „nicht entschließen mehr zu gehen“ (Vers 4). Dieser Vers sticht durch seine parataktische Form hervor, da die vorhergehenden Verse1 und 2 durch Enjambement verbunden waren und die Aufzählung durch ihn abgebrochen wird. Er wird in gewisser Weise hervorgehoben, da diese Beobachtung Auslöser des nun folgenden Gedankenganges ist. An der grauen Strähne scheint das lyrische Ich zu erkennen, daß die „junge Frau“ (Überschrift) altert und bemerkt erschreckt, dass die Frau, welche im Augenblick des Gesprächs wörtlich „zwischen Tür und Angel“ (Vers 2) des Hauses steht, auch im übertragenden Sinne zwischen Jugend bzw. Schönheit und Alter bzw. Vergänglichkeit steht (Vers 11). Ihm wird deutlich, „dass du vergehst“ (Vers 13), dass sie nie wieder so sein wird, wie sie es in diesem Augenblick ist, und bittet deshalb um eine Wiederholung der Nacht, bevor sie noch weiter altert.
Dabei scheint die Beziehung des Besuchers zu der angeblichen Prostituierten eine weitaus intimere zu sein, als man bei einem normalen „Nachtgast“ (Vers 6) annehmen könnte. Obwohl von vornherein geplant war, dass er „nach Verlauf der Nacht“ (Vers 6) gehen sollte, haben die beiden offenbar eine engere Beziehung aufgenommen, die neben sexuellem Kontakt und „Begierde“ (Vers 14) auch „Gespräche“ (Vers 12) mit sich brachte. Der Besucher mahnt die Frau geradezu, ihre Zeit zu nutzen (Vers 10) - dies jedoch nicht zuletzt deshalb, weil er selbst womöglich die Schönheit der Prostituierten noch genießen will. Schließlich will er bei der nun anstehenden Wiederholung der Nacht „die Gespräche rascher treiben“ (Vers 12), um vielleicht keine Zeit zu verlieren.
Das Gedicht schließt mit dem parataktischen Vers „Und es verschlug Begierde mir die Stimme“, und ebenso wie es dem lyrischen Ich die Stimme verschlägt, endet das Gedicht: die Reimstellung der beiden Terzette (a-b-c und a-c-b) und die (auch durch den Punkt) erzeugte Parataxe lassen das Gedicht unvorbereitet und plötzlich enden. Bertolt Brecht wählte für sein Gedicht wahrscheinlich mit Absicht die traditionelle Form des Sonetts. Das Sonett besteht aus zwei Quartetten und zwei Terzetten, wobei in den beiden Quartetten die Szene vor der Tür dargestellt und durch Hinweise (wie der des „Nachtgastes“ in Vers 6) erklärt wird. Die Terzette stellen die aus der Beobachtung und Interpretation der grauen Haarsträhne resultierende Folgerung dar, dass sie ihre Zeit nutzen solle und er die Nacht wiederholen möchte. Die Form unterstützt also die Entwicklung von der Beobachtung zur Folgerung.
Warum Brecht diese Form benutzt, scheint klar: er schlägt damit den Vergleich zu der vanitas mundi des Barockzeitalters, in dem das Sonett seine Blütezeit fand. Durch die Form erhält das Gedicht die Stimmung der Vergänglichkeit, wie sie aus eben dieser Zeit bekannt ist. Jedoch bezieht der Dichter den Begriff hier nicht auf die Welt, was zur Zeit der Gedichtentstehung durch den herrschenden ersten Weltkrieg auch denkbar wäre, sondern zunächst nur auf das Wesen einer einzelnen Frau. Nun kann man den Vanitas-Begriff aber auf alle möglichen Lebenslagen übertragen, was Brecht auch zuläßt, da er ihn nicht direkt einschränkt. Vielleicht beabsichtigt er sogar, dass seinen Lesern diese Assoziation kommt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Bertolt Brechts Gedicht "Entdeckung an einer jungen Frau"?
Das Gedicht handelt von der Vergänglichkeit der Schönheit, insbesondere der einer jungen Frau. Das lyrische Ich beobachtet eine graue Strähne in ihrem Haar und erkennt, dass sie altert. Es drückt den Wunsch aus, die Nacht mit ihr zu wiederholen, bevor sie noch weiter altert.
Wer ist die Frau im Gedicht?
Es wird angedeutet, dass es sich um eine Prostituierte handelt, da das lyrische Ich sie als "Nachtgast" bezeichnet. Die Beziehung zwischen den beiden scheint jedoch intimer zu sein als ein reiner sexueller Kontakt.
Was bedeutet die graue Strähne im Haar der Frau?
Die graue Strähne symbolisiert das Altern und die Vergänglichkeit der Schönheit. Sie ist der Auslöser für die Erkenntnis des lyrischen Ichs, dass die Frau nicht ewig jung bleiben wird.
Warum verwendet Brecht die Sonettform?
Brecht verwendet die Sonettform, um eine Verbindung zur Vanitas-Tradition des Barock herzustellen, in der die Vergänglichkeit der Welt betont wurde. Die Form unterstützt die Entwicklung von der Beobachtung (graue Strähne) zur Folgerung (Wunsch nach Wiederholung der Nacht).
Welche Rolle spielen die "Gespräche" im Gedicht?
Die Gespräche deuten auf eine tiefere Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und der Frau hin, die über den rein sexuellen Aspekt hinausgeht. Das lyrische Ich möchte diese Gespräche bei einer Wiederholung der Nacht beschleunigen, möglicherweise um die verbleibende Zeit optimal zu nutzen.
Was bedeutet das Ende des Gedichts mit dem Vers "Und es verschlug Begierde mir die Stimme"?
Das abrupte Ende des Gedichts spiegelt die Sprachlosigkeit des lyrischen Ichs angesichts der Erkenntnis der Vergänglichkeit wider. Es unterstreicht die Vergänglichkeit und Unsicherheit, die das Gedicht thematisiert.
Wie wird das Gedicht interpretiert?
Das Gedicht kann als Reflexion über die Vergänglichkeit der Schönheit und die Bedeutung, den Moment zu nutzen, interpretiert werden. Es thematisiert auch die Beziehung zwischen Schönheit, Alter und Begierde.
Bezieht sich die Vergänglichkeit nur auf die einzelne Frau?
Obwohl die Vergänglichkeit primär auf die Frau bezogen wird, lässt Brecht die Möglichkeit offen, den Vanitas-Begriff auf allgemeinere Lebenslagen zu übertragen, was dem Leser die Möglichkeit gibt, eigene Assoziationen zu knüpfen.
- Quote paper
- Andree Michaelis (Author), 2000, Brecht, Bertolt - Entdeckung an einer jungen Frau - Gedichtinterpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96891