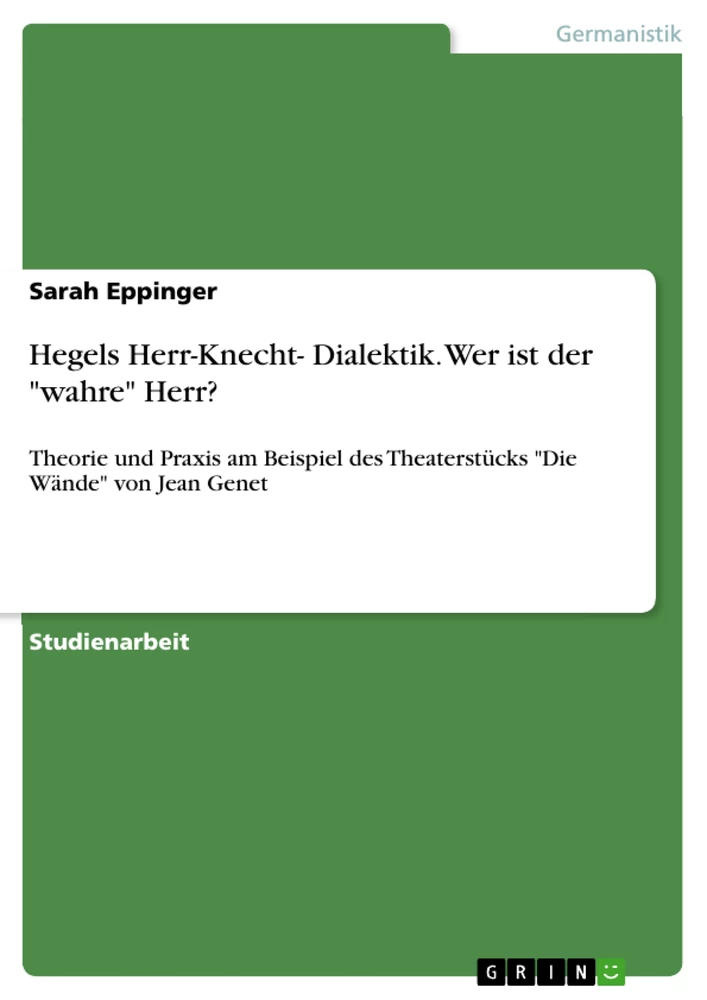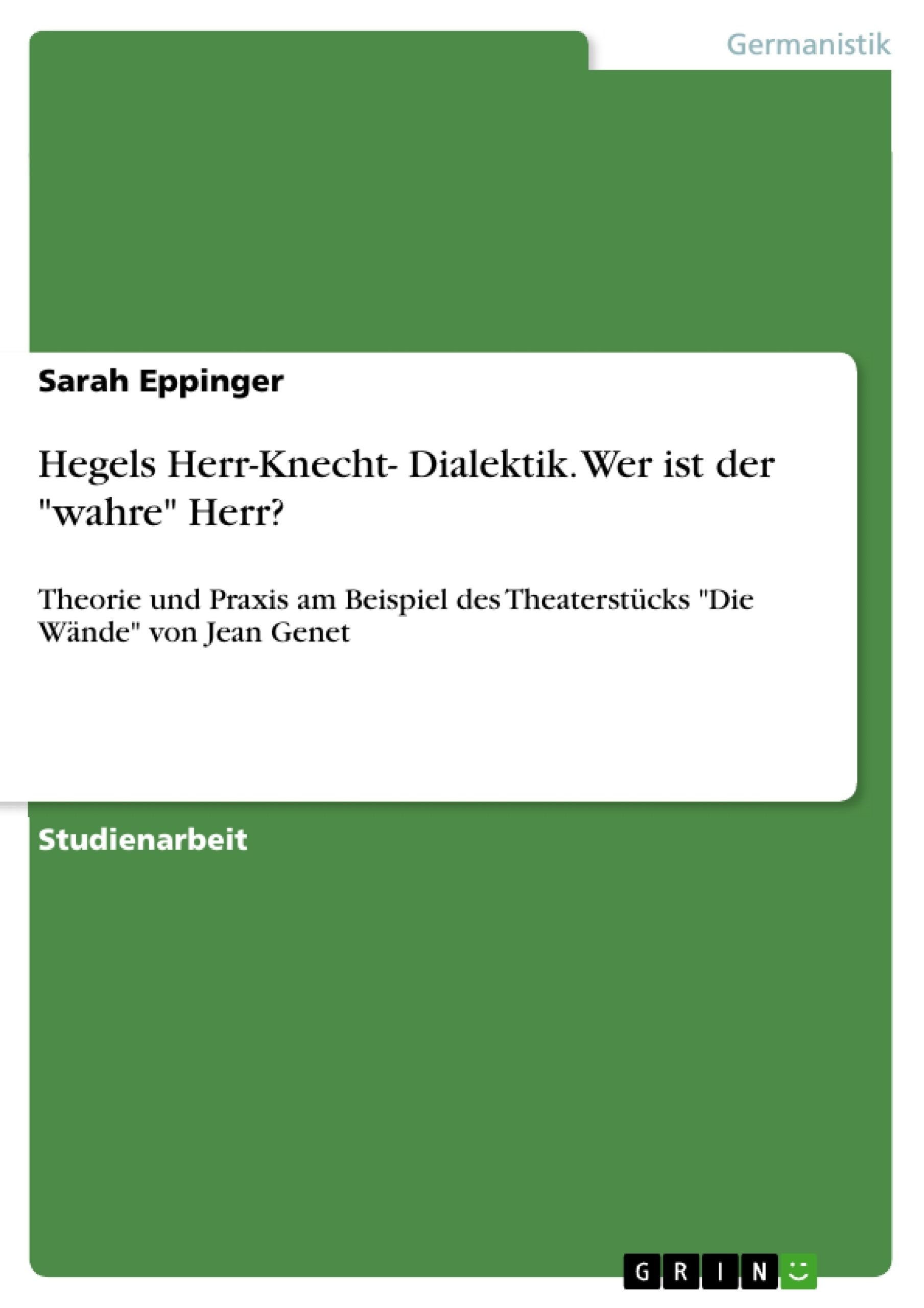Das Phänomen der „Kolonialisierung“ ist geprägt von der Zweiteilung der Menschen in „Kolonialisten“ und „Ureinwohner“. Im allgemeinen Verständnis sind die „Kolonialisten“, die eine neue Kultur, eine neue Sprache und neue soziale Gefüge einbringen, die „Herren“. Sie besitzen Verfügungsgewalt und sehen sich selbst als sozial höher an, während die „Ureinwohner“ für gewöhnlich als „Knechte“ wahrgenommen werden.
Mit der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels verändern sich die Verhältnisse im Laufe der Kolonialisierung, denn seine Definition der Beziehung zwischen einem Herrn und seinem Knecht zeigt, dass ebendiese keine dauerhafte Wirkung hat und schlussendlich immer zum Scheitern verurteilt ist, da sich das Verhältnis der beiden umkehrt und somit niemals kontinuierlich bestehen kann.
Um die Definition Hegels deutlicher zu veranschaulichen, wird im Folgenden zuerst auf die Theorie und danach auf die Praxis anhand des Theaterstücks „Die Wände“ von Jean Genet, eingegangen. Das Stück kann als ästhetische Umsetzung der Herr-Knecht-Dialektik Hegels angesehen werden: Genet wandelt Theorie in Praxis um. Ob er die Theorie Hegels bekräftigt oder widerlegt, soll im Laufe der vorliegenden Arbeit vor allem an der Figur des Saids untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- G.W.F. Hegel's „Herr“ und „Knecht“
- „Die Wände“
- Said
- Wer ist nun der „Herr“?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herr-Knecht-Dialektik Georg Wilhelm Friedrich Hegels im Kontext der französischen Kolonialisierung Algeriens und untersucht, wie sich diese Theorie im Theaterstück „Die Wände“ von Jean Genet manifestiert.
- Hegels Herr-Knecht-Dialektik und ihre Anwendung auf die Kolonialisierung
- Analyse der Figur des Saids in „Die Wände“ im Hinblick auf die Herr-Knecht-Beziehung
- Die Rolle der Gewalt in der Beziehung zwischen Kolonialisten und Einheimischen
- Das Konzept der Selbsterkenntnis und Anerkennung im kolonialen Kontext
- Die Bedeutung von Sprache und Symbolen in der Darstellung der Machtstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Kolonialisierung und die Zweiteilung in „Kolonialisten“ und „Ureinwohner“ vor. Sie erläutert Hegels Definition der Beziehung zwischen Herr und Knecht und ihre Relevanz für das Verständnis der kolonialen Verhältnisse. Außerdem wird das Theaterstück „Die Wände“ von Jean Genet eingeführt, das als ästhetische Umsetzung der Herr-Knecht-Dialektik Hegels betrachtet werden kann.
G.W.F. Hegel's „Herr“ und „Knecht“
Dieses Kapitel beleuchtet Hegels Philosophie des Selbstbewusstseins und die Entstehung von Macht in der Beziehung zwischen zwei Menschen. Es werden die spezifischen Herausforderungen der Selbsterkenntnis im kolonialen Kontext und die unterschiedlichen Rollen von Herr und Knecht in Bezug auf die Kontrolle über die eigenen Bedürfnisse und die Angst vor dem Tod erörtert. Schlussendlich wird die fragwürdige Wertigkeit der Anerkennung des Herrn durch den Knecht angesprochen.
„Die Wände“
Dieses Kapitel analysiert das Theaterstück „Die Wände“ von Jean Genet. Es werden die Charaktere und die Handlung des Stücks vorgestellt, insbesondere die Figur des Saids, seine schwierige Situation und seine Beziehung zu den Kolonialisten. Außerdem werden die Formen der Gewalt und die symbolische Sprache, die die Machtstrukturen verdeutlichen, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Herr-Knecht-Dialektik, Kolonialisierung, Gewalt, Selbsterkenntnis, Anerkennung, Sprache, Symbole, Theaterstück, Jean Genet, „Die Wände“, Said, Algerien.
- Arbeit zitieren
- Sarah Eppinger (Autor:in), 2017, Hegels Herr-Knecht- Dialektik. Wer ist der "wahre" Herr?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/967990