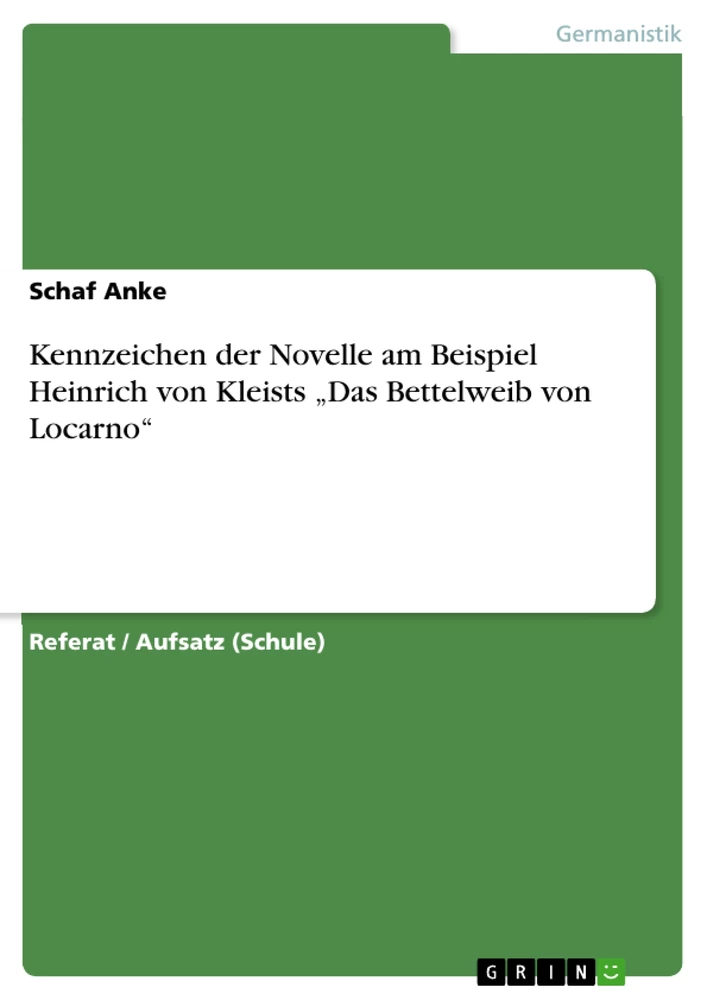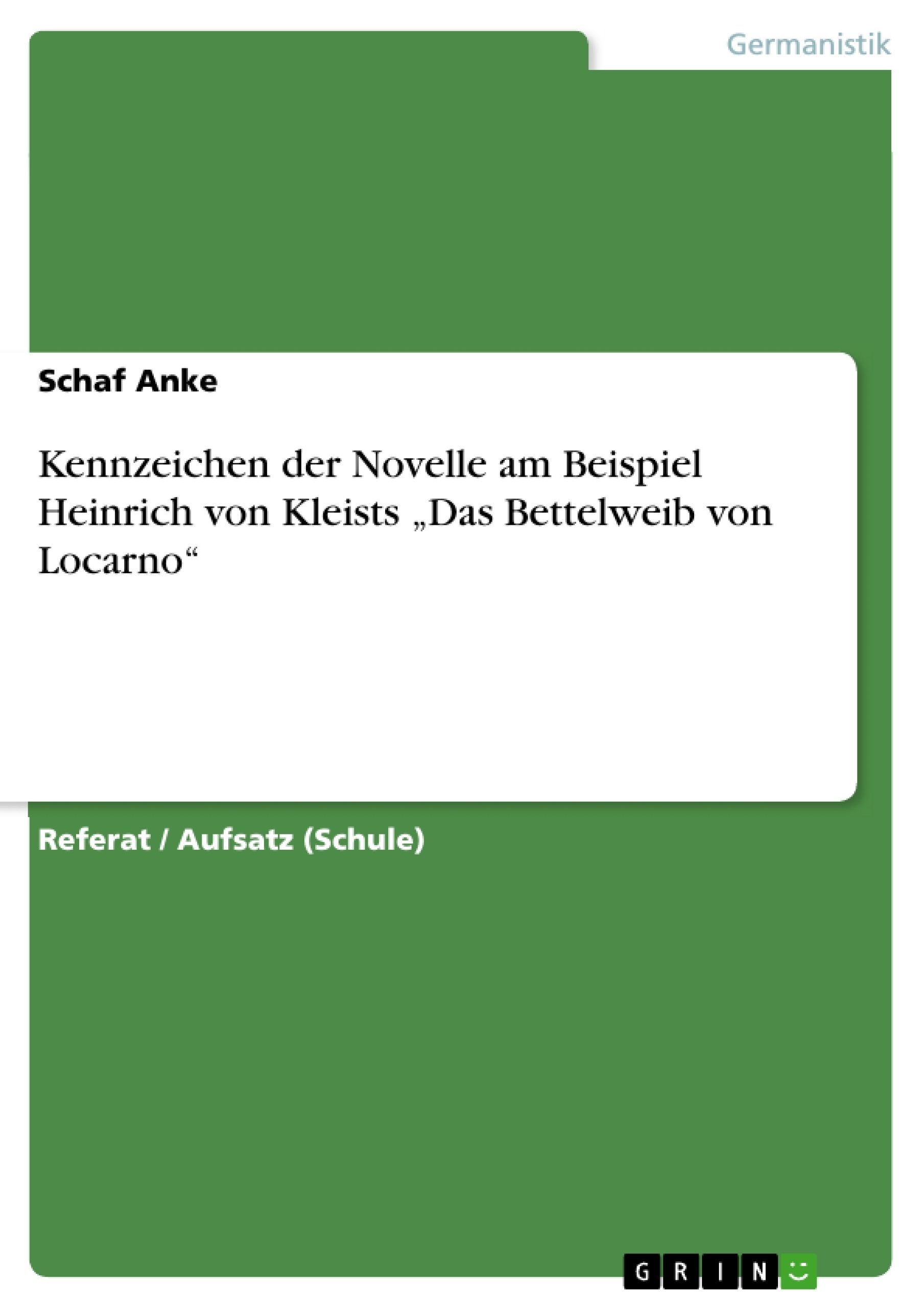Was macht eine Novelle zur Novelle? Tauchen Sie ein in die Welt der deutschen Novellistik, von ihren frühesten Vorläufern bis zu den Meisterwerken der Moderne. Diese Analyse ergründet die definierenden Merkmale dieser literarischen Form, von Goethes berühmter Definition einer "sich ereigneten, unerhörten Begebenheit" bis hin zu den formalen und thematischen Konventionen, die sie prägen. Entdecken Sie die Vielfalt der Novelle anhand ihrer Geschichte, beginnend mit den italienischen Einflüssen des "Dekameron" und "Conde Lucanor", die den Weg für die deutsche Renaissance ebneten. Verfolgen Sie die Entwicklung durch die Werke von Wieland, Kleist, Keller und Storm, bis hin zu den modernen Interpretationen von Thomas Mann, Stefan Zweig und Günther Grass. Untersucht werden die charakteristischen Merkmale wie straffe Handlungsführung, thematische Konzentration, Dingsymbole und Leitmotive, die eine Novelle auszeichnen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Heinrich von Kleists "Das Bettelweib von Locarno", einer exemplarischen Novelle, die anhand ihrer Kürze, Realitätsbezug und thematischer Relevanz analysiert wird. Erfahren Sie, wie Kleists Werk die typischen Merkmale einer Novelle verkörpert, von der gerafften Exposition über den dramatischen Wendepunkt bis hin zur Verwendung von Symbolen und Motiven. Diese tiefgreifende Untersuchung bietet nicht nur eine umfassende Einführung in die Theorie und Geschichte der Novelle, sondern auch eine praktische Analyse, die es dem Leser ermöglicht, die Feinheiten dieser faszinierenden literarischen Form zu verstehen und zu schätzen. Ob Germanistikstudent, Literaturinteressierter oder einfach nur auf der Suche nach einer anregenden Lektüre – diese Abhandlung enthüllt die zeitlose Bedeutung der Novelle und ihre Fähigkeit, uns auch heute noch zu fesseln und zum Nachdenken anzuregen. Entdecken Sie die unerhörten Begebenheiten, die in den Seiten der Novellen verborgen liegen, und lassen Sie sich von ihrer kraftvollen Kürze überraschen. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der das Schicksal oft eine entscheidende Rolle spielt, und lernen Sie, die subtilen Botschaften zu entschlüsseln, die zwischen den Zeilen verborgen sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist eine Novelle in der Literatur ?
a) Definition
b) Form
c) Thematik
d) Typische Kennzeichen
2. Die Geschichte der deutschen Novelle und ihrer Vorläufer
3. Kennzeichen der Novelle am Beispiel Heinrich von Kleists „Das Bettelweib von Locarno“
a) Kurze Inhaltsangabe des Textes
b) Ist „Das Bettelweib von Locarno eine Novelle ?
4. Literaturangaben
1. Was ist eine Novelle in der Literatur ?
a) Definition
Gegenstand einer Novelle ist laut Definition von J.W. von Goethe „eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit“1, eine Begebenheit also, die einen gewissen Anspruch auf Wahrheit erhebt und von etwas Neuem oder Außergewöhnlichem erzählt.
Das Wort „Novelle“ stammt ursprünglich vom lateinischen „novus“ = neu bzw. von italienisch novella „Neuigkeit“.
b) Form
Die Novelle ist eine Prosa-, selten auch Verserzählung, von kürzerem oder mittlerem Umfang, die sich durch straffe, meist nur einsträngige Handlungsführung, formale Geschlossenheit und thematische Konzentration auszeichnet. Dies ermöglicht dem Leser, das Werk und seine Aussage zügig zu erfassen und motiviert somit zur Lektüre.
Als charakteristische Merkmale novellistischen Erzählens gelten, wenn auch hier wieder Ausnahmen die Regel bestätigen, die Zuspitzung auf einen „Wendepunkt“ bzw. Höhepunkt hin, eine geraffte Exposition und die Strukturierung durch ein sprachliches Leitmotiv oder Dingsymbol. Paul Heyse erläutert in seiner „Falkentheorie“ sein Idealmodell einer Novelle, wobei er sich an einer Novelle über einen Falken orientiert, daher der Name „Falkentheorie“. Bei Heyse wird der Falke zur Metapher eines Erzählens, das mit einem quasi als Dingsymbol verdichteten, immer wiederkehrenden Leitbild „in einem einzigen Kreise nur einen einzigen Konflikt“ schildern soll.
Die Novelle hat die Tendenz zur geschlossenen Form.
c) Thematik
Häufig wurden Novellen zu Zyklen verbunden oder einzelne Novellen in Rahmenerzählungen eingebettet. Diese Techniken ermöglichten, die Erzählsituation sowie die jeweiligen zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zu beleuchten und dienten auch als Spiegel der Gesellschaft.
Es wird von einer „unerhörten“, neuen sich ereigneten Begebenheit berichtet, d.h. zum Einen stellt das „eine(r)“ die Ganzheit, Einheit und vor allem die Anzahl der Begebenheit dar. Diese Einzahl der Begebenheit hängt mit der kürzeren Erzählform zusammen. Besonders die Abgrenzung zum Roman veranlasste diese numerische Kennzeichnung. Zum Anderen drückt „unerhört“ aus, dass diese Geschichte wirklich etwas Neues, niemals zuvor Erhörtes berichtet. Sie weckt die Neugierde des Lesers und regt zum Lesen an.
„Neu“ bezeichnet die zeitgenössische Aktualität und die Übertragung der Problematik auf die gegenwärtige Gesellschaft.
Der Anspruch auf einen gewissen Gehalt an Wahrheit ist nebenbei noch bemerkt wiederum ein Mittel, um auch den nicht besonders leseinteressierten Menschen zur Lektüre zu bewegen und zum Nachdenken anzuregen.
d) Typische Kennzeichen
Auch wenn, wie im weiteren nochmals aufgefasst, es sehr schwierig ist, typische Kennzeichen der Novelle zu definieren, möchte ich an dieser Stelle einige wesentliche Merkmale benennen: zum Einen eine einfache, farbige Sprache, die von einer zugleich sensationellen und alltäglichen Handlung berichtet, zum Anderen eine geringe Personen- und Seitenanzahl. Ohne Rückblenden und Einschübe wird gradlinig erzählt. Der Aufbau ist durch eine dramatische Steigerung zum Schluss hin gekennzeichnet. Die Geschehnisse spielen sich zumeist im Raum des Schicksals (sowohl als beglückende als auch als vernichtende Macht) ab, außerdem werden Dingsymbole (vergleiche hierzu die zuvor erwähnte „Falkentheorie“ nach Heyse) und Leitmotive verwandt.
Die Novelle hat den Anschein eines objektiven Berichtstils, der zumeist in eine Rahmenhandlung eingebettet ist. Diese Rahmenhandlung bewirkt Einheit, Echtheit und Abstand, der Rahmen ist für die sinntragende und wertgebende Instanz. Zwischen dem Erzählrand und dem Erzählkern besteht ebenso ein spannungsvolles Verhältnis.
2. Die Geschichte der deutschen Novelle und ihrer Vorläufer
Bei Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung der deutschen Novelle und ihrer Vorläufer ist vorweg zunächst zu bemerken, dass nicht nur Werke, die von ihrem Verfasser konkret als „Novelle“ bezeichnet wurden, zu dieser Gattung gehören, sondern durchaus Texte, die nicht so heißen, Novellen sein können. Auch muss man bei seiner Betrachtung berücksichtigen, dass es die zuvor genannten Kriterien als eine Art Richtmaß zu verwenden gilt. Eine genaue, allgemein verbindliche Erklärung kann nicht gegeben werden, da sich die Novelle in ihrer Geschichte verändert hat. Wurden zum Beispiel zunächst die Texte fast ausschließlich versisch verfasst, sind heute kaum noch Novellen in Versform zu entdecken.
Die Gattungsgeschichte der deutschen Novelle hat im Ende des 13. Jahrhunderts ihre Vorläufer. „ Dekameron “, eine durch Rahmenhandlung verknüpfte Sammlung von etwa 100 Erzählungen („ Geschichten, Fabeln, Parabeln oder wirkliche Begebenheiten, wie wir sie nennen wollen “), etwa um 1350 von Boccacio geschrieben und „ Conde Lucano “ ,etwa 50 Jahre später entstanden, sind die ersten erwähnten Werke, die maßgeblich an der Entwicklung der Novelle beteiligt waren. Deren Übersetzungen ins Deutsche durch Joseph von Eichendorff und Heinrich Schlüsselfelder leiteten den „Durchbruch der italienischen Renaissance - Novelle“2 in Deutschland ein:
„ Das Vertrautwerden mit der Novelle der Renaissance und damit mit einem Inhalt und einer Form, die den h ö chsten Stand derzeitiger Weltliteratur bezeichnete, f ü hrte in der Entwicklung einer deutschen Prosadichtung zu einer entscheidenden Wende. “
Die Konzeption des „ Dekameron “ wurde für viele Jahrhunderte Vorbild der europäischen Novellendichtung. In England nahm Geoffrey Chaucer die zyklisch Form Boccacios in seinen „ Canterbury Tales “ gegen Ende des 14. Jahrhunderts auf, zunächst allerdings noch teilweise in Versform. In Frankreich folgten um 1460 die „ Nouvelles Nouvelles “, deren Verfasser leider unbekannt blieb sowie etwa 1559 Maguerite de Navarres „ Heptam é ron “.
„ Novelle “ (1553/54) von Matteo Bandello und „ Novelas ejamplares “, 1613, Exemplarische Novellen, setzten durch ihren Verzicht auf eine Rahmenhandlung neue Akzente und zeigten, dass eine Novelle nicht notwendigerweise in eine Rahmenhandlung eingebettet sein muss. Zudem noch entfernte sich Cervantes in einem Teil seiner Novellen mit satirischen Sittenbildern und realistischen Gesellschaftsschilderungen, einem ganz neuen, bis heute wichtigen Aspekt, entschieden von der italienischen Tradition. Die Rezeption seiner Werke in Deutschland gegen Ende des 18. Jahrhunderts wirkte stark auf die Novellistik der Romantik.
Nach Vorläufern in Humanismus, Barock und Aufklärung begann 1795 mit Goethes „ Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter “, nach dem Vorbild Boccacios als Zyklus mit Rahmenhandlung mit „kreativer Erneuerung“3 angelegt, der klassische Auftakt der deutschen Novellengeschichte. Allerdings spielt hier der Novellenbegriff noch keine Rolle.
Der Zusammenhang, in dem Goethe zum ersten Mal den Begriff „Novelle“ (1808, „ Die verwunderlichen Nachbarskinder “) einführt, verwickelt die Erzählung in einen Konflikt zwischen der tragischen Wirklichkeit des Romans und dem Wunderlichen der erzählerischen Begebenheit, aus dem die Novelle als Form nicht unverwandelt hervorgeht.
Goethe verfasste 1828 die eingangs zitierte „Novelle“. Als Goethe dem bereits in den 30 Jahre zuvor entstandenen Werk den abschließenden Namen geben wollte, schwankte er zunächst zwischen „Jagd“, „Jagdgedicht“ und einfach „Novelle“. Auf die Frage eines befreundeten Schriftstellers, ob statt „Die Novelle“ nicht besser „Eine Novelle“ zu setzen sei, antwortete er:
„ Die Ü berschrift der kleinen Erkl ä rung, welche das Ganze schlie ß t, hie ß e ganz einfach: Novelle. Ich habe eine Ursache, das Wort Eine nicht davorzusetzen. “ Ein Anderer zitiert Goethe:
„ Wissen Sie was, wir wollen es die „ Novelle “ nennen; denn was ist eine Novelle anders als eine sich ereignete unerh ö rte Begebenheit. Dies ist der eigentliche Begriff, und so vieles, was in Deutschland unter dem Titel Novelle geht, ist gar keine Novelle, sondern blo ß eine Erz ä hlung oder was Sie sonst wollen “ 4 .
Goethes Entscheidung für die artikellose Form vermeidet auf der einen Seite die beliebige Einreihung in eine Kategorie, die für ihn offenkundig keine ist, andererseits läßt er den Artikel nicht zu, da ihm anscheinend an einer exemplarischen Festsetzung nicht gelegen ist.
An Goethes „Novelle“ kann also erfahren werden, dass es die umgreifende Interpretation nicht gibt.
Mit Christoph Wieland folgte mit dem „ Hexameron von Rosenhain “ der italienischen und französischen Erzähltradition. Bis hin zu Gottfried Kellers „ Sinngedicht “ aus dem Jahre 1881 entstanden immer wieder Novellenzyklen, wie z.B. Kleists Abendblätter, denen auch das im Folgenden behandelte Werk „ Das Bettelweib von Locarno “ entnommen ist. Doch trat seit der Romantik immer mehr die Einzelnovelle, zu der natürlich auch Goethes „Novelle“ zu zählen ist, in den Vordergrund.
Neue, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten gewann die Novelle in der Romantik durch die Einflechtung märchenhafter (auch durch die Gebrüder Grimm geprägt), phantastischer und dämonischer Elemente. Dies ist zum Beispiel bei Ludwig Tieck, Clemens Brentano, E:T:A: Hofmann oder Friedrich de la Motte Fourqué zu finden.
Nach der Novellistik der Biedermeierzeit, vertreten durch unter anderem Annette von Droste - Hülshoff, Jeremias Gotthelf oder auch Eduard Mörike, erreichte die deutsche Novelle im Realismus ihren künstlerischen Höhepunkt. An dieser Stelle zu nennende Autoren sind sowohl Gottfried Keller als auch Theodor Storm.
Im Kontext des Naturalismus beginnt mit „ Bahnw ä rter Thiel “ von Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann die Geschichte der modernen, viele aktuelle Anregungen aufnehmenden und von vielen Seiten beeinflussten Geschichte der deutschen Novelle.
Als wichtigste Errungenschaft ist dabei die psychologische Vertiefung, die allerdings manchmal zu Lasten einer straffen Handlungsführung ging, zu nennen. Wie bereits erwähnt, ist die Novelle immer ein Spiegel der Gesellschaft und ihrer Probleme.
Bis heute hat die deutsche Novelle weiter durch Erweiterung der formalen Ausdrucksmöglichkeiten gewonnen, nicht zuletzt durch eine Annäherung an andere Formen des Erzählens. Als einige bedeutende Werke sind an dieser Stelle „ Der Tod in Venedig “ von Thomas Mann (1913), „ Schachnovelle “ von Stefan Zweig (1942), „ Katz und Maus “ von Günther Grass (1961) oder auch „ Ein fliehendes Pferd “ von Martin Walser (1978) zu nennen.
Der Zuwachs der formalen Ausdrucksmöglichkeiten ist sicherlich in großen Teilen der Zunahme des Medieneinflusses zuzuschreiben. Es bestehen mehr Möglichkeiten der Verbreitung von Texten und die Flut von Information war niemals so groß wie heute.
Dass man heutzutage eher nicht mehr von Novellen spricht, liegt nicht etwa daran, dass es diese Gattung nicht mehr gibt, sondern dass einigen Autoren dieser Begriff nicht mehr geläufig ist oder veraltet zu sein scheint. Heutzutage wird außerdem die Abgrenzung von anderen Formen erzählender Prosa, wie zum Beispiel der Kurzgeschichte, der Erzählung oder auch dem Kurzroman, immer schwieriger.
Im angloamerikanischen Sprachraum ist die Novelle eng mit der Shortstory verwandt.
3. Kennzeichen der Novelle am Beispiel Heinrich von Kleists „Das Bettelweib von Locarno“
a) Kurze Inhaltsangabe des Textes
Die Novelle „Das Bettelweib von Locarno“ von Heinrich von Kleist, die er im 10. Abendblatt vom 11. Oktober 1810 erstmalig veröffentlichte, erzählt von einem ehemaligen Schlosses und der Begebenheit, die zu dessen Abbrand geführt hat.
In diesem, heute noch als Ruine existierenden Schloss lebte einst ein Marchese mit seiner Frau, der aus Geldnot sein Schloss verkaufen musste. Einige Jahre bevor es zu diesen ungünstigen Umständen kam, befahl der Marchese einer alten Frau, die sich in einem Zimmer des Schlosses befand, sich hinter den Ofen zu verfügen. Dies gelang ihr nur sehr schwer, sie rutschte aus und starb schließlich.
Diese alte Frau spukte nun anscheinend als Geist in den Jahren danach durch das Zimmer und verscheuchte alle Kaufinteressenten. Nachdem nun der Marchese zusammen mit seiner Frau dem Spuk selbst beigewohnt hatte, zündete er aus Furcht das Schloss an und kam schließlich auch darin um, so dass es heute nur noch als Ruine zu betrachten ist.
b) Ist „Das Bettelweib von Locarno“ eine Novelle ?
„ ...; denn keine andere Novelle tr ä gt die Merkmale [ ... ] so offenbar und unvermischt , wenngleich ihre K ü rze (3 Seiten) die Reichhaltigkeit der Ausbeute anderer Novellen von 17, 40, 45 Seiten gegen ü ber beeintr ä chtigt. “ 5
Der vorliegende Text ist insofern ein gutes Beispiel für eine Novelle, als er durch seine kurze, übersichtliche Handlung schnell lesbar ist und auf Grund der real existierenden Ruine einen deutlichen Bezug zur Wirklichkeit hat. Auch die Thematik, eine gedemütigte alte Frau aus dem einfachen Volk rächt sich an ihrem Peiniger, ist eine für die Masse der Menschen interessante Lektüre.
Die Geschichte „klärt“ außerdem auf, wie es zum Abbrand des Schlosses kam und warum heute nur noch eine Ruine vorzufinden ist. Aus diesem Grunde ist das „ Bettelweib “ sogar heute noch ein aktueller Lesestoff.
„ Das Bettelweib von Locarno “ ist formal geschlossen und weist auch die typisch einsträngige Handlungsführung auf.
Die kurze, geraffte Exposition am Anfang leitet in das Thema ein und berichtet in knappen Worten alles Notwendige.
Im weiteren Verlauf des Textes („ Mehrere Jahre darauf ... “ 6 ) wird nun beschrieben wie es zur eigentlichen Begebenheit kam: Der Wendepunkt wird mit „ Aber wie betreten ... “ 7 eingeläutet und bereitet den Höhepunkt ausgiebig vor.
Es werden viele Einzelheiten beschrieben und auch Dingsymbole wie „ St ö hnen und Ä chzen “ und „ Stroh “ werden verwendet.
Der einzige Konflikt ist die Ungerechtigkeit, die der Marchese der alten Frau angetan hat und wofür er nun büßen muss. Von einem anderen Problem wird nicht berichtet, die zuvor erwähnte „Ungerechtigkeit“ stellt folglich den zentralen Mittelpunkt der Novelle dar.
Die dramatische Steigerung zum Schluss hin ist auch klar erkennbar gegeben: zunächst wird der erste potenzielle Käufer vergrault, dann begibt sich der Marchese zunächst allein, dann mit seiner Frau auf Ursachenforschung. Seine Angst vor der umherspuktenden Alten wird schließlich so groß, dass er in Panik das Schloss anzündet und darin umkommt.
Da der Raum „Schloss“ während der ganzen Novelle nicht verlassen wird, ist auch die formale Geschlossenheit gegeben. Die umschließende Rahmenhandlung (das Schloss, dass heute noch dort steht und die Gebeine, die immer noch an der Stelle des ehemaligen Zimmers liegen) und der anscheinend objektive Berichtsstil geben weitere Merkmale für die Einordnung des Textes in die Kategorie „Novelle“.
4. Literaturangaben
Lehmann, Jakob (Hrsg.): Deutsche Novellen von Goethe bis Walser. Scriptor Taschenbücher S155. Königstein/Ts. 1980
Aust, Hugo: Novelle. 3. Auflage. Stuttgart: Metzler 1999 (Metzler Bd. 256 Sammlung)
Gassen, Kurt: Die Chronologie der Novellen Heinrich von Kleists. Reprographischer Druck der Ausgabe Weimar: 1920. Alexander Duncker, München. 1978
von Kleist, Heinrich: Das Bettelweib von Locarno. In 10. Abendblätter 11. Oktober 1810
[...]
1 Lehmann, Jakob (Hrsg.): Deutsche Novellen von Goethe bis Walser. Scriptor Taschenbücher S155 - Königstein/Ts. 1980, S. 11 - 12
2 Aust, Hugo: Novelle. 3. Auflage. Stuttgart: Metzler 1999 (Metzler Bd. 256 Sammlung). Seite 59.
3 Ebenda, Seite 70
4 Lehmann, Jakob (Hrsg.): Deutsche Novellen von Goethe bis Walser. Scriptor Taschenbücher S155 - Königstein/Ts. 1980, S. 11 - 12
5 Gassen, Kurt: Die Chronologie der Novellen Heinrich von Kleists. Reprographischer Druck der Ausgabe Weimar: 1920. Alexander Duncker, München. 1978. Seite 73
6 von Kleist, Heinrich: Das Bettelweib von Locarno. In 10. Abendblätter 11. Oktober 1810. Seite 51, Vers 23
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Novelle in der Literatur?
Eine Novelle ist laut Goethe eine "sich ereignete, unerhörte Begebenheit". Das Wort stammt vom lateinischen "novus" (neu) bzw. italienisch "novella" (Neuigkeit).
Welche Form hat eine Novelle?
Die Novelle ist eine Prosaerzählung von kürzerem bis mittlerem Umfang, gekennzeichnet durch straffe Handlungsführung, formale Geschlossenheit und thematische Konzentration. Sie zielt oft auf einen Wendepunkt oder Höhepunkt hin und nutzt sprachliche Leitmotive oder Dingsymbole.
Welche Thematik behandeln Novellen?
Novellen berichten von "unerhörten" Begebenheiten und spiegeln oft zeitgeschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge wider. Der Anspruch auf Wahrheit soll den Leser zum Nachdenken anregen.
Was sind typische Kennzeichen einer Novelle?
Typische Kennzeichen sind eine einfache Sprache, eine sensationelle und alltägliche Handlung, wenige Personen und Seiten, eine gradlinige Erzählung ohne Rückblenden, eine dramatische Steigerung zum Schluss, Geschehnisse im Raum des Schicksals sowie die Verwendung von Dingsymbolen und Leitmotive. Oftmals wird ein objektiver Berichtsstil verwendet, der in eine Rahmenhandlung eingebettet ist.
Wie hat sich die deutsche Novelle entwickelt?
Die Vorläufer der deutschen Novelle finden sich im 13. Jahrhundert. Werke wie Boccacios "Dekameron" und "Conde Lucano" beeinflussten die Entwicklung maßgeblich. Später folgten Einflüsse aus der Renaissance und Romantik. Auch die zunehmende psychologische Vertiefung und gesellschaftliche Relevanz prägten die Gattung.
Was sind die wichtigsten Merkmale der Novelle am Beispiel von Kleists „Das Bettelweib von Locarno“?
Die Novelle "Das Bettelweib von Locarno" von Heinrich von Kleist ist ein gutes Beispiel für eine Novelle, da sie durch ihre kurze, übersichtliche Handlung schnell lesbar ist und auf Grund der real existierenden Ruine einen deutlichen Bezug zur Wirklichkeit hat.
Wie wird der Handlungsbogen in „Das Bettelweib von Locarno“ aufgebaut?
Die Geschichte klärt auf, wie es zum Abbrand des Schlosses kam und warum heute nur noch eine Ruine vorzufinden ist. Die kurze Exposition leitet in das Thema ein und berichtet alles Notwendige. Der Wendepunkt bereitet den Höhepunkt vor, wobei Einzelheiten und Dingsymbole verwendet werden. Die dramatische Steigerung führt zum Anzünden des Schlosses und dem Tod des Marchese.
Welche Rolle spielt die formale Geschlossenheit in Kleists Novelle?
Die formale Geschlossenheit ist gegeben, da der Raum "Schloss" während der ganzen Novelle nicht verlassen wird. Die Rahmenhandlung und der objektive Berichtsstil unterstreichen die Einordnung in die Kategorie "Novelle".
- Quote paper
- Schaf Anke (Author), 2000, Kennzeichen der Novelle am Beispiel Heinrich von Kleists „Das Bettelweib von Locarno“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96730