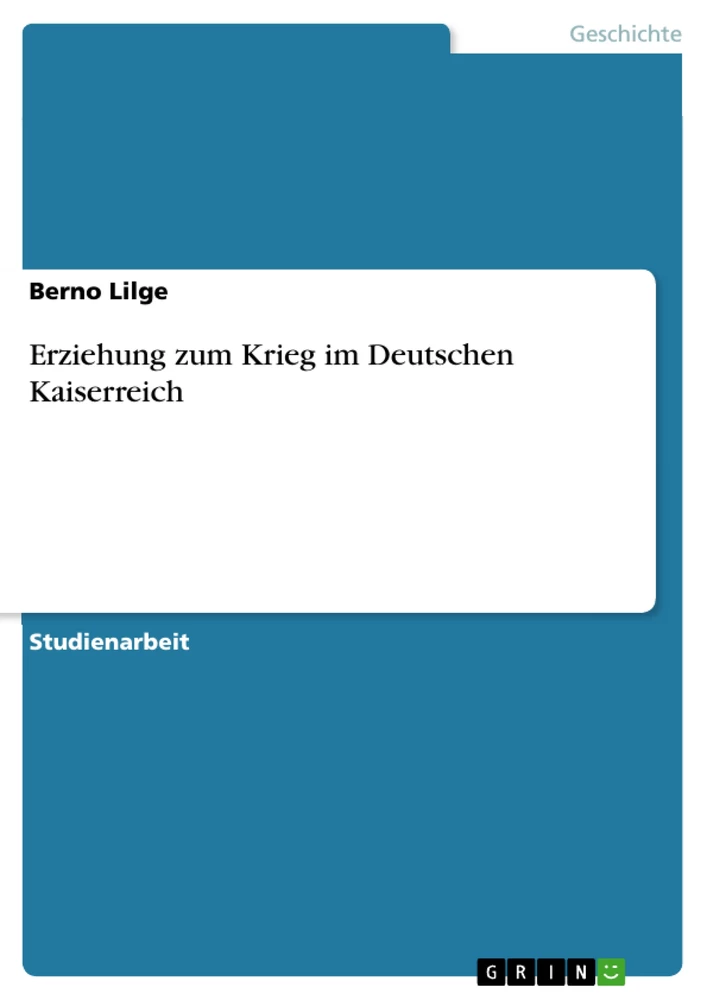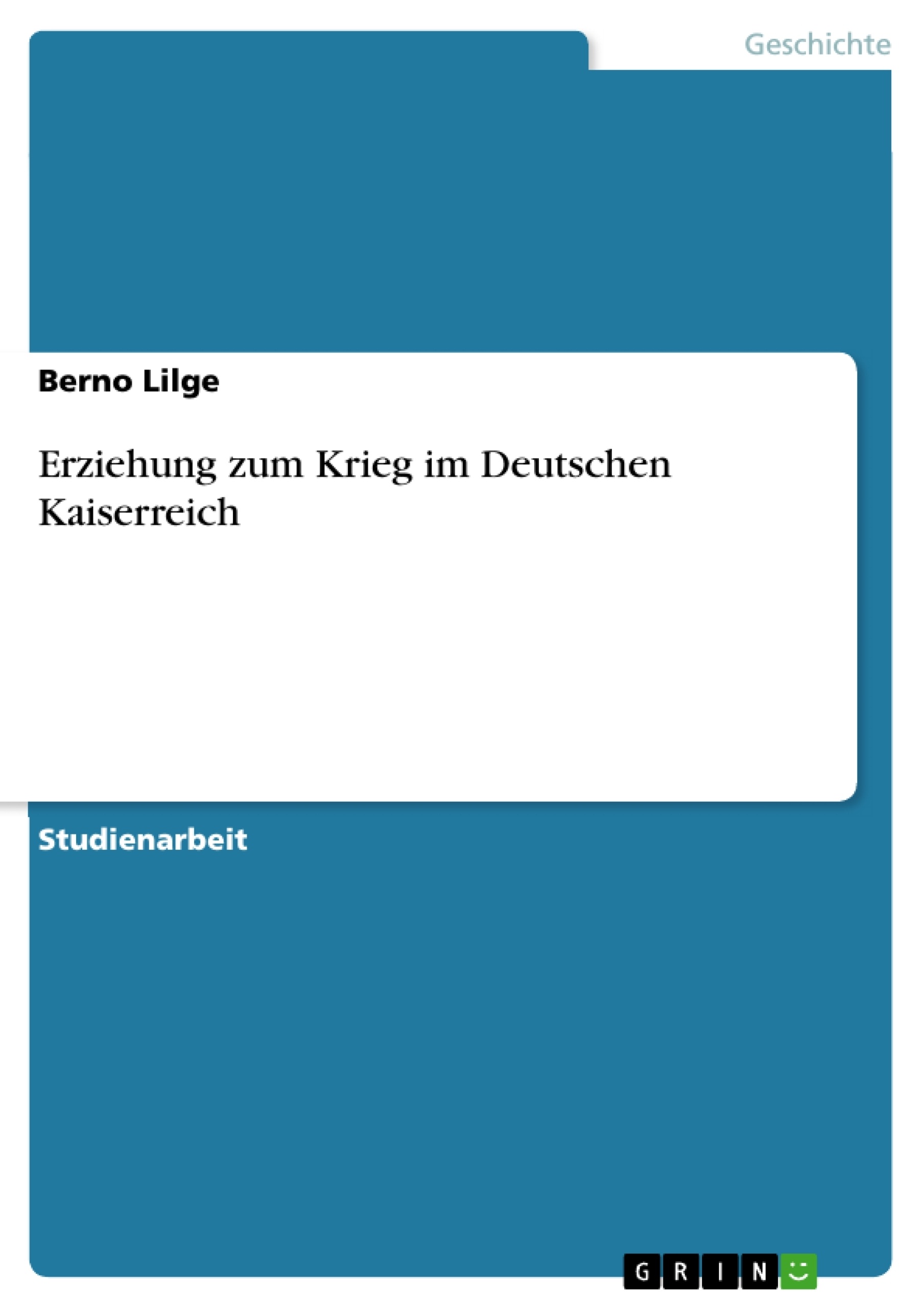Abstract: Erziehung zum Krieg im deutschen Kaiserreich
Bei der Auseinandersetzung mit der Erziehung im Deutschen Kaiserreich zwischen 1890 und bis zum Ausbruch des Krieges 1914 steht vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Wie konnte eine derart hohe Akzeptanz des Krieges in der deutschen Gesellschaft entstehen? Die Antwort darauf ist deswegen so brisant, weil Erziehung und Schule damals wie heute in erster Linie der Strukturierung einer hierarchisch aufgebauten Gesellschaft dienen. Vornehmlich das Interesse der politisch Herrschenden an der Erhaltung des bestehenden staatlich-gesellschaftlichen Systems entscheidet dabei über die Gestaltung des Schulunterrichtes.
Der vorliegende Aufsatz versucht deutlich zu machen, wie der direkte Zugriff auf die Schule durch den Staat im Deutschen Kaiserreich mit dem Ziel der Erziehung zum Krieg erfolgte und welche geistigen Grundlagen dies ermöglichten.
Nach einer Einleitung und der Beschreibung der Vorgeschichte, untersucht der Autor die Ziele der Berliner Schulkonferenz vom Dezember 1890 und deren Folgen. Es wird klar, dass Wilhelm II die Schule als Waffe erkannt hatte und sie gezielt einsetzen wollte, um kommende Generation so zu erziehen, dass sie für die Zwecke nationaler und zunehmend imperialer Ziele ebenso zur Verfügung stand wie zur Abwehr politischer Umwälzungen im Bereich der Innenpolitik.
Ein entscheidender Beweggrund für die deutschen Hoheitsansprüche auf die Weltherrschaft war der feste Glaube bei den deutschen Nationalisten– ganz im Sinne einer religiösen Überzeugung – an die kulturelle Überlegenheit des Deutschen, an die Kulturmission zum Heil der restlichen Welt.
Deshalb unternimmt der Autor abschließend einen Exkurs in den Bereich der Deutschtumsmetaphysik und Kriegserziehung. Untersucht wird das Germanentum als Leitbild und Eckpfeiler des deutschen Nationalismus. Nach den Weltkriegen wurde besonders dessen mangelnde Durchsetzungskraft, nicht zuletzt durch ungenügende Vermittlung in den Schulen, von den Nationalisten immer wieder als Hauptursache für die verloren Kriege bemüht.
Berno Jannis Lilge
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorgeschichte
- Die Berliner Schulkonferenz vom Dezember 1890 über Fragen des höheren Unterrichts und die Folgen
- Exkurs: Deutschtumsmetaphysik und Kriegserziehung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz befasst sich mit der Erziehung zum Krieg im Deutschen Kaiserreich zwischen 1890 und 1914 und untersucht, wie eine derart hohe Akzeptanz des Krieges in der deutschen Gesellschaft entstehen konnte. Im Fokus steht die Rolle von Schule und Bildung in der Konstruktion einer nationalistischen und militaristischen Identität sowie die Frage, wie diese Prozesse die Kriegsbegeisterung im August 1914 hervorbrachten.
- Die Bedeutung von Schule und Bildung in der Konstruktion einer nationalistischen und militaristischen Identität
- Die Rolle von Erziehungshandbüchern und Militär in der Formung von Untertanentreue und Gehorsam
- Die Verbindung von nationaler Identität und Kriegsideologie
- Die Auswirkungen der Industrialisierung und der Sozialdemokratie auf die Kriegserziehung
- Die Bedeutung von Wilhelm II. und seiner Vorstellung von Schule als Waffe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beginnt mit einem Zitat von Otto v. Gottberg, das die damalige Vorstellung von Krieg als hehrste und heiligste Äußerung menschlichen Handelns deutlich macht. Der Autor stellt die Entwicklung vom Krieg als physische Zerstörung zum Krieg als strukturelle Gewalt dar und betont, dass eine Gesellschaft nur dann Krieg führen kann, wenn der Krieg als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen akzeptiert wird. Der Text beleuchtet die Bedeutung von Erziehung und Schule in der Formierung dieser Akzeptanz.
Die Vorgeschichte
Der Text zeichnet die Vorgeschichte der Kriegserziehung im Deutschen Kaiserreich nach. Er beleuchtet die militaristische Prägung des preußischen Staates und die zunehmende Bedeutung des Militärs im gesellschaftlichen Leben. Der Text beschreibt die Ausprägung militärischer Wertvorstellungen und Denkstrukturen im Laufe des 19. Jahrhunderts sowie die Bedeutung des Reserveoffiziers für die gute Gesellschaft. Des Weiteren wird die Rolle von Kriegervereinen und die nachhaltige Nationalisierung und Militarisierung des zivilen Lebens durch militärische Umgangsformen thematisiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind Kriegserziehung, Nationalismus, Militarismus, Schule, Bildung, Untertanentreue, Gehorsam, preußischer Staat, Reserveoffizier, Sozialdemokratie, Industrialisierung, Wilhelm II. Der Text beleuchtet den Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und untersucht, wie sie zur Konstruktion einer Kriegsakzeptanz im Deutschen Kaiserreich beitrugen.
- Quote paper
- Berno Lilge (Author), 1997, Erziehung zum Krieg im Deutschen Kaiserreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/966