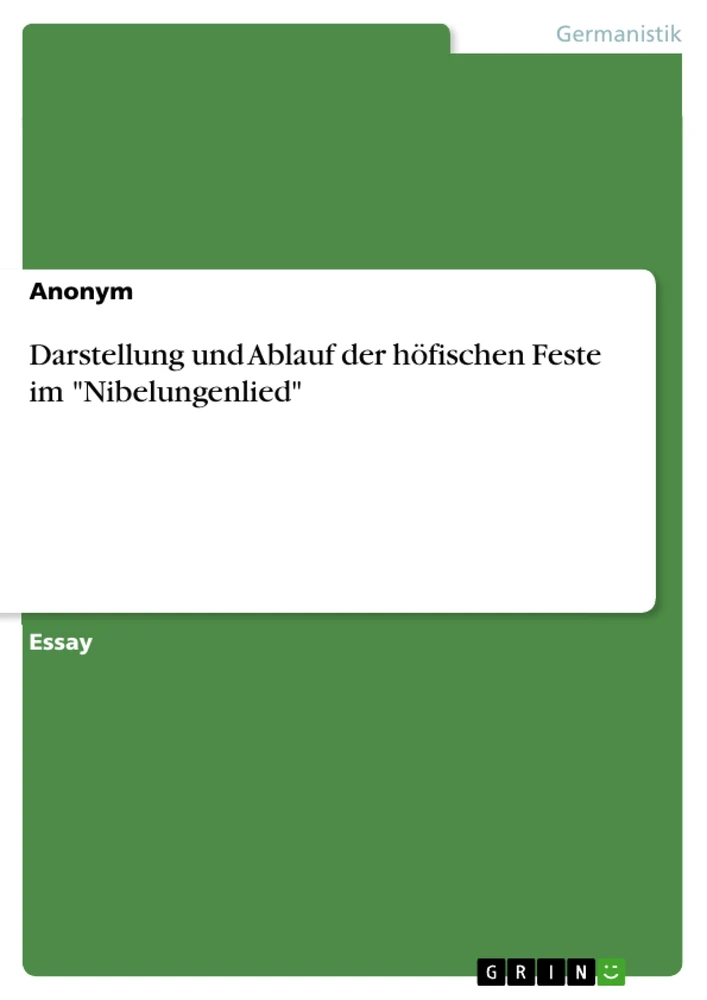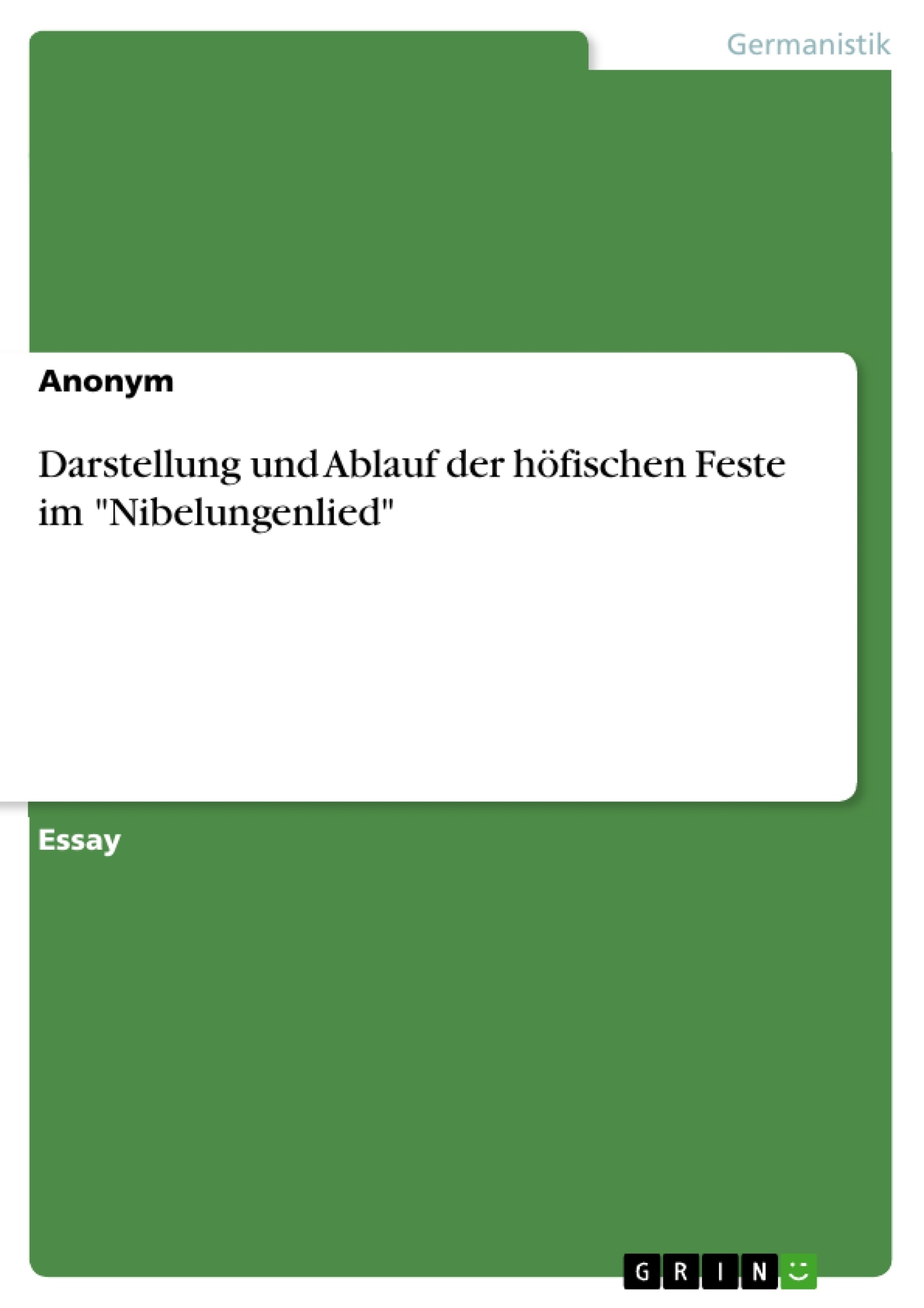Siegfrieds Schwertleite, das Siegesfest, die Doppelhochzeit von Kriemhild und Siegfried sowie Brünhild und Gunther, das Hoffest, Etzels und Kriemhilds Hochzeit wie auch Kriemhilds Rachefest: Es ist bei Weitem kein Zufall, dass derart viele Feste im „Nibelungenlied“ geschildert werden. Sie sind nicht nur Schauplatz der Handlung, sondern vielmehr eine dramaturgische Notwendigkeit, schafft jenes Siegesfest doch eine Begegnungsmöglichkeit zwischen Kriemhild und Siegfried ebenso zu Gunthers Gunsten wie seine Heirat mit Brünhild im Rahmen der Doppelhochzeit. Auch das Hoffest wird durch Brünhilds Absicht, Kenntnis über Siegfrieds tatsächlichen Rang bzw. seine Verbindung zu Gunther zu erlangen, ausgerichtet, wobei sich ihr Verdacht im Festverlauf zunehmend durch die – aus ihrer Sicht –völlig unpassenden höfischen Konventionen, die Siegfried entgegengebracht werden, bestätigt. Offenkundig reicht der Zweck der geschilderten Feste also weit über die allgemeinen ‚Feierlaune‘ oder vröude hinaus; dieser muss mehr noch im Kontext der höfischen Kultur verstanden werden, dienen die Festlichkeiten doch primär der Bildung, Bestätigung und Legitimation der feudalen Ordnung wie auch der politischen Machtverhältnisse, die durch höfische Feste und Zeremonien sichtbar gemacht werden.
Doch die gut dokumentierte und gesicherte Forschungslage zur höfischen Epik mit den prachtvollen Festen am Artushof, denkt man etwa an Hartmanns von Aue „Erec“ und „Iwein“ oder Wolframs von Eschenbach „Parzival“, steht im direkten Kontrast zu jener der Heldendichtung, die schlichtweg als inferior beschrieben werden muss. Vor diesem Hintergrund hat der vorliegende Essay zum Ziel, die großen höfischen Feste des „Nibelungenlieds“ zu untersuchen, wobei die wiederkehrenden Abläufe bzw. inhaltlichen Regelmäßigkeiten, ähnlich Ritualen, sowie deren Funktionen im Zentrum stehen sollen. Das Heldenepos erweist sich hinsichtlich der in den Feierlichkeiten dargestellten höfischen Elementen, wozu beispielsweise die edlen Kleider oder die zur Schau gestellten Tugenden wie êre und mílté, als sehr ergiebig und in weiterer Folge geeignet. Forschungsgegenstand bilden die fünf der insgesamt sechs Feste im „Nibelungenlied“; auf das letzte (Kriemhilds Rachefest vgl. NL 1387-2379 ) wird hingegen verzichtet, da dieses im direkten Vergleich zu den übrigen inhaltlich stark aus dem Rahmen fällt und sich daher als nicht repräsentativ für die Arbeit offenbart.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Realität oder literarische Überhöhung?
- Zur Terminologie des Festes
- Abläufe der Feste im „Nibelungenlied“
- Einladung
- Vorbereitungen
- Ankunft und Empfang
- Festmahl
- Unterhaltung
- Beschenkung zum Abschied
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die höfischen Feste im „Nibelungenlied“ mit dem Ziel, ihre Funktionen und Abläufe im Kontext der höfischen Kultur des Mittelalters zu beleuchten. Das Augenmerk liegt dabei auf der Frage, inwiefern die Feste die feudale Ordnung und politische Machtverhältnisse widerspiegeln und gleichzeitig literarische Überhöhungen oder Idealbilder repräsentieren.
- Die Rolle von Festen in der höfischen Kultur
- Die Beziehung zwischen literarischer Darstellung und historischer Realität
- Die Funktion von Festen im „Nibelungenlied“
- Die Bedeutung von Rituellen und Konventionen im höfischen Kontext
- Die Darstellung von Macht und Reichtum in den Festen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung skizziert die Relevanz der Feste im „Nibelungenlied“ als dramaturgische Elemente und stellt die Forschungsfrage nach ihrer Bedeutung im Kontext der höfischen Kultur.
- Historische Realität oder literarische Überhöhung?: Dieses Kapitel diskutiert die Frage, inwiefern die literarischen Darstellungen der Feste der historischen Realität entsprechen oder eher als Überhöhungen oder Idealbilder zu verstehen sind. Hier werden verschiedene Forschungsperspektiven und Interpretationen des Verhältnisses von Literatur und Wirklichkeit in der höfischen Epik beleuchtet.
- Zur Terminologie des Festes: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung des Begriffs „Fest“ im Kontext der mittelhochdeutschen Dichtung und geht auf verschiedene Arten von höfischen Festen ein, wie z. B. Hochzeiten, Krönungsfeiern und Schwertleiten. Es wird auch die Bedeutung von Festen als Mittel zur Repräsentation von Macht und Reichtum sowie zur Knüpfung politischer Beziehungen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Essays sind höfische Feste, „Nibelungenlied“, höfische Kultur, feudale Ordnung, politische Machtverhältnisse, literarische Überhöhung, historische Realität, Rituale, Konventionen, Repräsentation, Machtdemonstration, Reichtum, politische Beziehungen. Diese Begriffe verweisen auf die Kernaspekte der Forschung, die sich auf die Analyse der Feste und ihrer Bedeutung im Kontext der mittelhochdeutschen Literatur und Kultur fokussieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Darstellung und Ablauf der höfischen Feste im "Nibelungenlied", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/962831