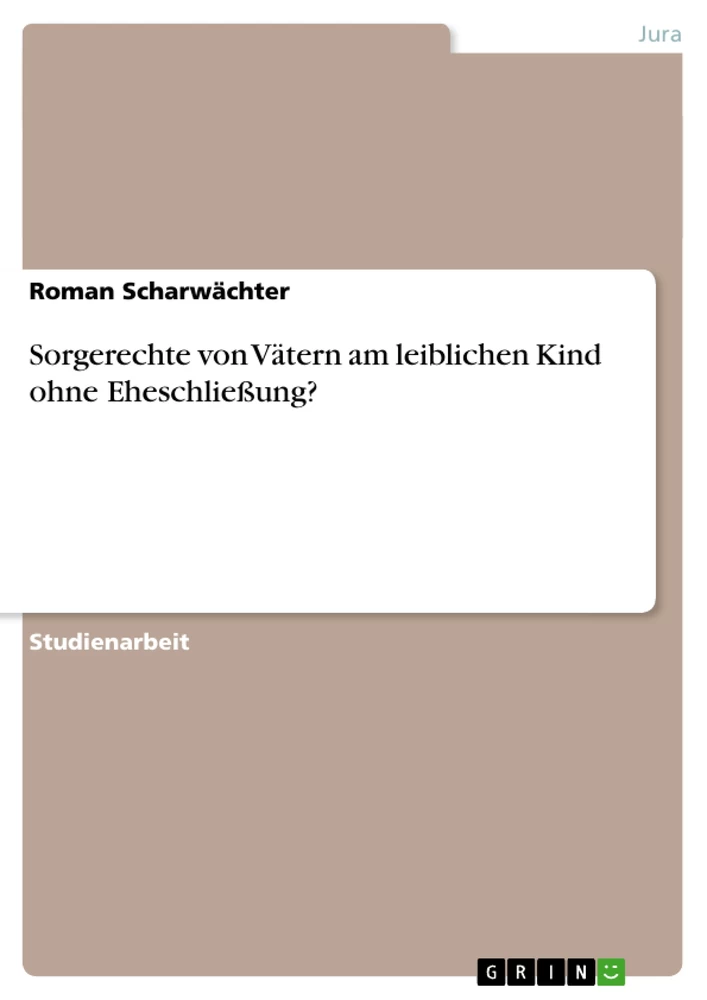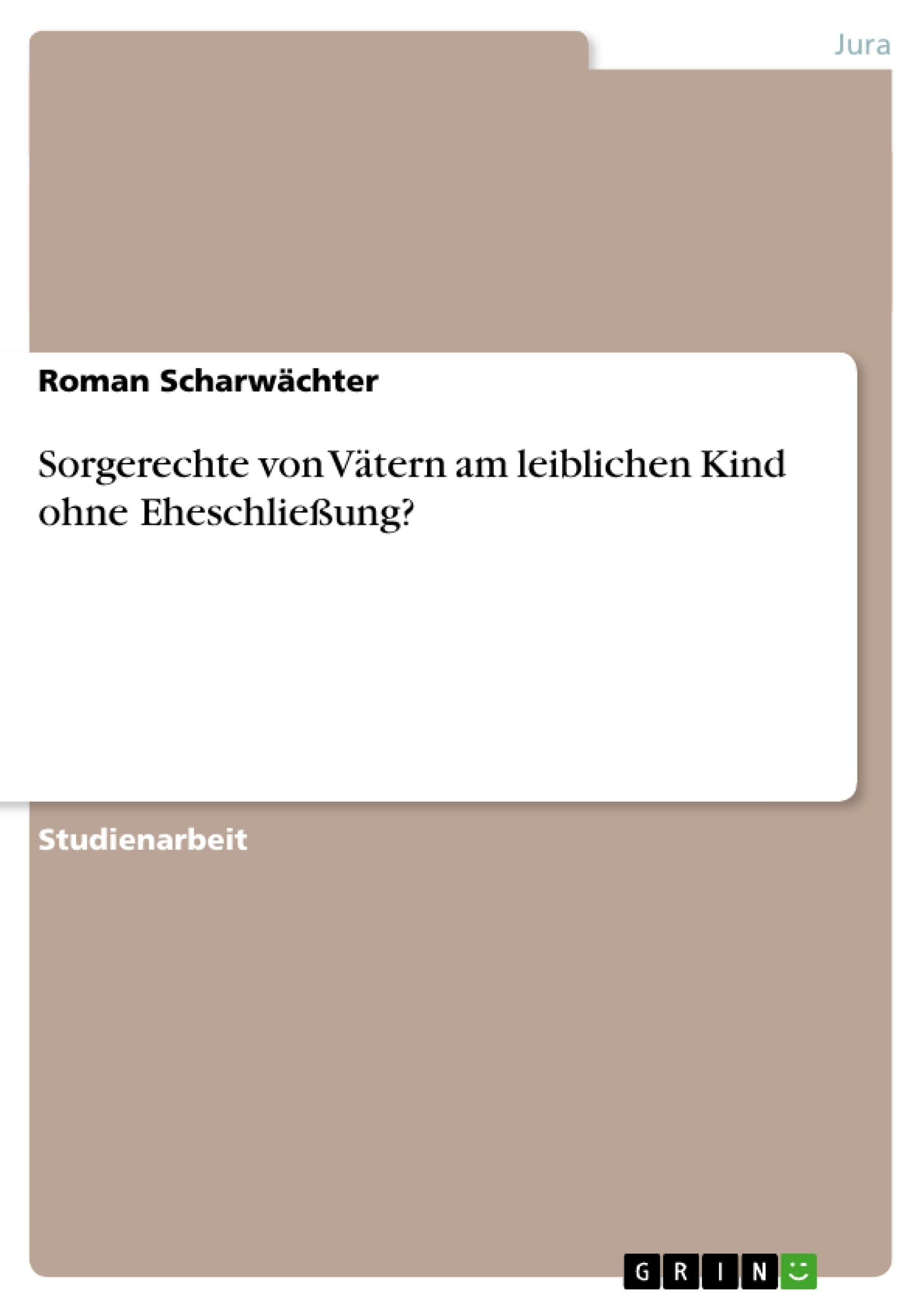Inhalt:
1. Einführung und Problemstellung
1.1. Beschluß des BVerfG vom 07.03.95
1.2. Personensorgerecht im BGB
1.3. Entwurf zur Reform des Kindschaftsrechts vom 24.07.95
1.4. Problemstellung
2. Historische Entwicklung
3. Derzeitige Regelung des nichtehelichen Sorgerechts im BGB
4. Rechtsfolgen des Reformentwurfs
5. Verfassungsrechtliche Bewertung nach Artikel 3 und 6 GG 12
5.1. Artikel 3 GG
5.2. Artikel 6 GG
6. Schlußfolgerung und Lösungsvorschläge
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Einführung und Problemstellung
1.1. Beschluß des BVerfG vom 07.03.1995
Mit Beschluß vom 07.03.1995 hat das BVerfG (1 BvR 790/91 u.a.) eine Entscheidung zur Rechtsstellung von Vätern bei der Adoption nicht- ehelicher Kinder getroffen. Nach dieser Entscheidung sind Väter nicht- ehelicher Kinder „unabhängig davon, ob sie mit der Mutter des Kindes zusammenleben oder mit dieser gemeinsam die Erziehungsaufgaben wahrnehmen, Träger des Elternrechtes aus Art. 6 II 1 GG.“1In diesem Beschluß argumentiert das BVerfG im wesentlichen und grundsätzlich, daß der in Art. 6 II 1 GG verwendete Begriff „der Eltern“ nach allgemeinen Sprachgebrauch auch die leiblichen Eltern eines nichtehelichen Kindes einschließe. Damit werde das Elternrecht also zwei Personen gemeinsam zugeordnet. Das BVerfG schließt daraus, daß beide leiblichen Elternteile in den Schutzbereich des Grundrechts einbezogen seien. Es sei nicht ge- rechtfertigt, das Elternrecht bei nichtehelichen Kindern von vornherein nur einem Elternteil zuzuordnen. Eine Beschränkung des Grundrechts auf die nichteheliche Mutter, ließe sich auch deshalb nicht mehr rechtfertigen, weil heute ein nicht geringer Teil der Väter Anteil an der Entwicklung ihrer nichtehelichen Kinder nähme. Dem Wortlaut und Gehalt der verfassungs- rechtlichen Garantie werde am besten eine Auslegung gerecht, die grund- sätzlich alle Väter nichtehelicher Kinder in den Schutzbereich der Norm aus Art. 6 II 1 GG einbeziehe.
1.2. Personensorgerecht im BGB
Die Bestimmungen zum Sorgerecht umfassen im wesentlichen die Rege- lungen im BGB 4. Buch 2. Abschnitt, 5. und 6. Titel §§ 1626 bis 1711. Nach der in § 1626 dargelegten Definition, umfaßt die elterliche Sorge,
das Recht und die Pflicht für die Sorge der Person des Kindes (Perso- nensorge) und die Sorge für das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). Die Personensorge umfaßt insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Die Vermögenssorge umfaßt das Recht und die Pflicht, das Vermögen des Kindes zu verwalten.2
Aus den Bestimmungen des BGB lassen sich drei grundsätzliche Tatbestände ableiten die gesetzlich geregelt sind:
a. Sorgerecht verheirateter Eltern (§ 1626 ff. BGB) steht beiden Eltern gleichberechtigt zu.
b. Sorgerecht nach Scheitern und Scheidung der Ehe (§ 1671 ff. BGB) Entscheidung durch das Gericht, gemeinsamer Antrag der Eltern auf einvernehmliche Regelung möglich. Bei der Entscheidung ist das Kindeswohl zu beachten
c. Sorgerecht über Kinder ohne Eheschließung der Eltern (§ 1705 ff. BGB) Das Sorgerecht steht, mit Einschränkungen [bestellter Pfle- ger], der Mutter zu.
Der unter c. beschriebene Grundtatbestand soll in dieser Arbeit weiter betrachtet werden.
1.3. Entwurf zur Reform des Kindschaftsrechts vom 24.07.1995
Obwohl sich der o.a. Beschluß des BVerfG auf Verfassungsbeschwerden hinsichtlich des Einspruchsrechts von leiblichen Vätern bei der vorgese- hen Adoption durch die Mutter oder ihres Ehemanns bezieht, hat dieser wegen seiner grundsätzlichen Bemerkungen zum Elternrecht von nichtehe- lichen Vätern, Auswirkungen auch auf die Diskussion zum Sorgerecht von Vätern leiblicher Kinder die nicht mit der Mutter verheiratet waren und sind.
Diese Auswirkung zeigt sich bereits in einem von der Bundesministerin der Justiz a.D., Leuthäuser-Schnarrenberger vorgelegten ReferentInnen- entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts vom 24.07.1995. Nach diesem Entwurf soll es zukünftig möglich sein, daß unverheiratete Eltern die Sorge über das Kind gemeinsam ausüben wenn sie „erklären, daß sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklärung)...“3Der jetzige sechste Titel, § 1705 ff. BGB würde dadurch entbehrlich. Bedeutsam ist diese neue Regelung in Zusammenhang mit der geplanten Neufassung des § 1671 BGB. Demnach (§ 1671 BGB-E) soll, wenn die Eltern denen die gemeinsame Sorge zusteht - eben auch durch die Sorgeerklärung - dauernd getrennt leben, jedes Elternteil beantragen können, „ daß ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt.“4
1.4. Problemstellung
Aus diesem Regelungszusammenhang ergibt sich, daß demnach ein Familiengericht den Fortbestand der gemeinsamen Sorge faktisch erzwingen, bzw. die alleinige elterliche Sorge auch auf den Vater übertragen kann. Auch dann, wenn die Eltern des Kindes nicht miteinander verheiratet waren. Entscheidend ist, ob die Eltern zu irgendeinem Zeitpunkt eine Erklärung über die gemeinsame Wahrnehmung der elterlichen Sorge abgegeben haben. Dies war bisher nicht möglich.5
Nichtehelichen Vätern erwächst, sollte der Reformentwurf Gesetz werden, eine Rechtsstellung gegenüber den Kindern und insbesondere gegenüber der Mutter, die sie bisher nicht inne hatten.
Inhalt dieser Arbeit soll es sein, unter Rückgriff auf die historische Entwick- lung, die Überlegungen des Reformentwurfs - zur Regelung des Sorge- rechts bei nichtverheirateten Eltern - danach zu betrachten, welche Aus- wirkungen die vorgesehenen Änderungen auf die Rechtsstellung von Frauen in diesem Zusammenhang haben, und auf Grundlage einer verfassungsrechtlichen Betrachtung zu Lösungen zu kommen.
2. Historische Entwicklung
Vor etwa 15 Jahren hat sich das BVerfG bereits mit den Grenzen eines gemeinsamen elterlichen Sorgerechts, außerhalb des „Normal“-Falles (verheiratet, zusammenlebend) beschäftigt. Das Gericht hielt die Folgen eines Sorgerechtes auch für die nichtehelichen Väter, für so schwerwiegend, daß es keine mit der Verfassung begründbare Verpflichtung erkannte, die für verheiratete geltenden Bestimmungen des Sorgerechts auch auf unverheiratete Paare zu übertragen.6
„Gegner eines gemeinsamen Sorgerechts der Eltern nichtehelicher Kin- der kommen vor allem aus christlich-konservativen Kreisen. Sie sehen das Institut der Ehe in Gefahr, wenn Männern der letzte Anreiz genommen wird, die von ihnen geschwängerten Frauen zu heiraten.“7Demgegenüber steht die Argumentation, daß Väter die rechtlich von der Verantwortung für das Kind ausgeschlossen seien, schwerlich zu motivieren seien, die tat- sächliche Verantwortung für das Kind zu übernehmen.8Damit ist die Hoff- nung verbunden, eine Veränderung der geschlechtlichen Arbeitsteilung und eine Entlastung von den einseitig verteilten Lasten der Mutterpflichten zu erreichen. In einem Aufsatz von Sibylla Flügge, (Ambivalenzen im Kampf um das Sorgerecht, in Streit 1/91) resümiert die Autorin, daß eine Analyse der Geschichte des Sorgerechts, jedoch erhebliche Zweifel ent- stehen lasse, daß diese Erwartung realistisch sei. Historisch gesehen, lasse sich nämlich zusammenfassen, „daß die Rechtsposition der Frauen gegenüber den Kindern immer schwächer wurde, je mehr ihnen die tat- sächliche Verantwortung für die Kinder überlassen wurde.“9
Danach bezog sich das formelle Sorgerecht im Mittelalter, in erster Linie auf das Recht zur Verheiratung der Kinder. Einen absoluten Ausschluß der Frauen vom Entscheidungsrecht habe es, als Rechtsgrundsatz, nicht ge- geben. Die tatsächliche Versorgung und Erziehung erfolgte im Prinzip durch beide Elternteile, tatsächlich aber durch Ammen, Kindermädchen oder ältere Frauen. Nichtehelichkeit sei weder Makel noch Anlaß für recht- liche Differenzierung gewesen. Hatte eine Frau ein Kind von einem Mann, mit dem sie nicht zusammenlebte, oblag es ihrer Entscheidung das Kind zu dem Vater zu bringen, der dann für das Kind aufzukommen hatte.
Einen grundsätzlichen Wandel, habe das Verhältnis von Frauen und Män- nern in Bezug auf das Sorgerecht, während der Reformationszeit erfahren. Frauen waren von jeglicher Herr(!)schaftsgewalt, im Haus wie in der Öf- fentlichkeit, ausgeschlossen und sollten vor allem Kinder gebären. Daraus folgten einschneidende Konsequenzen für die nichteheliche Mutter, da voreheliche Sexualität nicht mehr durch formelle Buße getilgt werden konnte, sondern Ausdruck charakterlicher Verworfenheit geworden sei. Verstöße gegen die Moral seien zunehmend mit Hilfe weltlichen Rechts gesühnt und mit Ehrlosigkeit und dem Ausschluß von Ämtern und ehren- haften Berufen geahndet wurden. Dies traf die Väter in schärferer Weise als die Mütter. Daraus folgte, ein großes Interesse die Vaterschaft zu ver- schweigen. Wurde ein Mann trotzdem der Vaterschaft überführt, hätte er kaum die Möglichkeit gehabt, eine positive Beziehung zu dem Kind zu entwickeln. So sei die ledige Mutter, die alleine für Ihr Kind sorgen und entscheiden mußte, zwar eine typische Erscheinung, der soziale Rahmen aber in dem sie sich hätte bewegen können, sei so beengt gewesen, daß im Grunde kein Entscheidungsspielraum mehr übrig blieb.
In der Neuzeit sei es, mit dem Beginn der Industrialisierung, zu einer im- mer weiter um sich greifenden Trennung von Hausarbeits- und Erwerbs- arbeitsplatz gekommen, die im Hinblick auf die Sorge für die Kinder zu einer Vertiefung der geschlechtlichen Arbeitsteilung führte. Aus humanitä- ren wie politischen Gründen, sei die strafrechtliche Verfolgung nichteheli- cher Mütter zwar abgemildert worden. Die Väter seien aber keineswegs verpflichtet gewesen, eigenhändig für ihre Kinder zu sorgen. Das am 1.1.1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetzbuch bestimmte, daß die Mütter verpflichtet wurden die Kinder zu pflegen, die tatsächliche Ausübung des Sorgerechtes aber in Gestalt eines staatlich kontrollierten Vormundes nicht der Mutter übertragen wurde.
Diese vollkommene Rechtlosigkeit der nichtehelichen Mutter, habe bis 1970 bestanden, als für diese ein eingeschränktes Sorgerecht eingeführt wurde. Ein uneingeschränktes Sorgerecht gäbe es auch heute nur auf Antrag und in den von den Gerichten gesetzten Grenzen.
Sibylla Flügge stellt, im Ergebnis in dem o.a. Aufsatz, fest, daß Frauen die rechtliche Einflußnahme auf ihre Kinder, in dem Maße verloren, wie sie vom Mann ökonomisch und persönlich abhängig wurden. Frauen gelang es erst dann wieder, ein formelles Sorgerecht zu erlangen, als sie ver- stärkt politische und individuelle Entscheidungsrechte, als auch eine grö- ßere Bereitschaft der Väter zur persönlichen Fürsorge für die Kinder, ein- forderten. Damit sei aber keineswegs eine Rückkehr zu mittelalterlichen Strukturen verbunden, sondern die Anerkennung der Tatsache, daß in un- serer Kultur und Gesellschaft in erster Linie die Mutter für das Wohlerge- hen ihrer Kinder verantwortlich gemacht wird.10
Vor diesem historischen Hintergrund erscheint m.E. die Forderung nach Gleichberechtigung der nichtehelichen Väter, in Bezug auf die elterliche Sorge der nichtehelichen Mutter, als Versuch patriarchale Strukturen weiterhin beizubehalten. Insofern zeigt m.E. auch die Eingangs angeführte Entscheidung des BVerfG vom 07.03.1995 in diese Richtung.
3. Derzeitige Regelung des nichtehelichen Sorgerechts im BGB
Die elterliche Sorge steht nach § 1705 BGB der nichtehelichen Mutter zu, nicht auch dem Vater. Ihre Stellung gleicht der alleinstehenden ehelichen Mutter. Nach § 1706 BGB wird der nichtehelichen Mutter allerdings ein Pfleger für das Kind beigeordnet (i.d.R. das Jugendamt), der die dort nä- her beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen hat. Insbesondere: Feststel- lung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kin- des, Erbschaftsangelegenheiten des Kindes. Nur auf Antrag der Mutter und wenn dies dem vom Vormundschaftsgericht angenommenen Wohle des Kindes nicht widerspricht, besteht nach § 1707 BGB die Möglichkeit, die (Amts-)Pflegschaft nicht eintreten zu lassen, aufzuheben oder den Wirkungskreis des Pflegers einzuschränken. Das Gericht kann seine Ent- scheidung ändern, wenn dies seiner Auffassung nach für das Wohl des Kindes erforderlich ist.11
Ist eine Pflegschaft eingerichtet, kann die Mutter in den Wirkungskreis des Pflegers nicht eingreifen (§ 1630 BGB).
4. Rechtsfolgen des Reformentwurfs
Dieses, und das Recht der elterlichen Sorge allgemein, erfährt im o.g. Entwurf eine grundlegende Umgestaltung. Einen besonderen Regelungs- komplex zur elterlichen Sorge für nichteheliche Kinder soll es, wie erwähnt, nicht mehr geben. Der Entwurf will damit eine unterschiedliche Behand- lung von verheirateten und nicht miteinander verheirateten Eltern abbau- en.12
Im Mittelpunkt steht dabei die bereits erwähnte Vorschrift in § 1626a BGB-E. Hiernach steht Eltern eines nichtehelichen Kindes die gemeinsa- me Sorge für das Kind zu wenn sie erklären, daß sie die Sorge gemein- sam ausüben wollen. Damit können die leiblichen Eltern ein gemeinsa- mes Sorgerecht begründen, unabhängig davon ob sie zusammenleben oder nicht, oder mit einer anderen Person verheiratet sind oder nicht.13 Gibt eines der beiden Elternteile eine solche Sorgeerklärung nicht ab, verbleibt das alleinige Sorgerecht bei der Mutter des Kindes. Auf Antrag eines der beiden Sorgeberechtigten hat das Familiengericht die elterliche Sorge nur dann auf ein Elternteil zu übertragen, soweit das andere Elternteil zustimmt, es sei denn das Kind ist vierzehn und älter und widerspricht der Übertragung, oder wenn das Gericht zu der Auffassung gelangt, die Übertragung auf ein Elternteil entspreche dem Wohl des Kin- des am besten. Trifft eine dieser Bedingungen nicht ein, bleibt es bei der gemeinsamen Ausübung der elterlichen Sorge.14
Mit dieser Regelung wird die gemeinsame Ausübung des Sorgerechts zum - möglicherweise nicht gewollten - Regelfall. Nebenbemerkung: Insbesondere da das gleiche Verfahren auch bei dauernd getrennt und/oder in Scheidung lebenden Paaren anzuwenden ist.
Ähnlich in der Auswirkung übrigens auch die Entwürfe von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, in denen weder die Begründung, der Erhalt, noch die Übertragung der gemeinsamen elterlichen Sorge zur Bedingung ha- ben, daß das betroffene Kind bei den Eltern lebt und die Eltern über die bloße gemeinsame Erklärung hinaus nicht nur formal die Verantwortung übernehmen, sondern auch tatsächlich der damit verbundenen Sorgever- pflichtung nachkommen.15
Bisher war das Sorgerecht über nichteheliche Kinder der Mutter zugesichert (Einschränkungen ergaben sich durch die Bestellung amtlicher Pfleger) und keinesfalls dem Vater, so werden letztere nunmehr einen starken Ausbau ihrer Rechtsstellung erfahren.
Zukünftig wird - sollte der Entwurf Realität werden - möglicherweise folgender Ablauf denkbar sein:
Zwei Menschen die in Zuneigung zueinander ein Kind gezeugt haben, ü- berlegen sich eine gemeinsame Sorgeerklärung abzugeben. Möglicher- weise leben sie bereits zusammen oder entscheiden sich jetzt dazu. Die Mutter kümmert sich vorrangig um die Betreuung des Kindes und verzich- tet deswegen auch später auf eine (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit. Der Vater des Kindes geht wie bisher gewohnt seinem Alltag nach. Nach geraumer Zeit stellen diese beiden oder eines der beiden Menschen fest, daß ihre Zuneigung zueinander nicht mehr besteht und eine Fortsetzung ihrer Be- ziehung nicht mehr gewollt ist. Sie trennen sich, und wenn sie miteinander gewohnt haben, zieht eines der beiden Elternteile aus der gemeinsamen Wohnung aus.
Trotz der Trennung werden anfänglich noch gemeinsam alle das Kind betreffenden Fragen miteinander besprochen und einvernehmlich ent- schieden. Doch mehr und mehr muß die Mutter des Kindes die alleinige Entscheidung und Verantwortung übernehmen. Immer häufiger kommt es auch zu Auseinandersetzungen. Sie stellt daher bei Gericht den Antrag, ihr alleine das Sorgerecht zu übertragen. Der Vater des Kindes stimmt die- sem Antrag nicht zu und auch das Gericht sieht sich außerstande festzu- stellen, daß der Antrag der Mutter dem Kindeswohl am besten ent- spreche.
Bei einer solchen Konstellation, also ohne Übereinstimmung der Eltern, bliebe es zwangsweise bei der einmal, unter ganz anderen Voraussetzungen abgegeben gemeinsamen Sorgeerklärung.
Das BVerfG hat in der eingangs erwähnten Entscheidung, dem Gesetz- geber eine weitreichende Gestaltungsbefugnis zugestanden, die im vor- liegenden Entwurf aber offensichtlich nicht genutzt wird. Das BVerfG hat in dieser Entscheidung festgehalten, daß Rechte und Pflichten im Elternrecht untrennbar miteinander verbunden seien und daß die Wahrnehmung der Rechte sich am Kindeswohl auszurichten hätten. Es obliege daher dem Gesetzgeber, den einzelnen Elternteilen bestimmte Rechte und Pflichten zuzuordnen. Die Gestaltungsbefugnis sei um so größer, je weniger von einer Übereinstimmung der Eltern ausgegangen werden könne und je we- niger eine soziale Bindung zwischen einem Elternteil und dem Kind vor- handen sei.16
Bei der Ausgestaltung der Rechte von Vätern nichtehelicher Kinder dürfe der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung tragen, daß soziale Bindungen zu den Kindern nicht voraussetzbar seien und berücksichtigen, ob der Vater Interesse an der Entwicklung des Kindes zeige.
Selbst diese Gestaltungsbefugnis ist in dem Entwurf nicht wahrgenommen worden.
5. Verfassungsrechtliche Bewertung nach Artikel 3 und 6 GG
5.1. Artikel 3 GG
Es stellt sich die Frage, ob die beschriebene Rechtsfolge, aus dem Reformentwurf, nicht eine unzulässige Einschränkung der grundgesetzlichen Rechte von Frauen und Müttern auf persönliche Freiheit und Gleichheit, wie sie in Art. 3 und 2 GG garantiert sind, bedeutet.
Die o.a. Sorgerechtskonstruktion vergibt einseitig Rechte, und zwar an die Väter die keine oder nur wenige Pflichten in diesem Zusammenhang aus- zuüben haben. Demgegenüber werden die Rechte der Mütter, denen ein- seitig die Pflichten und die Verantwortung zur Erfüllung bleiben, stark ein- geschränkt.
In aller Regel sind es eben die Mütter, denen vor und jedenfalls nach einer Trennung die alleinige Ausführung der Sorgepflicht zukommt. Hinzu kommt das Mütter, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, auf Ausbildungs- und Erwerbsmöglichkeiten und Chancen verzichten. Die Verantwortung für die Ausübung der Sorge bedeutet eine Einschränkung ihrer privaten Le- bensplanung, Gestaltung ihrer persönlichen Freizeit und oder Verzicht auf Geld.17
Ihr gegenüber steht der Vater, auf Grund des Sorgerechts ausgestattet mit einer Menge von Rechten, die aber in keiner Weise zu ihren Verpflichtungen in Relation stehen.
Eine solche ungleiche Verteilung von Rechten und Pflichten widerspricht nicht nur Art. 3 II GG, sondern sie beseitigt damit auch eine bisher in § 1705 ff. BGB bestehende Kompensation.
5.2. Artikel 6 GG
Der Art. 6 GG stellt Ehe und Familie unter den besonderen Schutz des Staates. Damit wird eine Garantie für diese Institutionen abgegeben. Ohne eine Ehe kann es also auch keine Garantie geben, da die Bedin- gung für diese Garantie nicht vorliegt. In der Ehe haben die Eltern ge- meinsame Rechte, da sie sich per (gesetzlichen) Vertrag darauf verstän- digt haben. Bleibt für nicht verheiratete allenfalls die Möglichkeit der freien Übereinkunft, mit der Möglichkeit diese auch wieder aufzuheben.18 Nun mag eingewendet werden, daß zumindest im Falle des Zusammenle- bens eine Familie bestanden hätte, unabhängig von der Eheschließung. Und von daher sei möglicherweise Art 6 GG anzuwenden. Das trifft zu, solange die Familie besteht. Trennen sich die Eltern, besteht auch die Familie nur noch aus einem Elternteil (i.d.R. der Mutter) und den Kindern. Das andere Elternteil (i.d.R. der Vater) ist faktisch aus dem Familienver- band ausgeschieden und bedarf daher nicht mehr des besonderen Schut- zes durch den Staat. Im übrigen wäre ein Familienbegriff (im Ursprungs- sinn eine Hausgenossenschaft), der unabhängig von dem Bestehen einer Ehe ausgeht, auf das Elternteil anzuwenden, welches mit den Kindern lebt. Die Schutzgarantie des Staates hätte sich also darauf zu beziehen.
6. Schlußfolgerung und Lösungsvorschläge
Vor dem Hintergrund der über Jahrhunderte verfestigten Bevormundung und Benachteiligung von nichtehelichen Müttern und ihren Kindern, ist wohl nur schwer von einer Priveligierung zu sprechen, wenn der nichtehelichen Mutter grundsätzlich das alleinige Sorgerecht in vollem Umfange zustehen würde. Die vorgesehene Reform des Sorgerechtes für nichteheliche Müt- ter und Väter, kann unter den genannten Voraussetzung zu einer m.E. un- gerechtfertigten Stärkung der rechtlichen Stellung des nichtehelichen Va- ters führen. M.E. führen die Folgen dieses Reformentwurfes, sollte er Ge- setz werden, nicht zu einer stärkeren Beteiligung der Väter an der elterli- chen Fürsorge, sondern zu einem Ausgleich für den i.d.R. nicht gegebe- nen Einfluß der Väter auf die Erziehung des Kindes.
Es erscheint mir offensichtlich, daß eine Reform des nichtehelichen Sor- gerechts, mit der Möglichkeit der gemeinsamen Sorge, nur sinnvoll und handhabbar ist, wenn die nichteheliche Mutter, bei der das Kind in den meisten Fällen lebt, sich freiwillig auf die Einmischung des Vaters in Sor- gerechtsangelegenheiten einlassen will und diese Einmischung ggf. wie- der beenden kann. Einer solchen freiwilligen Übertragung des Sorge- rechts auf den Vater, stehen schon die derzeitigen Bestimmungen nicht entgegen. Nichts hindert die Mutter, den Vater an der Wahrnehmung des Sorgerechts teilhaben zu lassen, wenn sie denn damit einverstanden ist. Eine sinnvolle Reform bestünde m.E. darin,
a. Die bisherigen Bestimmung der §§ 1705 BGB ff. werden so geändert, daß der nichtehelichen Mutter das alleinige Sorgerecht im vollen Um- fang zusteht.
b. Auf ihren Antrag hin wird für bestimmte, genau umschriebene Sorge- rechtsbereiche, Hilfe (z.B. durch das Jugendamt) durch eine Delegie- rung von Aufgaben gewährt. Die Mutter hat das Recht diese Delegie- rung zurückzunehmen. (Umkehrung von § 1706)
c. Wenn nichteheliche Mutter und nichtehelicher Vater übereinkommen, das Sorgerecht gemeinsam ausüben zu wollen, so können sie dies im Wege der freien vertraglichen und widerruflichen Vereinbarung be- schließen. Über die Mindestanforderungen an eine solche Vereinba- rung (z.B. Form und Inhalt, notarielle Beurkundung, Registrierung o.ä.) sind entsprechende Bestimmungen zu erlassen, die Raum lassen, an- tragsabhängig und unter Beachtung der jeweiligen individuell unter- schiedlichen Lebens- und Sozialbeziehungen, Vereinbarungen zu tref- fen. Im Falle des Widerrufs einer solchen vertraglichen Regelung eines gemeinsam ausgeübten Sorgerechts hätte dies (wieder) derjenigen (oder seltener auch demjenigen) zuzufallen, bei der (dem) das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Lehrbücher:
Joachim Gernhuber, Lehrbuch des Familienrechts, 3. Auflage, München 1980
Günther Beitzke, Familienrecht, 25. Auflage, München 1988
Kommentar:
Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 50. Auflage, München 1990
Zeitschriften:
NJW, 1995, Heft 33 FamRZ, 1995, Heft 24, hier: Aufsatz von Ute Walter, Das Kindschaftsreformgesetz STREIT, 1983, Heft 1 hier: Jutta Bahr-Jendges, Gemeinsames Sorgerecht nach Trennung und Scheidung und: Sibylla Flügge, Kein gemeinsames Sorgerecht ohne Ehe STREIT, 1991, Heft 1 hier: Sibylla Flügge, Ambivalenzen im Kampf um das Sorgerecht STREIT, 1995, Heft 4 hier: Jutta Bahr-Jendges, Alle Jahre wieder: Gemeinsame oder alleinige elterliche Sorge - Den Vätern das Recht, den Müttern die Sorge
[...]
1BVerfG, Beschl. v. 7.3.1995 - 1 BvR 790/91 u.a., Zit. n. NJW 1995, Heft 33, S. 2155 ff.
2 Vgl. Joachim Gernhuber, Lehrbuch des Familienrechts, 3. Aufl., München 1980, § 53 f; Günther Beitzke, Familienrecht, 25. Aufl., München 1988, § 27 f.; Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 50. Aufl., München 1990, § 1626, Rn. 12 ff.
3§ 1626a BGB-E, Zit. n. Jutta Bahr-Jendges, Alle Jahre wieder:..., STREIT, Heft 4 1995, S. 152
4 § 1671 BGB-E, a.a.O. S. 151; Vgl. auch Ute Walter, Das Kindschaftsreformgesetz, in FamRZ 1995, Heft 24, S.1540
5Vgl. Jutta Bahr-Jendges, in Alle Jahre wieder:..., STREIT, Heft 4 1995, S.151 f
6BVerfG Urt. v. 24.03.1981, 1 BvR 1516/78, BvR 1337/80 in FamRZ 81, S.429; Sibylla Flügge, Kein
gemeinsames Sorgerecht ohne Ehe in STREIT Heft 1 1983 S.24ff. und Sibylla Flügge, Ambivalenzen im Kampf um das Sorgerecht in STREIT Heft 1 1991 S.4
7Sibylla Flügge, Ambivalenzen im Kampf um das Sorgerecht, a.a.O.
8 ebenda, Günther Beitzke, Familienrecht, 25.Aufl., München § 30 III
9 Sibylla Flügge, Ambivalenzen im Kampf um das Sorgerecht, a.a.O., S.5
10 Ähnlich auch Jutta Bahr-Jendges, Gemeinsames Sorgerecht ... in STREIT Heft 1 1983 S.15 f.
11Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch , 50.Aufl., München 1991, S.1715 ff.; Beitzke Günther, Famili- enrecht, 25, Aufl., München, § 30 I,; Joachim Gernhuber, Handbuch des Familienrechts, 3. Aufl., Mün- chen 1980, § 58
12 Vgl. Ute Walter, Das Kindschaftsreformgesetz, in FamRZ 1995, Heft 24, S.1540
13ebenda
14Vgl. Jutta Bahr-Jendges, in Alle Jahre wieder:..., STREIT Heft 4 1995, S.152
15 Vgl. Jutta Bahr-Jendges, in Alle Jahre wieder:..., STREIT Heft 4 1995, S.152 f
16Vgl. BVerfG, Beschl. V. 7.3.1995 - 1 BvR 790/91 u.a. in NJW 1995, Heft 33, S. 2156
17 Vgl. Jutta Bahr-Jendges, in Alle Jahre wieder:..., STREIT Heft 4 1995, S.154
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit zum Sorgerecht?
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Reform des Kindschaftsrechts, insbesondere mit den Auswirkungen der geplanten Änderungen auf das Sorgerecht nichtehelicher Kinder. Sie untersucht, ob der Reformentwurf zu einer Stärkung der rechtlichen Position des nichtehelichen Vaters führt und welche Konsequenzen dies für die Mütter und die verfassungsrechtliche Gleichstellung hat.
Was war der Anlass für die Reformüberlegungen zum Sorgerecht?
Ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 07.03.1995 zur Rechtsstellung von Vätern bei der Adoption nichtehelicher Kinder. Das BVerfG stellte fest, dass auch nichteheliche Väter Träger des Elternrechts aus Art. 6 II 1 GG sind, was Auswirkungen auf die Diskussion um das Sorgerecht nichtverheirateter Eltern hat.
Wie ist das Sorgerecht für nichteheliche Kinder derzeit im BGB geregelt?
Nach § 1705 BGB steht das Sorgerecht grundsätzlich der nichtehelichen Mutter zu. Allerdings wird der Mutter nach § 1706 BGB ein Pfleger für das Kind beigeordnet (in der Regel das Jugendamt), der bestimmte Aufgaben wahrnimmt, z.B. die Feststellung der Vaterschaft oder die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
Was sieht der Reformentwurf für das Sorgerecht nichtehelicher Kinder vor?
Der Reformentwurf sieht vor, dass es zukünftig möglich sein soll, dass unverheiratete Eltern die Sorge über das Kind gemeinsam ausüben können, wenn sie eine sogenannte Sorgeerklärung abgeben (§ 1626a BGB-E). Damit soll eine unterschiedliche Behandlung von verheirateten und nicht miteinander verheirateten Eltern abgebaut werden. Gibt kein Elternteil eine solche Erklärung ab, verbleibt es beim alleinigen Sorgerecht der Mutter.
Welche Bedenken werden gegen den Reformentwurf geäußert?
Es wird befürchtet, dass die Möglichkeit der gemeinsamen Sorge zu einer ungewollten Stärkung der rechtlichen Position des nichtehelichen Vaters führen könnte, ohne dass dieser zwangsläufig mehr Verantwortung für das Kind übernimmt. Dies könnte die Rechte der Mütter einschränken, denen in der Regel die Hauptverantwortung für die Betreuung und Erziehung des Kindes zukommt.
Welche verfassungsrechtlichen Aspekte werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit untersucht, ob die geplante Rechtsfolge aus dem Reformentwurf eine unzulässige Einschränkung der grundgesetzlichen Rechte von Frauen und Müttern auf persönliche Freiheit und Gleichheit (Art. 3 und 2 GG) darstellt. Zudem wird die Frage geprüft, inwieweit Art. 6 GG (Schutz von Ehe und Familie) auf nichteheliche Lebensgemeinschaften anwendbar ist.
Welche Lösungsvorschläge werden in der Arbeit unterbreitet?
Es wird vorgeschlagen, dass der nichtehelichen Mutter weiterhin grundsätzlich das alleinige Sorgerecht in vollem Umfang zustehen sollte. Hilfe für bestimmte Sorgebereiche sollte auf ihren Antrag hin durch eine Delegation von Aufgaben gewährt werden. Wenn nichteheliche Eltern das Sorgerecht gemeinsam ausüben wollen, sollten sie dies im Wege einer freien, vertraglichen und widerruflichen Vereinbarung beschließen können.
Welche historische Entwicklung wird im Zusammenhang mit dem Sorgerecht betrachtet?
Die historische Entwicklung zeigt, dass die Rechtsposition der Frauen gegenüber den Kindern im Laufe der Geschichte schwächer wurde, je mehr ihnen die tatsächliche Verantwortung für die Kinder überlassen wurde. Frauen gelang es erst wieder, ein formelles Sorgerecht zu erlangen, als sie verstärkt politische und individuelle Entscheidungsrechte einforderten.
Was sind die wesentlichen Paragraphen aus dem BGB die betrachtet werden?
Hauptsächlich die Paragraphen §§ 1626 bis 1711 BGB, speziell § 1705 BGB, welche die derzeitige Regelung des nichtehelichen Sorgerechts festlegt, und der Entwurf des § 1626a BGB-E, der die gemeinsame Sorge nichtehelicher Eltern regeln soll.
- Arbeit zitieren
- Roman Scharwächter (Autor:in), 1995, Sorgerechte von Vätern am leiblichen Kind ohne Eheschließung?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96052