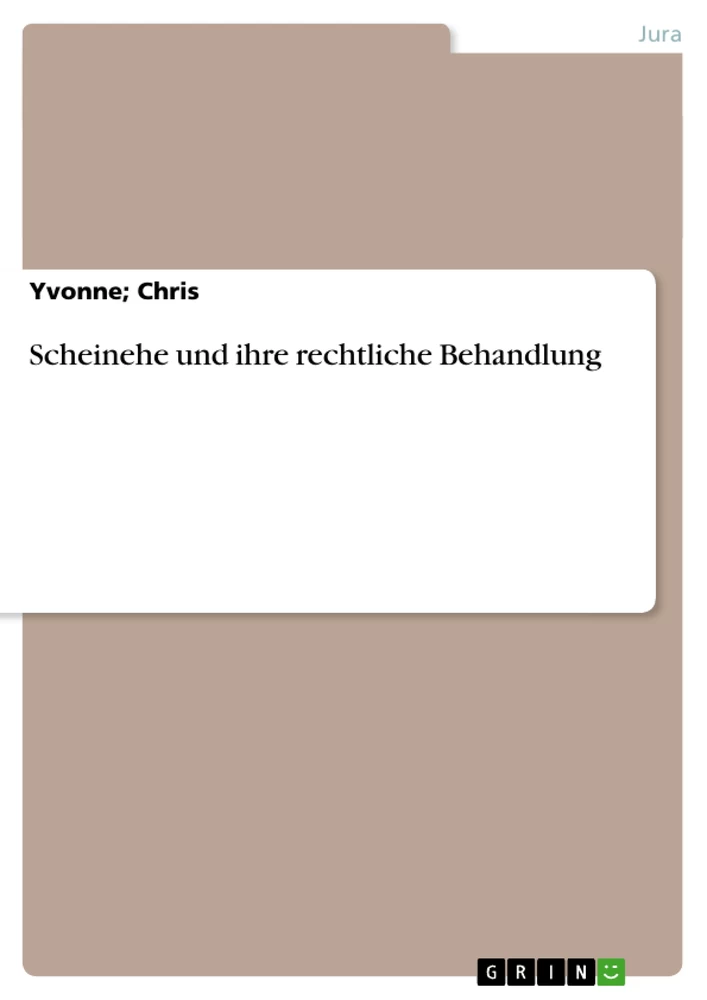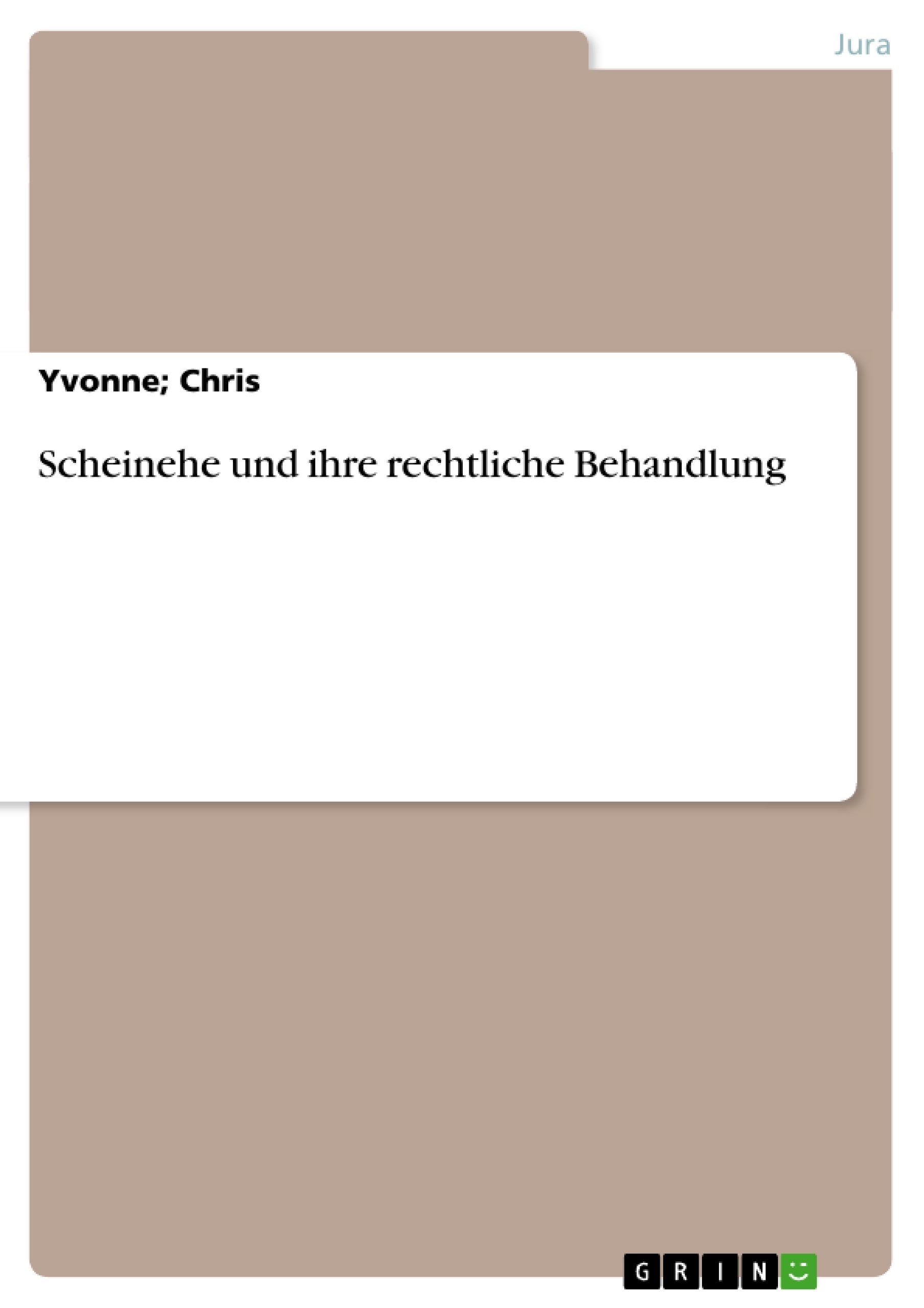Was geschieht, wenn Liebe und Recht in Konflikt geraten? Diese Frage durchdringt die komplexe Materie der Scheinehe, ein Phänomen, das seit Jahrzehnten Juristen, Standesbeamte und Ausländerbehörden vor immense Herausforderungen stellt. Die vorliegende Analyse beleuchtet die vielschichtige Problematik der Scheinehe im deutschen Rechtssystem, von ihrer historischen Entwicklung über die verschiedenen Erscheinungsformen bis hin zu den rechtlichen Konsequenzen. Im Fokus stehen die Rechte und Pflichten der beteiligten Akteure: Welche Rolle spielt der Standesbeamte bei der Aufdeckung von Scheinehen, und inwieweit darf er die Eheschließung verweigern? Welche Befugnisse hat die Ausländerbehörde, wenn der Verdacht besteht, dass eine Ehe lediglich zum Zweck der Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis geschlossen wurde? Das Buch untersucht detailliert die einschlägigen Gesetze und Rechtssprechungen, darunter das Ehegesetz (EheG), das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Ausländergesetz (AuslG), und analysiert, inwieweit diese Regelungen dem Schutz der Ehe gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes (GG) gerecht werden. Dabei werden auch die Spannungen zwischen dem Schutz der Ehe und dem öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Missbrauch aufenthaltsrechtlicher Vorteile thematisiert. Die Analyse zeigt, dass das deutsche Rechtssystem zwar Abwehrmöglichkeiten gegen Scheinehen bietet, aber auch mit erheblichen Rechtsunsicherheiten und Wertungswidersprüchen zu kämpfen hat. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen der einzelnen Ausländerbehörden und die fehlende Rechtsklarheit in Bezug auf die Befugnisse des Standesbeamten werden kritisch beleuchtet. Abschließend werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Einführung eines "Greencard-Modells" nach amerikanischem Vorbild und die Schaffung einheitlicher europäischer Richtlinien, um das Problem der Scheinehe effektiver zu bekämpfen. Eine unverzichtbare Lektüre für Juristen, Verwaltungsangestellte und alle, die sich für die Schnittstelle von Recht, Migration und gesellschaftlichen Werten interessieren. Tauchen Sie ein in ein hochaktuelles Thema, das die deutsche Rechtslandschaft nachhaltig prägt und dringend einer Klärung bedarf. Entdecken Sie die verborgenen Winkel der Gesetzgebung und die komplexen Entscheidungen, die hinter jeder Eheschließung stehen können.
Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung
B. Die historische Entwicklung der Scheinehe und ihre Behandlung
C. Die Erscheinungsformen der Scheinehe
D. Die rechtliche Behandlung von Scheinehen
I. Welche Folgen hat die Eingehung einer Scheinehe?
II. Die Rolle des Standesbeamten
III. Die Rolle der Ausländerbehörde
IV. Schutz der Ehe durch Art. 6 I GG
E. Zusammenfassung und Stellungnahme
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Einleitung
Einleitend soll kurz erläutert werden, was man unter dem Begriff "Scheinehen" versteht, warum sie früher für nichtig erklärt wurden und auch heute noch problematisiert werden.
Als Scheinehe bezeichnet man Ehen, die nur zur Herbeiführung gewisser Nebenwirkungen der Ehe bzw. zur Erlangung bestimmter daran geknüpfter Vorteile geschlossen werden, während das Brautpaar eine eheliche Lebensgemeinschaft nicht aufnehmen will.1
Diese Auffassung von Ehe stimmt jedoch nicht mit dem eigentlichen Sinn der Institution Ehe überein.
Ehe ist die mit Eheschließungswillen eingegangene, staatlich anerkannte Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau.
Sie begründet demnach eine eheliche Lebensgemeinschaft2. Zum Begriff der Ehe gehört auch, daß sie von beiden Partnern als dauernde Gemeinschaft beabsichtigt und versprochen wird und daß sie auch nach ihrem Inhalt auf Lebenszeit angelegt ist.3 Das ergibt sich vorallem aus §1353 BGB.
Die sog. Namensehe und die Staatsangehörigkeitsehe sind die beiden am häufigsten diskutierten Arten der Scheinehe. Bei Scheinehen, die heute eingegangen werden, geht es primär darum eine Aufenthaltserlaunis bzw. eine Arbeitserlaubnis zu erlangen.
Die Scheinehe unterscheidet sich somit von der Auffassung der Ehe in zwei Punnkten: Die Scheinehe will keine Lebensgemeinschaft gründen und ist evtl. auch nicht auf Lebenszeit angelegt. Aufgrund dieser Diskrepanz galt früher die Nichtigkeit von Scheinehen. Diese Wirkung wurde jedoch ausdrücklich im Ehegestz wieder aufgehoben.
Trotz dieser Aufhebeung ist das Thema Scheinehe und ihre Behandlung auch heute noch aktuell und umstritten. Aktuell vorallem durch die Rückführung z. B. der Bosnien-Flüchtlinge und die damit verbundene plötzlich steigende Zahl von Hochzeiten mit deutschen Ehepartnern.
B. Die historische Entwicklung der Scheinehe und ihre Behandlung
Schon 1918 wurde der Mißstand der sog. Namensehe bemerkbar. Träger adliger Namen heirateten gegen Bezahlung Frauen, die im Gegenzug für ihr Entgelt in Zukunft einen adligen Namen tragen durften. Es kam nicht zu einer Lebensgemeischaft und noch vor der Eheschließung wurde die baldige Scheidung verabredet, so daß der Mann seinen Titel auf diese Weise weiterverkaufen konnte. Um diese Art von Schachergeschäften in der Familienrechtsordnung zu unterbinden, führte der Gesetzgeber 1933 den § 1325a in das BGB ein, durch den die Namensehen für nichtig erklärt wurden.
§ 1325a BGB wurde durch das Ehegesetz von 1938 aufgehoben. Zu der Nichtigkeitserklärung von Namensehen kam nun noch die Nichtigkeitserkärung von Staatsangehörigkeitsehen, die eine Ehe für nichtig erklärte, wenn die Eheschließung nur den Staatsangehörigkeitserwerb für die Frau bezwecken sollte, ohne daß eine eheliche Lebensgemeinschaft angestrebt wurde ( §§ 23, 29 EheG 1938).4
Das Ehegesetz von 1946 hob die Nichtigkeitserklärung von Staatsangehörigkeitsehen wieder auf, so daß gemäß § 16 EheG von 1946 die Nichtigkeit ausschließlich und abschließend nur noch für die Namensehe (§ 19 EheG von 1946) galt. Alle anderen Scheinehen waren gültige Ehen. Der Gesetzgeber glaubte wohl, daß zu der damaligen Zeit die Staatsangehörigkeit ohnehin nicht mehr sehr attraktiv war und wollte außerdem einem Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht weiter entgegenstehen.
Im Laufe der Zeit kamen jedoch immer mehr Zweifel auf, ob die Nichtigkeit von solchen Ehen das richtige Mittel zur Bekämpfung von Scheinehen war. Namensehen wurden immer weniger, ließen sich nur schwer nachweisen und außerdem erschien es nicht gerecht, Namensehen für nichtig zu erklären, aber andere Arten von Scheinehen als gültige Ehen zu behandeln.5
Durch Gesetz vom 14.06.1976 wurde dann auch das Verbot der Namensehe (§19 EheG von 1946) außer Kraft gesetzt. Somit hat der Gesetzgeber zwei ursprüngliche Eheverbote (Namens- und Staatsangehörigkeitsehe) ausdrücklich aufgehoben. Daraus kann man schließen, daß die Motive, warum eine Ehe eingegangen wird, keine Rolle mehr spielen sollen.6 Trotzdem wird die Scheinehe auch heute noch in rechtlicher Hinsicht sehr unterschiedlich behandelt. In den beiden letzten Jahrzehnten geht es vorallem um eine andere Art der Scheinehe, nämlich um Ausländer, die hoffen, mit Hilfe eines deutschen Ehepartners eine Aufenthalterlaubnis zu bekommen.7
C. Die Erscheinungsformen der Scheinehe
Unter der Bezeichnung der Scheinehe kann man die verschiedenen Erscheinungsformen der Ehe zusammenfassen, bei denen die Beteiligten aus unterschiedlichen Gründen keine "eheliche Lebensgemeinschaft" begründen wollen oder können.8
Von "Scheinehen" wird nun nicht etwa bei allen Ehe gesprochen, die nicht zu einer Lebensgemeinschaft führen, vielmehr haben sich in der Praxis bestimmte Gruppen dieser Ehe gebildet.
Waren früher die Gründe, das eine Ehe zum Schein geschlossen wurde, die erleicherter Zuweisung einer Wohnung9, den Erhalt einer Strafvergünstigung, eines Zeugenverweigerungsrechts, der Erhalt einer Witwenrente oder um erlangen, so sind heute die Namensehe Staatsangehörigkeitsehe Formen der Scheinehe. Steuervorteile zu und die die pobulärsten Bei der Namensehe, ist die Eingehung einer Ehe ausschließlich oder vorwiegend zu dem Zweck, dem einen Ehepartner die Führung des Familiennamens des anderen Ehepartners zu ermöglichen.10Oft ist damit die Erlangung eines adligen Namens verbunden, als ein noch aktuelles Beispiel dient die Heirat Hohenzollern.
Bei der Staatsangehörigkeitsehe wird die Ehe nur zu dem Zweck eingegangen, dem Ehepartner die Staatsangehörigkeit des anderen Ehepartners zu verschaffen.
Die Voraussetzung dafür, daß ein Ausländer mit einem Deutschen die Ehe eingehen darf, richtet sich ausschließlich nach dem Heimatrecht des Ausländers. Dies ergibt sich aus Art. 13 Abs.1 EGBGB. Gemäß § 10 EheG wird dazu von dem ausländischen Verlobten ein Ehefähigkeitszeugnis seines Heimatlandes gefordert, aus dem sich ergibt, daß der Ehe kein Hindernis entgegensteht. Eine Befreiung von der Vorlage eines Ehefähigkeitszeugnisses ist gemäß § 10 Abs.2 EheG durch den Oberlandesgerichtspräsidenten möglich.11
In den letzten Jahrzehnten ging es vorallem um Ehen unerwünschter Ausländer, die hofften, mittels eines deutschen Ehepartners eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen.12
D. Die rechtliche Behandlung von Scheinehen
I. Welche Folgen hat die Eingehung einer Scheinehe?
Die Scheinehe könnte einen Mißbrauch der Institution Ehe darstellen, weil sie ausschließlich aus Gründen geschlossen wird, die mit den Grundprinzipien der Ehe nicht vereinbar sind, wie z.B. zur Erlangung der Aufenthaltserlaubnis.
Aus diesem Grund wirft die Scheinehe zunächst die Frage auf, ob solche Ehen wirksam, nichtig oder aufhebbar sind:
Fraglich ist, ob man einen Nichtigkeits- oder Aufhebungsgrund der Scheinehe aus dem EheG herleiten kann. Die Gründe, aus denen eine Ehe für nichtig erklärt oder aufgehoben werden kann, sind im Gesetz erschöpfend aufgezählt, §§ 16, 28 EheG. Bei den Nichtigkeits- und Aufhebungsgründen, §§ 16, 28 EheG, wird die Scheinehe nicht mehr mit aufgeführt. Demnach sind diese Abschnitte des Ehegesetztes mit ihren Rechtsfolgen nicht auf die Scheinehe anwendbar. Somit ist ein allgmeines Ehehindernis des Mißbrauchs, dem deutschen Eherecht fremd.13
Zu klären ist nun, ob eventuell die Vorschriften des BGB einschlägig sein könnten. Nach § 117 Abs.1 BGB ist das Scheingeschäft nichtig, weil den Parteien der Rechtsbindungswille fehlt.14 Es kann dahin stehen, ob wegen diesem fehlenden Rechtsbindungswillen, beim Eingehen der Scheinehe, von einem Scheingeschäft i.S. von § 117 Abs.1 BGB auszugehen wäre, denn §117 Abs.1 BGB ist nicht auf die Eheschließung anwendbar, da die Nichtigkeitsgründe im EheG abschließend aufgezählt sind.15 Somit wird § 117 Abs.1 BGB nach ganz h.M.16von § 16 EheG ausgeschlossen.
Ebenso kann dahin stehen, ob der dem anderen bekannte Wille, eines Verlobten, die Ehe nur deshalb eingehen zu wollen, um z. B. eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, als Vorbehalt i.S. des § 116 BGB gewertet werden kann, weil auch § 116 BGB, aus den gleichen Gründen wie § 117 Abs.1 BGB, auf den Eheschließungswillen nicht anwendbar ist.17Aus den gleichen Gründen ist auch das sittenwidrige Rechtsgeschäft gem. § 138 BGB nicht auf die Eheschließung anwendbar.18
Somit finden die Vorschriften des BGB keine Anwendung, da das Ehegesetz als lex specialis gilt.
Zu klären ist nun noch, inwieweit § 13 Abs. 2 EheG der Schließung einer Scheinehe entgegenstehen könnte. Nach § 13 EheG können die Erklärungen der Verlobten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben werden.
Streitig ist, ob die ausdrücklich aufschiebend oder auflösend bedingte bzw. befristete Heiratserklärung zur nichtigen Ehe führt, wie es von der herrschenden Meinung19 vertreten wird, oder ob nur die beigefügte Bedingung bzw. Befristung unwirksam und die Ehe als solche voll gültig ist.20Jedoch kann die zweite Auffassung, die beigefügte Bedingung oder Befristung als unwirksam anzusehen, insofern nicht überzeugen, weil man den Parteien, die erklärtermaßen die Ehe des BGB nicht wollen, eine solche Ehe nicht aufzwingen kann. Bei einer Eheschließung ist es nun mal so, daß die beiden Parteien erklären müssen, gerade dieses Rechtsgeschäft und dieses Rechtsverhältnis und kein anderes oder abgewandeltes eingehen zu wollen.21
Aus diesem Grund scheint es überzeugend, sich zunächst der herrschenden Meinung anzuschließen, weil die Eheleute gerade nicht erklärt haben, die Ehe des BGB zu wollen. So müßte folgerichtig die Ehe als nichtig angesehen werden.
Nach § 17 EheG ist eine Ehe nichtig, wenn die Eheschließung nicht in der durch § 13 EheG vorgeschriebenen Form stattgefunden hat. Um nun auf das eigentliche Problem der Scheinehe zurückzukommen, wird argumentiert, es liege hier gegebenenfalls eine Bedingung i.S. des §13 Abs. 2 EheG vor, denn eine oder beide Parteien erklärten damit, die Ehe nur unter der Bedingung eingehen zu wollen, daß lediglich die gewünschte Nebenfolge wie z.B. das Aufenthaltsrecht eintrete.22 Die Absicht, sich alsbald wieder scheiden zu lassen, kann auch als Befristung i.S. des § 13 Abs. 2 EheG verstanden werden.23 § 13 Abs. II EheG stellt damit eine Abweichung von der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen grundsätzlichen Lebenslänglichkeit der Ehe dar. Soll sonach eine Ehe nur zu dem Zweck geschlossen werden, einem Ausländer die Aufenthaltsgenehmigung zu verschaffen oder seine Ausweisung zu verhindern, die Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft in Wirklichkeit aber nicht beabsichtigt und die Ehe nur auf eine begrenzte Zeit gewollt sein, so können solche Vorbehalte oder Voraussetzungen im Einzelfall als Bedingung oder Zeitbestimmung i.S. des § 13 Abs. 2 EheG ausgelegt werden.24
Im folgenden ist zu klären, ob die Bedingung oder Zeitbestimmung von dem Standesbeamten als ein zu beachtendes Ehehindernis angesehen werden muß, das zur Ablehnug des Aufgebots und der Eheschließung führt .
II. Die Rolle des Standesbeamten
Die Prüfung des Standesbeamten erstreckt sich darauf, ob Ehehindernisse bestehen.
Dies ergibt sich aus § 5 Abs.2 Satz 1 PStG. Die Prüfung erfolgt insoweit durh die Vorlage von Urkunden, die die Verlobten bei ihrer Bestellung des Aufgebots vorzulegen haben. Dazu gehört auch bei Eheschließung mit einem Ausländer das bereits oben erwähnte Ehefähigkeitszeugnis, wovon der OLG Präsident Befreiung erteilen kann. Der Präsident des OLG übernimmt dabei die Funktion der inneren Behörde des Heimatlandes. Fraglich ist, ob sich das Prüfungsrecht des OLG Präsidenten auch auf die Prüfung von Scheinehen bezieht oder nicht. Gegenstand des Befreiungsverfahrens nach § 10 Abs. 2 EheG sind jedoch nur Eheverbote i. S. materieller Ehehindernisse aus der Person oder dem Status des Ausländers. Somit obliegt dem OLG- Präsidenten allein nur die materielle Prüfung und nicht die Entscheidung, ob eine Scheinehe vorliegt. Ob bei einer sog.
Scheinehe eines Ausländers Bedenken aus § 13 Abs.2 EheG abzuleiten und wie insoweit "evidente Mißbrauchsfälle" zu behandeln sind, betrifft das formelle Eheschließungsverfahren, das dem Standesbeamten übertragen ist.25
Bei Bestellung des Aufgebotes hat der Standesbeamte zu ermitteln, ob Ehehindernisse vorliegen und muß dann gegebenenfalls die Eheschließung ablehnen. Er muß die Trauung ablehnen, wenn er sicher ist, daß die Verlobten eine Erklärung nur unter Einschränkungen abgeben werden.26
Umstritten ist, in welchen Fallkonstellationen der Standesbeamte ein Verweigerungsrecht besitzt:
Wird während des Eheschließungsverfahrens von einem der Verlobten deutlich gemacht, daß er nicht die Ehe nach BGB- Regeln eingehen möchte, sondern nur zur Erreichung von Nebenfolgen heiratet, so muß der Standesbeamte die Trauung ablehnen.27
Solch eine ausdrückliche Erklärung vor dem Standesbeamten ist aber höchst selten und daher für die Praxis nicht von großer Bedeutung.
Vielmehr wird es in der Praxis problematisch, wenn beide Verlobte nach einem aufklärenden Gespräch, ohne Vorbehalt erklären, die Ehe eingehen zu wollen. Wenn der Standesbeamte mit der Begründung eine Scheinehe sei beabsichtigt, das Aufgebot ablehnt, ist im gerichtlichen Verfahren gem. § 45 PStG zunächst zu prüfen, ob der Standesbeamte nach den ihm bekannten Umständen, berechtigterweise zu dem Schluß kommen durfte, daß die Verlobten die beabsichtigte Eheschließung ausschließlich aus sachwidrigen Motiven heraus anstreben.28
Die Umstände aus denen der Standesbeamte eine Scheinehe vermuten kann, können sich unter anderem aus erheblichen Altersunterschieden, Sprachbarrieren oder dem sozialen Umfeld ergeben.
Umstritten ist, ob der Standesbeamte in solchen Fällen die ehe ablehnen darf.
Eine Auffassung29vertritt die Ansicht, daß der Standesbeamte das Aufgebot und seine Mitwirkung bei der Eheschließung ablehnen darf, wenn die Ehe nur zu dem Zweck geschlossen werden soll, z.B. einem Ausländer die Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen oder seine Ausweisung zu verhindern, ohne daß die Herstellung einer ehelichen Lebensgemeinschaft beabsichtigt ist.
Danach ist der Standesbeamte berechtigt, das Aufgebot zu verweigern, wenn z.B. die Verlobten bei Bestellung des Aufgebots offensichtlich zum ersten Mal zusammentreffen, sich in keiner Weise miteinander verständigen können oder den Namen und den derzeitigen Aufenthaltsort des anderen Verlobten nicht kennen. Dazu können auch etwaige dem Standesbeamten bekannt gewordene Erklärungen gegenüber Dritten Personen oder Behörden über die Motive der Eheschließung von Bedeutung sein.30
Allerdings ist der Standesbeamte nicht befugt, bei einer deutsch-ausländischen Ehe, die vor ihm eingegangen werden soll, jeweils vorab zu ermitteln, ob es sich um eine ernstgemeinte Ehe handelt, die Verlobten nach ihren Motiven zu befragen, und bei Verdachtmomenten eine Eheschließung abzulehnen.31 Demnach hat er kein aktives Nachforschungsrecht. Vermutet der Standesbeamte eine Scheinehe, so muß er gem. § 45 Abs. 2 PStG den Vorgang an das zuständige Gericht weiterleiten. Das Gericht kann dann die Motivforschung in dem dafür gesteckten engen Rahmen durchführen.32 Unterschiedliche Auffassungen werden bei dieser Ansicht nur bei der Begründung des Ablehnungsrechts des Standesbeamten vertreten:
Zum einen wird vertreten33, daß ein Ehehindernis nach § 13 Abs. 2 EheG vorliegt, denn die Erklärung der Verlobten dürfen nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmungabgegeben werden. Die andere Ansicht34begründet die Verweigerung des Standesbeamten unter dem Gesichtspunkt des offenkundigen Mißbrauchs des Rechtsinstituts der Ehe. Nach dieser Ansicht muß der Standesbeamte an einem Mißbrauch der Eheschließungsform und der Institution Ehe zur außerhalb des Wesens der Ehe liegenden Zwecken nicht sehenden Auges mitwirken.35 Die andere Auffassung36gibt dem Standesbeamten auch dann kein Recht die Eheschließung zu verweigern, wenn er in Erfahrung gebracht hat, daß die Eheleute keine Lebensgemeinschaft begründen wollen, und die Eheschließung Scheingeschäft ist.37
Danach ist es eine Hifskonstruktion, wenn derartigen Fällen, die nur ein ausgesprochene Gerichte in Ablehnung der Trauung gestatten, weil eine Bedingung oder Zeitbestimmung i.S. des § 13 Abs.2 EheG vorlege. Für eine Ablehnung des § 13 Abs. 2 EheG spricht, daß die Verlobten gerade bei "Aufenthaltsehen", nicht an eine baldige Scheidung denken, weil dies den Erfolg des Eheschlusses wieder aufheben würde.
Erfährt der Standesbeamte auf anderem Wege, als von den Verlobten selbst, daß die Ehe vornehmlich dazu dienen soll, einem einem der Ehegatten eine Aufenthaltserlaubnus zu verschaffen, oder vermutet er dies aufgrund der Umstände, so kann er nach dieser Auffassung auf keinen Fall auf § 13 EheG zurückgreifen. Denn man geht auch sonst davon aus, daß bei der Eheschließung innere Vorbehalte unbeachtlich und Scheinerklärungen voll wirksam sind, und demnach kann man bei den "Aufenthaltsehen" nicht anders argumentieren.38
Auch das Argument der Gegenauffassung, Scheinehen stellen einen Mißbrauch des Rechtsinstituts Ehe dar, begründet nach dieser Auffassung kein Verweigerungsrecht des Standesbeamten. Auch wenn die Institution der Ehe zweifelsfrei dazu mißbraucht wird, um ausschließlich Nebenfolgen der Ehe herbeizuführen, findet sich keine rechtliche Grundlage, um damit eine Eheschließung zu verweigern. Im Gesetz findet sich ein Eheverbot nicht, und mit §19 EheG ist die letzte Vorschrift entfallen, die sich mit rechtswidrigen Ehen befaßte. Obwohl es im Gesetz ausdrücklich nur für die Nichtigkeits- und Aufhebungsgründe gesagt ist, besteht aber auch für die aufschiebenden Ehehindernisse im Prinzip Einigkeit darüber, daß sie im EheG abschließend aufgezählt sind.39 Die Gegenauffassung würde durch Richterecht ein neues Eheverbot schaffen, geht dabei aber nicht auf die Frage ein, ob das Gesetz dafür Raum läßt. Man kann nicht annehmen, daß der Gesetzgeber nur die Nichtigkeit der Namensehe beseitigt hat, aber das Verbot als aufschiebendes Ehehindernis habe bestehen lassen wollen. Dann hätte er eine dementsprechende Neuformulierung vornehmen müssen.40 Die Auffassung, daß in diesen Fällen dem Standesbeamten kein Verweigerungsrecht zusteht, scheint aus den oben aufgeführten Gründen zu überzeugen, zumal der Scheinehe zur Erlangung der Aufenthaltsgenehmigung in der Praxis auch auf andere Art und Weise entgegen gewirkt werden kann.
III. Die Rolle der Ausländerbehörde
Die Ausländerbehörden können im Fall einer Scheinehe die Aufenthaltserlaubnis verweigern oder, wenn der wahre Zweck der Eheschließung erst später entdeckt wird, die wegen der Ehe erteilte Aufenthaltserlaubnis beschränken oder widerrufen.41
Die Ehe, die zwischen einem Ausländer und einem Deutschen geschlossen wird begründet für den Ausländer kein Aufenthaltsrecht, wenn sie ihm legiglich zu einem ihm sonst verwehrten Aufenthalt im Bundesgebiet verhelfen soll. Wird der wahre Zweck der Eheschließung erst später aufgedeckt, so darf die dem Ausländer wegen der Ehe erteilte Aufenthaltserlaubnis grundsätzlich zeitlich beschränkt werden.
Ob eine Scheinehe geführt wird oder nicht, ist aus der Sicht des Standesbeamten kaum zu beurteilen. Beim Standesbeamten treten zwar die ersten Verdachtsmomente auf, aber er hat keine weiteren Möglichkeiten Motivforschung zu betreiben. Vielmehr obliegt es der Ausländerbehörde, die Situation gerade nach der Heirat zu bewerten, da sie allgemein die besseren Möglichkeiten der Sachverhaltskenntnis haben dürfte. Hier zeigt sich dann am besten, ob die Eheleute eine eheliche Lebensgemeinschaft aufnehmen wollen oder nicht. Auch wenn die Ehe zuerst nur eingegangen wurde, um ausschließlich eine Nebenfolge damit zu erreichen, ist es denkbar, daß die Eheleute nach der Eheschließung ernste Absichten entwickeln und eine gemeinse Lebensgemeinschaft führen. Demnach kann die Ausländerbehörde am besten die jeweilige Situation beurteilen.
Die Ausländerbehörde trifft somit eine besondere Prüfungsverpflichtung hinsichtlich des Bestehens einer familiären Lebensgemeinschaft, weil an der Verhinderung von Scheinehen zur Erlangung aufenthaltsrechtlicher Vorteile ein besonderes gewichtiges öffentliches Interesse besteht.42
Zu untersuchen ist, wie die Ausländerbehörde in ihrer praktischen Ermittlung vorgeht. Treten bei der Ausländerbehörde Zweifel am Vorliegen einer ehelichen Lebensgemeinschaft schon bei der Vorlage der Unterlagen zur Erlangung der Aufenthaltsgenehmigung auf, so kann die Ausländerbehörde zunächst eine Befragung der Beteiligten durchführen. Die Ehegatten müssen der Ausländerbehörde ein Schriftstück unterschreiben, indem sie versichern, miteinander eine Lebensgemeinschaft zu führen. Bestehen dann immer noch erhebliche Zweifel an der Ehe, kann die Ausländerbehörde eine Befragung vor Ort durchführen. Wird durch Befragung der Nachbarn und des sonstigen Umfeldes deutlich, daß keine eheliche Lebensgemeinschaft vorliegt, so wird die Aufenthaltserlaubnis aufgehoben oder zeitlich beschränkt. Das ergibt sich aus § 19 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 AuslG, wonach der Begriff der ehelichen Lebensgemeinschaft voraussetzt, daß ein dem Wesen der Ehe entsprechendes Zusammenleben der Ehegatten vorliegt.43 Liegt keine Lebensgemeinschaft vor, so gibt es in der weiteren Behandlung einen strafrechtlichen und einen verwaltungsrechtlichen Weg. Zum einen hat die Ausländerbehörde die Möglichkeit den Fall an die Staatsanwaltschaft zu geben, die dann wegen Betrug bzw. Falschaussage, gestützt auf das von den Eheleuten unterschriebene oben erwähnte Schriftstück, ermitteln kann.
Zum anderen ist der verwaltungsrechtliche Weg zu gehen, bei dem die Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis gem. § 48 LVwVfG zurücknehemen kann, da die Aufenthaltsgenehmigung unter falschen Voraussetzungen, nämlich unter Annahme einer Lebensgemeinschaft, erteilt worden ist. Demnach liegen die Voraussetzungen der Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes gem § 48 LVwVfG vor. Liegt ein Verstoß gegen das von den Eheleute unterschriebene Schriftstück vor, indem sie ihre ehlichen Lebensgemeinschaft versichern, ist § 92 Abs.2 Nr.2 AuslG einschlägig.
Demnach hat die Ausländerbehörde durchaus Möglichkeiten gegen Scheinehe vorzugehen. Fraglich ist, wie die Ermittlungen und Vorgehensweisen der Ausländerbehörde zu beurteilen ist, vorallem im Hinblick auf Art. 6 GG.
IV. Schutz der Ehe durch Art. 6 I GG
Dieser Vorgehensweise von der Ausländerbehörde könnte Art. 6 GG entgegenstehen. Der Staat ist an der Erhaltung "funktionierender Ehen" interessiert, die er daher unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, Art. 6 Abs. 1 GG, gestellt hat. Der Schutzbereich umfaßt Ehe und Familie in der gelebten Gemeinschaft. Somit hat sich auch die Verwaltungsbehörde an das Grundrecht zum Schutz der Ehe zu halten. Gerade durch die Form der Befragung, die die Ausländerbehörde auch bei den Nachbarn durchführt, könnte eine Diskriminierung und Schlechterstellung der multikulurellen Ehen darstellen. Zu überlegen ist, ob derartige Nachforschungen unzulässig sind, dies jedenfalls solange, als man derartige Ermittlungen nicht auch bei deutschen Ehepaaren anordnen will, bei denen das Fortsetzen der ehelichen Lebensgemeinschaft ebenfalls Voraussetzung für eine Reihe rechtlicher Vergünstigungen ist.44 Allerdings gibt Art. 6 Abs. 1 GG zum Schutz von Ehe und Familie dem mit einem deutschen Staatsangehörigen verheirateten ausländischen Ehegatten ein Aufenthaltsrecht dergestalt, daß nur noch bei deutlich ausländerrechlichen Bundesrepublik eine kann.
Bei Nachforschungen Persönlichkeitrechte überwiegenden Interessen der Ausweisung erfolgen dieser Art müssen und Intimsphäre beachtet werden, das staatliche Interesse an der Verhinderung aufenthaltsrechtlicher Scheinehen ist aber als sehr gewichtig einzustufen.45Problematisch scheint es, auf welche Art und Weise man diese Befragung durchführt ohne zu weit in Grundrechte einzugreifen. Nach der Rechtssprechung sind Nachforschungen der Ausländerbehörde zur Klärung einer aufenthaltsrechtlichen Position zulässig und verwertbar, wobei die Eheleute nur in einer ihrer Privatssphäre nicht verletzenden Weise zu befragen sind.46 Der Schutzbereich des Art. 6 Abs.1 GG schließt auch nicht aus, daß eine ganze Anzahl Rechtsfolgen entfallen, wenn die Ehegatten noch nicht oder nicht mehr zusammenleben. Das BVerfG47hat vielmehr zu Recht hervorgehoben, daß es der durch Art. 6 Abs.1 GG gebotene Schutz der Ehe nicht gebietet, jedem Ehegatten eines Deutschen eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen, sondern nur dem Ehegatten, die mit ihrem deutschen Ehegatten auch faktisch zusammenleben wollen.
Begründet wird das damit, daß wenn sich die Ehegatten dazu entschieden haben getrennt zu leben, daß sie dann auch nicht in demselben Land leben müssen, getrennt leben kann man auch in verschiedenen Ländern. Folglich braucht man bei der Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung eine Ehe nicht berücksichtigen, die nicht zu einer Lebensgemeinschaft geführt hat. Demnach kann unter der Berücksichtigung der besonderen Sorgfalt, hinsichtlich der Vorgehensweise der Ausländerbehörde, nicht von einem Eingriff in den Schutzbereich des Art. 6 Abs. 1 GG gesprochen werden.
E. Zusammenfassung und Stellungnahme
Wie schon oben ausgeführt, läßt sich aus dem geltenden deutschen Eherecht keine Befugnis dafür entnehmen, rechtlich gegen Scheinehen vorzugehen.
Die Tatsache, daß Gerichte den Standesbeamten durch Hilfskonstruktionen die Befugnis einräumen die Ehe zu verweigern, macht deutlich, daß in diesem Bereich eine große Rechtsunsicherheit besteht. Wenn gegen Scheinehen vorgegangen werden soll, so muß das der Gesetzgeber bestimmen. Seine Aufgabe ist es Rechtsunsicherheiten zu beseitigen und auf zeitgemäße Veränderungen zu reagieren. Ansonsten muß unsere Rechtsordnung Zerrbilder des eigenen Ehemodells in Kauf nehmen.
Die Aufgabe der Bekämpfung der Scheinehe in der Praxis auf die Ausländerbehörden abzuwälzen erscheint auch nicht der richtige Weg. Zwar bietet das Ausländerrecht Abwehrmöglichkeiten gegen Scheinehen, da die heute vor allem erstrebten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse nicht allein durch den formalen Eheakt begründet werden, sondern eine eheliche Lebensgemeinschaft voraussetzten.
Doch kann die Ausländerbehörden nicht gegen die Eheschließung vorgehen , sondern lediglich überprüfen, ob ein Lebensgemeinschaft vorliegt oder nicht. Auch werden die Vorgehensweisen unter den einzelnen Ausländerbehörden sehr unterschiedlich gehandhabt. Durch fehlende konkrete Arbeitsanweisungen kommt es auf das Engagement und der personellen Besetzung der Behörde an, ob Untersuchungen vor Ort im Außendienst durchgeführt werden oder nicht. Dies birgt natrürlich eine Gefahr der unterschiedlichen und damit ungerechten Behandlung in sich.
Aus diesen Gründen ist eine Rechtsklarheit dringend erforderlich. Fraglich ist, warum der Gesetzgeber trotz Bedarf noch nicht reagiert hat. Doch angesichts des heiklen Themas scheint der Gesetzgeber Berührungsängste zu haben. Zum einen scheut er vielleicht ausstehende Konflikte mit dem Grundgesetz, vorallem Art.3 Abs.1 und 6 Abs.1 GG, und zum anderen hat er berechtigte Skrupel, Differenzierungen innerhalb der Scheinehe durchzuführen. Man würde sich an der Grenze erlaubter Differnzierungen befinden, wenn man Aufenthaltsehen ausschließe, und andere Arten der Scheinehe weiter akzeptiert.
Trotz all diesen Schwierigkeiten wäre eine Rechtsklarheit wünschenswert.
Eine solche Rechtsklarheit könnten sich aus gemeinsamen europäischen Richtlinien ergeben. Im Gegensatz zu Deutschland forderte das europäische Recht bisher, nach Aussagen der Ausländerbehörde, bei dem Begriff der Lebensgemeinschaft nicht, daß die Eheleute räumlich bzw. örtlich zusammen wohnen. Demnach ist es z. B. für eine in Deutschland lebende Französin, die in Deutschland einen Inder heiratet, recht unproblematisch eine Scheinehe einzugehen, weil die Aufenthaltsgenehmigung ihnen nicht entzogen werden kann, auch wenn sie räumlich getrennt leben.
Hier muß bei der Weiterentwicklung auf ein gemeinsames Europa, die unterschiedliche Behandlung von Deutschen und Europäern innerhalb von Deutschland, angeglichen werden. Solch eine Angleichung sieht auch der Beschluß des Europäischen Rates vom 18.11.1997 vor (siehe Anhang). Auch die Flucht nach Dänemark, um das Ehefähigkeitszeugnis zu umgehen und um anschließend die Hochzeit auch hier in Deutschland anerkannt zu bekommen, zeiget, daß es einer gemeinsamen europäischen Lösung bedarf.
Zu klären ist, warum es überhaupt die Tendenz gibt gegen Scheinehen zum Erwerb
der Aufenthaltsgenehmigung vorzugehen.
Angesichts der Belastung Deutschlands durch den Zustrom von Ausländern, die aus ihren schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen in ihren Heimatländern fliehen und dabei priviligierte Rechtsinstitute wie die Ehe für Zwecke verwenden, um lediglich die Nebenfolgen zu erzielen, wie z.B. das Aufenthaltsrecht, stellt auch eine finanzielle Belastung dar. Das scheint dem Rechtsgefühl zu widersprechen und bedarf einer Lösung. Die zentrale Frage ist, welche Wege zu einer Lösung des Problems führen könnten. 1. Ein Lösungsweg der eingeschlagen werden könnte, ist die Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung unabhängig von dem Bestehen einer Ehe mit einem deutschen Partner. Das Eingehen einer Ehe würde somit keinerlei Vergünstigungen hinsichtlich der Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung mitsich bringen. Das Problem der Scheinehe wäre somit gelöst, doch würde damit der Schutzbereich des Art. 6 Abs.1 GG völlig ausgehöhlt werden. Es wäre auch denen gegenüber ungerecht, die eine Ehe ausschließlich aus Zuneigung eingehen möchten. Dieser Lösungsansatz scheint nicht genug zu differenzieren.
2. Eine andere Möglichkeit, bei der die jetzige Rechtslage nicht geändert werden müßte, wäre, daß die Ausländerbehörde Ehen stärker überwacht. Das wäre jedoch nur dann möglich, wenn verstärkt "Kontrolleure" der Ausländerbehörde vor Ort eingesetzt würden. Ein solcher Lösungsweg führt unweigerlich zu einem Überwachungsstaat und zu einer Diskriminierung von Ehen mit Ausländern.
Hinsichtlich unsere Vergangengeit kann daran wohl kein Interesse bestehen.
3. Möglich wäre auch die Einführung eines "Greencard - Modells" nach amerikanischem Vorbild. Das setzt allerdings voraus, daß die Bundesrepublik sich dem Problem stellt, daß es sich immer mehr zu einem Einwandererland entwickelt. Zwar werden grundsätzlich in der Bundesrepublik nur politisch Verfolgte aufgenommen, doch das führt in der Praxis dazu, daß auch Wirtschaftsflüchtlinge sich als politisch Verfolgte ausgeben müssen, um eine Aufenthaltsrecht zu erlangen. Wird die politische Verfolgung nicht anerkannt oder besteht im Heimatland durch veränderte Umstände nicht mehr die Gefahr der politischen Verfolgung, so wird wird von den Betroffenen oft versucht auf andere Art und Weise ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Ein Weg davon ist das Eingehen einer Scheinehe. Ein Lösungsansatz, der dieses Problem verringern könnte, wäre, wenn man eine weitere Möglichkeit schafft, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen. So hätten auch Wirtschaftsflüchtlinge die Möglichkeit, durch eine begrenzte Verlosung von Aufenthaltsgenehmigungen, ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Allerdings könnte die Einführung des "Greencard - Modells" das Problem der Scheinehe nur zum Teil lösen, da das Eingehen der Scheinehe für alle, die eine Aufenthaltsgenehmigung nicht über die Verlosung erhalten haben, noch als weitere Möglichkeit offen stehen würde. Alle Lösungsansätze zeigen, daß es vorallem einer eindeutigen Gesetzeslage bedarf. Dazu müßte sich der Gesetzgeber mit der Marterie auseinandersetzten. Noch sinnvoller wäre eine einheitliche europäische Regelung in Bezug auf Drittstaaten, um das Problem sinnvoll in den Griff zu bekommen. Eine einheitliche europäische Regelung sieht zwar der Beschluß des Europäischen Rates vom 18.11.1997 vor, allerdings unterscheidet sich dieser Beschluß nicht wesentlich von der momentanen Behandlungsweise von Scheinehen in Deutschland. Neue Lösungswege zeigt dieser Beschluß leider nicht auf, denn es findet lediglich eine Angleichung an die praktische Vorgehensweise in Deutschland statt
[...]
1Spellenberg, StAZ 1987 S. 33
2Köbler, Juristisches Wörterbuch S. 89, 90
3LG Kiel in FamRZ 1990 S. 743
4Spellenberg, StAZ 1987 S.33; Dölle, Familienrecht Band I S. 142, 143
5Dölle, Familienrecht Band I S. 143, 144
6BayObLG in StAZ 1982 S. 307
7Pawlowski, FamRZ 1991 S. 501
8Pawlowski, FamRZ 1991S. 501
9Bundesverwaltungsgericht in StAZ 1962 S. 168
10Henrich Familienrecht S.43 / Hans Wolle FamR Bd II ???
11Henrich Familienrecht S. 45,46
12FamRZ 1990 S.743
13LG Kiel in FamRZ 1990 S. 744
14Spellenberg, StAZ 1987 S. 40
15LG Kiel im FamRZ 1990 S. 743
16Krammer MüKo §117 BGB Rn.4; Spellenberg, StAZ 1987 S. 40
17Soergel/Hefermehl BGB § 116 Rn.10; LG Kiel in FamRZ1990 S. 743
18Spellenberg, StAZ 1987 S. 37
19Schwab, FamRZ 1965 S. 485; Erman § 17 EheG Rn 1
20Staudinger BGB §13 EheG Rn. 37
21Schwab, FamRZ 1965 S. 485 ff.; Beitzke, Familienrecht § 7 II 6
22Spellenberg, StAZ S. 38,39
23Böhmer, StAZ 1975 S. 9
24OLG Hamburg in FamRZ 1983 S. 65
25OLG Düsseldorf in FamRZ 1996 S. 1145
26Spellenberg, StAZ 1987 S. 41 ff.
27OLG Hamburg in FamRZ 1983 S. 65
28OLG Hamburg in FamRZ 1983 S. 66
29OLG Celle in StAZ 1982 S. 308; OLG Hamburg in FamRZ 1983 S. 64; OLG Stuttgart in StAZ 1984 S. 99
30OLG Hamburg in FamRZ 1983 S. 65
31Müller-Gindullis in MüKo § 13 EheG Rn. 13
32OLG Hamburg in FamRZ 1983 S. 66
33BayObLG in FamRZ 1982 S. 603
34OLG Stuttgart in StAZ 1984 S. 99; OLG Karlsruhe in StAZ 1983 S. 14
35Müller-Gindullis in MüKo § 13 EheG Rn 12
36Spellenberg StAZ 1987 S. 41ff.; Pawlowski FamRZ 1991 S.504 ff.; Ramm FamR Bd. I S. 448
37Ramm FamR Bd. I S. 447
38Pawlowski FamRZ 1991 S. 504 ff.; Beitzke StAZ 1983 S. 3
39Müller-Gindullis in MüKo vor § 4 EheG Rn 1; Palandt- Dietrichsen vor § 4 EheG Rn 2
40Spellenberg StAZ 1987 S. 42
41Henrich Famrecht § 5 II 4. S.44
42HessVGH Beschluß vom 14.06.1996, 12 UZ 1657/ 96.A
43VGH Bad.-Württ., Urteil vom 12.03. 1996, 13 S 3180/95
44so Pawlowski FamRZ 1991 S. 504
45BVerfG 12.07.1985, 2 BvR 1226/83
46VGH Bad.-Württ. Urteil vom 12.03.1996, 13 S 3180/95
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Scheinehe laut dieser Analyse?
Eine Scheinehe ist eine Ehe, die nicht auf einer ehelichen Lebensgemeinschaft basiert, sondern primär auf dem Erreichen bestimmter Vorteile, wie z.B. der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsangehörigkeit.
Welche historische Entwicklung hat die rechtliche Behandlung von Scheinehen in Deutschland durchlaufen?
Ursprünglich gab es im deutschen Recht Eheverbote für Namens- und Staatsangehörigkeitsehen. Diese Verbote wurden jedoch im Laufe der Zeit aufgehoben. Heute spielen die Motive für die Eheschließung rechtlich keine direkte Rolle mehr, obwohl Scheinehen weiterhin problematisiert werden.
Welche Erscheinungsformen der Scheinehe werden in der Analyse genannt?
Die Analyse nennt Namens-, Staatsangehörigkeits- und Aufenthaltsehen als gängige Erscheinungsformen der Scheinehe. Bei den heutzutage eingegangenen Scheinehen geht es häufig um die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis.
Wie werden Scheinehen rechtlich behandelt? Sind sie wirksam, nichtig oder aufhebbar?
Nach geltendem deutschem Recht sind Scheinehen grundsätzlich wirksam. Die Nichtigkeits- und Aufhebungsgründe des Ehegesetzes (EheG) sind abschließend und umfassen die Scheinehe nicht. Vorschriften des BGB, wie z.B. § 117 BGB (Scheingeschäft), finden auf die Eheschließung keine Anwendung.
Welche Rolle spielt der Standesbeamte bei der Eheschließung im Hinblick auf Scheinehen?
Der Standesbeamte hat zu prüfen, ob Ehehindernisse vorliegen. Er darf die Eheschließung ablehnen, wenn klar ist, dass die Verlobten die Ehe nicht nach den Regeln des BGB eingehen wollen, sondern nur zur Erreichung von Nebenfolgen. Allerdings ist sein Ermessensspielraum begrenzt, und er hat kein aktives Nachforschungsrecht.
Welche Befugnisse hat die Ausländerbehörde im Falle einer Scheinehe?
Die Ausländerbehörde kann die Aufenthaltserlaubnis verweigern oder widerrufen, wenn die Ehe nur dazu dient, dem Ausländer einen sonst verwehrten Aufenthalt zu ermöglichen. Sie hat eine besondere Prüfpflicht hinsichtlich des Bestehens einer familiären Lebensgemeinschaft.
Inwiefern wird der Schutz der Ehe durch Art. 6 I GG durch die Vorgehensweise der Ausländerbehörde berührt?
Art. 6 GG schützt Ehe und Familie. Nachforschungen der Ausländerbehörde müssen die Persönlichkeitsrechte und die Intimsphäre der Eheleute beachten. Allerdings besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Verhinderung aufenthaltsrechtlicher Scheinehen. Die Nachforschungen müssen sich aber in einem Rahmen halten, der die Privatsphäre der Eheleute nicht verletzt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Analyse bezüglich der Rechtslage und des Vorgehens gegen Scheinehen?
Die Analyse kritisiert die Rechtsunsicherheit und die Verlagerung der Bekämpfung von Scheinehen auf die Ausländerbehörden. Sie fordert eine klare gesetzliche Regelung, gegebenenfalls auf europäischer Ebene, um Rechtsklarheit zu schaffen und eine gerechtere Behandlung zu gewährleisten. Die aktuelle Rechtslage ist unbefriedigend.
- Arbeit zitieren
- Yvonne; Chris (Autor:in), 1998, Scheinehe und ihre rechtliche Behandlung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96049