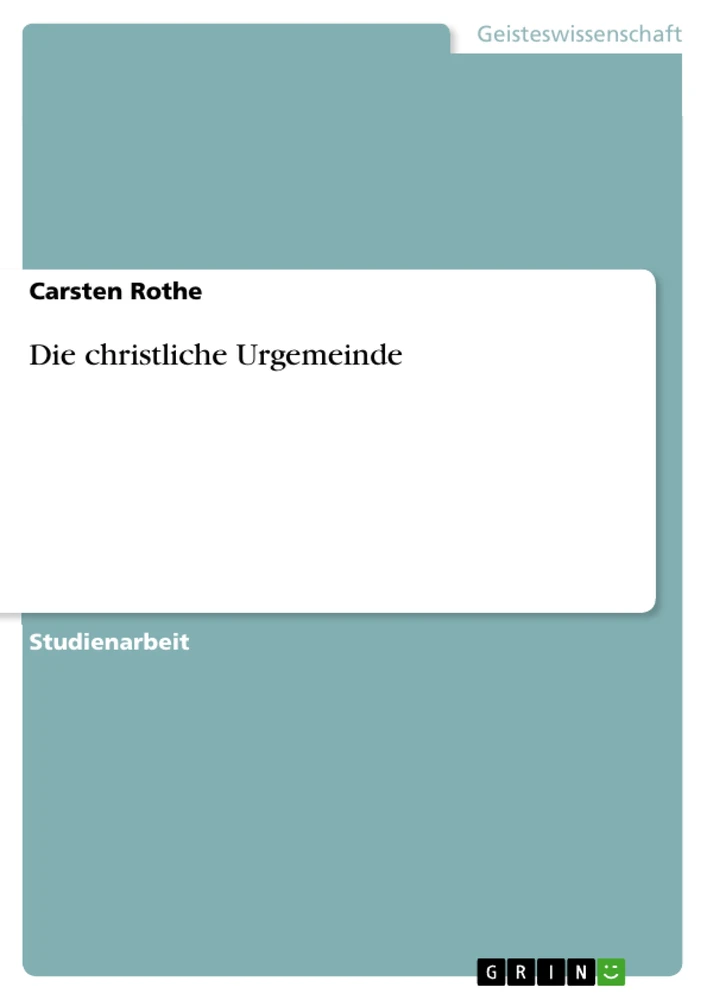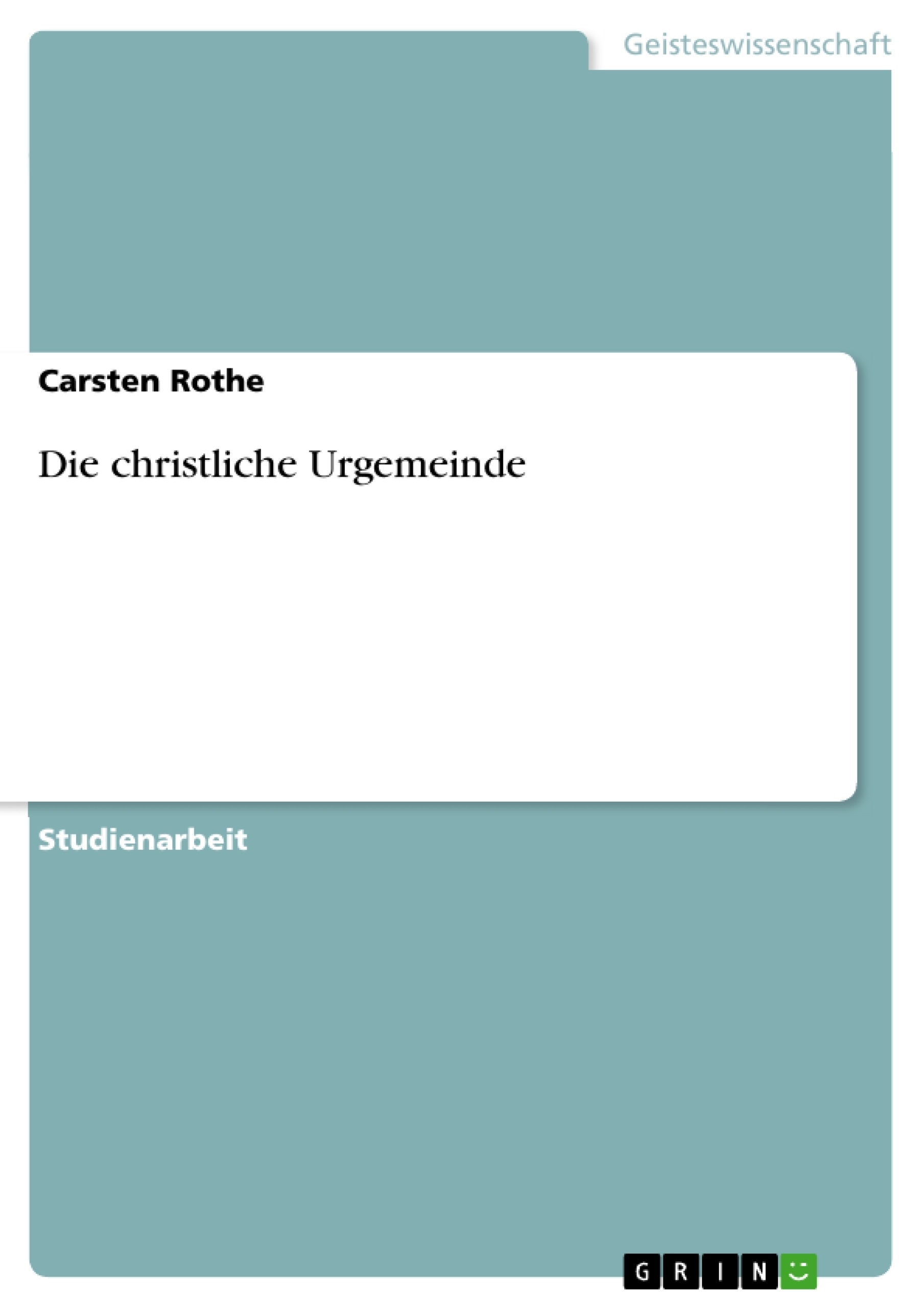Bevor ich zur Lokalisierung der Urgemeinde komme, muß vorher ein Wort über die späteren Apostel verloren werden, die in der Nacht, in der Jesus festgenommen wurde, davonliefen. Petrus ihn, Jesus, sogar dreimal verleugnete. Diese Jünger wurden nach dem Tod Jesu zu den Fundamenten der heutigen christlichen Kirche. Aber wie kam es dazu?
Am Pfingsttag „fiel der verheißene Gottesgeist vom Himmel auf die Erde, um hier Feuer anzuzünden in den Herzen der Apostel und durch sie in allen denen, die ihren Worten folgten, das jene antrieb, Zeugnis zu geben von ihm in Jerusalem und bis an die Grenzen der Erde.“
Durch den Heiligen Geist, der auf die Erde gekommen ist, ist also der Mut der Apostel zurückgekehrt. So daß sie auszogen, um die Worte des Herrn kund zu tun und zu verbreiten. Es kann also festgehalten werden, daß das Pfingstfest „der eigentliche Geburtstag (...) der Gemeinde in Jerusalem“ war. Carl Schneider sieht es als gesichert an, daß Jerusalem die Urgemeinde des Christentums ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Lokalisierung der Urgemeinde
2. Urgemeinde = Urkommunismus?
2.1 Die Ideen der religiösen Sozialisten
2.2 Urgemeinde = Urkommunismus?
2.2.1 Apostelgeschichte 2, 42 - 45
2.2.2 Apostelgeschichte 4, 32 - 37
2.2.3 Die Armut der Urgemeinde
3. Die Riten der Urgemeinde
3.1 Die Taufe
3.2 Abendmahl; Herrenmahl
3.3 Der Gottesdienst bzw. die täglichen Versammlungen
4. Die Organisation der Urgemeinde
5. Das Selbstverständnis und die Eschatologie der Urgemeinde
6. Gruppen und Strömungen der Urgemeinde
7. Das Ende der Urgemeinde
Literaturverzeichnis
1. Einleitung: Lokalisierung der Urgemeinde
Bevor ich zur Lokalisierung der Urgemeinde komme, muß vorher ein Wort über die späteren Apostel verloren werden, die in der Nacht, in der Jesus festgenommen wurde, davonliefen.
Petrus ihn, Jesus, sogar dreimal verleugnete. Diese Jünger wurden nach dem Tod Jesu zu den Fundamenten der heutigen christlichen Kirche. Aber wie kam es dazu?
Am Pfingsttag „fiel der verheißene Gottesgeist vom Himmel auf die Erde, um hier Feuer anzu- zünden in den Herzen der Apostel und durch sie in allen denen, die ihren Worten folgten, das jene antrieb, Zeugnis zu geben von ihm in Jerusalem und bis an die Grenzen der Erde.“[1]
Durch den heiligen Geist, der auf die Erde gekommen ist, ist also der Mut der Apostel zurück- gekehrt. So daß sie auszogen, um die Worte des Herrn kund zu tun und zu verbreiten.
Es kann also festgehalten werden, daß das Pfingstfest „der eigentliche Geburtstag (...) der Gemeinde in Jerusalem“[2] war. Carl Schneider sieht es als gesichert an, daß Jerusalem die Ur- gemeinde des Christentums ist.[3]
Die RGG hält es für wahrscheinlich, daß es auch in Galiläa Auferstehungserscheinungen gab.
Aber sie tendiert auf Grund der Quellenlage doch eher zur Jerusalemer Urgemeinde wie das folgende Zitat belegt. „Eine beschränkte Kenntnis haben wir für die älteste Zeit allein von der Jerusalemer Gemeinde (..).“[4]
Auch F. Meffert hält es für wahrscheinlich, daß es in Galiläa zeitgleich oder gar früher eine Gemeinde gab, aber daß das Zentrum der urchristlichen Gemeinde nach Jerusalem verlagert wurde. „ Dieses erste Pfingstfest mit seiner großen Ernte unter den Vertretern aller Länder des Mittelmeerraumes konnte den Aposteln sofort auch Aufschluß geben, weshalb sie das Wort ihres Meisters aus Galiläa weg nach Jerusalem gewiesen hatte, daß sie in Jerusalem Zeugnis geben sollten. Wenn ihnen das Licht des Herrn anvertraut war, daß sie es auf den Leuchter stellen, so konnte das an keinem Orte Palästinas mit dem Erfolg geschehen, daß dieses Licht in die weitesten Fernen drang, als in Jerusalem, dem Weltmittelpunkte des gesamten Judentums. Hier, wo Hunderttausende von Festpilgern Jahr um Jahr zu den Hochfesten im Tempel zusammenströmten, war der gegebene Platz für eine Lehrkanzel, von der aus man zu jeglicher Kreatur sprechen konnte.“[5] Ein weiteres Indiz für Jerusalem als Urgemeinde läßt sich im Evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde finden. Diese schreibt, daß Jerusalem das gemeinsame, geographische Zentrum des Urchristentums gewesen sei.[6]
Das folgende Zitat wird die Bedeutung Jerusalems als Urgemeinde bestätigen und in sehr groben Zügen ihr Ende beschreiben. „Mehr und mehr hatten sich schon in den 40er und 50er Jahren in Kleinasien, Griechenland und Italien Nebenzentren zu Jerusalem gebildet. Daß Paulus die heilige Stadt trotzdem bis in die späten 50er Jahre immer wieder aufsuchte und die dortige Gemeinde durch die von ihm vorangetriebene und überbrachte Kollekte unterstützte zeigt zu Genüge den hohen Stellenwert Jerusalems (...). Mit der Flucht der Gemeinde nach Pella ( 66 n. Chr. ) und erst recht mit der Zerstörung der Stadt ( 70 n. Chr. ) ging deren Führungsrolle auf andere Städte über ( Antiochia, Ephesus, Korinth, Rom später auch Alexandria).“[7]
2. Urgemeinde = Urkommunismus?
2.1 Die Ideen der religiösen Sozialisten
Im folgenden wird versucht, mit einigen Thesen aus dem Programm der religiösen Sozialisten, den Blickwinkel dieser mit ein paar Zitaten darzustellen.
„ Der religiöse Individualismus muß zugunsten eines Christenrums der sozialen Verantwortung überwunden werden. Alle religiösen Sozialisten waren überzeugt, daß die Kirche im Verhältnis zum Proletariat eine geschichtliche Schuld auf sich geladen habe, die es wiedergutzumachen gelte.“[8]
Die Kirche soll, „nach Meinung der religiösen Sozialisten, die Sache aller Unterdrückten zu der ihrigen machen. Die religiösen Sozialisten wollen auf der Seite des Proletariats stehen, auf der Seite der Unterdrückten und Ausgebeuteten in allen Abschnitten des Klassenkampfes.“[9]
Die religiösen Sozialisten kommen zu einem entschiedenen Urteil:
„ Der Kapitalismus ist zu bekämpfen, und an seine Stelle muß der Sozialismus treten. Denn eine Gesellschaftsordnung, die bewußt und grundsätzlich auf den wirtschaftlichen und politischen Egoismus aufgebaut ist, muß abgelehnt werden. So müssen wirtschaftliche Zu- stände angeprangert werden, die dem Geist des Glaubens zu wider sind. So sind sowohl übermäßiger Reichtum als auch verelendende Armut Anfechtungen für den Glauben. (...)
Aus Christi Geist wollen sie das Leben der Gesellschaft für die kommende sozialistische Ordnung vorbereiten. Sie verstehen darunter eine Gesellschaftsordnung, in der das Bewußtsein der Gemeinschaft das Fundament des gesellschaftlichen Aufbaus ist.“[10]
Es lassen sich drei Grundanliegen der religiösen Sozialisten feststellen:
„ 1. Die Überwindung des religiösen Individualismus zugunsten eines Christentums der sozialen Verantwortung, d.h. aber die Solidarität mit den Unterdrückten.
2. Der Kampf gegen den Kapitalismus und für den Sozialismus.
3. Der Kampf gegen Nationalsozialismus und Krieg und für Völkerverständigung.“[11]
2.2 Urgemeinde = Urkommunismus?
Um die Urkommunismus - Theorie in der Urgemeinde zu bekräftigen werden meistens drei Punkte angeführt, so F. Meffert.[12] Die da wären:
1. Apostelgeschichte 2, 42 - 45
2. Apostelgeschichte 4, 32 - 37
3. Die Armut der Urgemeinde
2.2.1 Apostelgeschichte 2, 42 - 45
Ein Befürworter der Urkommunismus - Theorie, Georg Brandes, schreibt zu der „ Darstellung in der Apostelgeschichte (2, 44- 45): > Alle aber, die gläubig waren worden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Ihre Güter und Habe verkauften Sie und teilten sie aus unter alle, nach dem jedermann not war.< Dies ist ein scharfer Gegensatz zur Vermögenspolitik, ein Ausdruck für den weitestgehenden Kommunismus, der sich damals unter den Vermögenslosen ausbreitete.“[13]
Diese exemplarisch angeführte Deutung kann und wird widerlegt werden. „ Die Stadt war dicht bevölkert, aber war durch ihre Lage zur Handelsstadt ungeeignet und wies auch sonst keine besonderen Erwerbsquellen auf. So gab es dort viel Armut. Es werden auch die Apostel nicht die einzigen gewesen sein, die die galiläische Heimat und mit ihr die Existenzgrundlage aufgegeben hatten. Diese Gemeindeglieder mußten von den anderen mit erhalten werden.“[14]
Der hier angeführte Text schließt ja selbst aus, daß jeder Besitz in eine große Kasse floß, bei der jeder, aber zu gleichem Teil, empfing. „ Die Gabenverteilung richtete sich nach der Bedürfnisfrage V. 45. (...) Ferner mahnt Petrus 2, 38 zur Buße und Taufe, nicht aber zur Aufgabe des Eigentums.“[15]
Aus „> je nachdem einer bedürftig war <, habe er etwas erhalten, folgt ohne weiteres, daß ein Rechtsanspruch des einzelnen auf einen oder gar den gleichen Teil aus der Gemeindekasse nicht bestand. Damit ist das Hauptmerkmal der kommunistischen Organisation eines Gesellschafts - oder Gemeindelebens nicht vorhanden, denn bei einer solchen wird der Unterschied > je nach Bedürftigkeit < nicht gemacht (...).“[16]
2.2.2 Apostelgeschichte 4, 32 - 37
„ Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen.
Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jedem, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde - das heißt übersetzt: Sohn des Trostes -, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.“[17]
Hier kann wie zuvor in 2.2.1 gesehen die Urkommunismus - Theorie auch widerlegt werden. Bei der Apg 4, 32 - 37 „ wurde eine völlig neue innere Haltung eingenommen. Diese Haltung wirkt sich in allem aus, sowohl in denen, die wie Maria, die Mutter Johannes = Markus ( Apg 12, 12 ), ihr großes Haus behielt, um es in anderer Weise für die Brüder nutzbar zu machen, und auch in denen, die wie Barnabas tatsächlich ihr Grundstück verkauften. > Es war ihnen alles gemeinsam <, oder wie wir auch übersetzen könnten: > Sie betrachteten alles als gemeinsamen Besitz. <“[18]
„ Triebfeder dieser bereitwilligen Güterteilung mögen zum einen gewisse Worte Jesu gewesen sein die in diese Richtung gingen ( Mk 10, 21 ) zum anderen die positive Aufnahme der alt- testamentlichen Armenfrömmigkeit, zum dritten die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu zum Endgericht. Dazu kommt aber auch, daß die durch den Glauben geöffneten Augen der Liebe die Not der Mitmenschen eher zu sehen vermögen, als die in Eigennutz gefangenen.“[19]
Um die Hauptforderung eines jeglichen Kommunismus, die grundsätzliche Verneinung des Privateigentums, zu widerlegen, führt F. Meffert[20] die Geschichte von Hananias und Saphira an ( Apg 5, 1 - 4 ): „ Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Saphira verkaufte einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, daß du den heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen.“[21]
„ Die Strafe trifft das Paar nicht wegen der Nichtablieferung, zu welcher sie gezwungen gewesen wären, sondern wegen ihrer Lüge. (...) An den Worten des Paulus, daß den beiden das volle Verfügungsrecht über ihr Eigentum zustand vor wie nach dem Verkauf des Grundstücks, scheitern alle > kommunistischen < Deutungskünste!“[22]
Dieselbe Haltung wie F. Meffert oben gezeigt, ist bei Walter de Boor[23], Alphons Steinmann[24] und Heinz - Werner Neudorfer[25] zu finden.
Zum Abschluß dieses Punktes möchte ich die Schilderung von Josephus Bell. Jud. 2, 8, 3, 4 über die Essener zitieren, die A. Steinmann als Beispiel für antiken Kommunismus anführt: „ Wunderbar ist bei ihnen, wie sie einander an allem teilnehmen lassen; man findet bei ihnen keinen, der an Besitz die anderen übertrifft. Es besteht nämlich die Vorschrift, daß die, welche in die Sekte eintreten, ihr Vermögen der Gemeinschaft zu allgemeiner Verfügung stellen, so daß man allgemein weder die Erniedrigung der Armut noch die Auszeichnung des Reichtums findet; vielmehr, da die Besitztümer der Einzelnen zusammengeworfen sind, so besitzen sie alle wie Brüder nur ein Vermögen. Die Verwalter des gemeinsamen Vermögens werden gewählt ... den von anderswoher kommenden Sektenmitgliedern steht alles, was sie haben, zur Verfügung wie ihr eigener Besitz, und bei Leuten, die sie nie zuvor gesehen, kehren sie ein wie bei ver- trautesten Freunden. Untereinander kaufen sie weder noch verkaufen sie etwas, sondern jeder gibt dem, der etwas braucht, was er hat, und bekommt von ihm wieder, was er braucht. Aber auch ohne Wiedervergeltung haben sie ungehindert an allem teil, was sie wollen.“[26]
Solche Regelungen sind in der Urgemeinde nicht anzutreffen.
2.2.3 Die Armut der Urgemeinde
Der dritte Punkt der angeführt wird um die Urkommunismus - Theorie zu stützen, ist die Armut der Urgemeinde. Aber auch dieser Punkt wird, wie die beiden vorangegangenen, widerlegt werden.
„ Im Durchschnitt ist die Gemeinde arm. Das ist für sie ein Zeichen, daß sie von Gott erwählt sind.“[27] Diese Ansicht ist eine Art jüdische Frömmigkeit die gemeinhin als „ Armen- frömmigkeit“[28] bezeichnet wird. Ihre Intention ist: „ Gott stürzt das Hohe und erhebt die Niedrigen und Demütigen.“[29] Weiterhin geht das Denken der Urchristen bei Besitz und Besitzlosen weit über das profan Materielle hinaus.
„ Es geht um das Ganze der Einstellung zur Welt, darum, ob der Mensch Herr über seinen Besitz oder von ihm besessen ist.“[30] Ein weiterer Grund für die Armut der Gemeinde liefert uns der Hebräerbrief 10, 32 - 34. „> Erinnert euch an die frühen Tage, da ihr eben erleuchtet, einen großen Leidenskampf ausgehalten habt, bald selbst in schmachvollem Leid zur Schau ge- stellt, bald zu Genossen der also Getroffenen euch hergebend. Ihr habt ja doch die Leiden der Gefangenen geteilt, und die Beraubung eures Besitzes mit Freuden auf euch genommen.< Hier ist von Vermögenskonfiskation als Bestrafung die Rede und von Unterstützung für andere mit- betroffene Gemeinden.“[31] Zu guter letzt, findet sich noch ein Hinweis für die Armut der Urgemeinde ohne kommunistische Einflüsse. Denn 44 - 48 n. Chr. gab es eine schwere Hungersnot. Zu dieser Zeit waren Cuspius Fadus und Tiberius Alexander die Prokuratoren.
Dieser Umstand belegt doch, daß das Korn eine seltene Ware war. „ Diese Hungersnot war der Anlaß zu der ersten Kollekte in Antiochia.“[32] Als Fazit kann also festgehalten werden, „ daß der urchristliche Kommunismus nie soziale Wirklichkeit war.“[33]
3. Die Riten der Urgemeinde
Bei diesem Punkt möchte ich auf die Riten der Urgemeinde eingehen. Es gab eine Vielzahl von Riten: Proselytentaufe, Beschneidung, Darbietung von Opferfleisch etc. Doch ich möchte stellvertretend für die anderen folgende drei näher betrachten:
1. Die Taufe
2. Abendmahl; Herrenmahl
3. Der Gottesdienst bzw. die täglichen Versammlungen
Diese drei Riten sollen die allmähliche Trennung vom Judentum dokumentieren. Es sind speziell diese Riten ausgewählt worden da sie noch heute im Christentum vorhanden sind.
3.1 Die Taufe
„ Den Ritus der Taufe übernahmen die Christen von Johannes dem Täufer. Jesus selbst hatte sich von ihm taufen lassen. Wie die Taufe dann nach seinem Tod in der Gemeinde auf- kam, ist nicht bekannt.“[34]
Bultmann geht davon aus, daß die Taufe in der Gemeinde als Aufnahmeritus vollzogen wurde. Aber sie war nicht nur ein Aufnahmeritus, sondern war auch mit der Buße verbunden.[35] Sie war auch ein „ Bad der Reinigung für die kommende Gottesherrschaft, also ein Initiations- ritus der eschatologischen Gemeinde (...).“[36]
„ Was nun die Taufe betrifft, die auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des h. Geistes vollzogen wurde (...), dass sie als Bad der Wiedergeburt und als Erneuerung des Lebens insofern galt, als man annahm, dass die vergangenen Sünden, der > einstigen Blindheit < durch sie getilgt wurden.“[37] Es kann angenommen werden, daß die Taufe von Beginn an als Geist- taufe gegeben und empfangen wurde.[38] „ Ihre Wirkungen ( Vergebung der Sünden, Ein- fügung in das neue Bundesvolk, Verleihung des Geistes ) setzen auf der Seite des Täuflings das > Bekenntnis < voraus: das Eingeständnis seiner Sünden ( Mk 1, 5 ) und das positive Be- kenntnis des Glaubens an Jesus.“[39] Die Geistgabe wurde durch Auflegen der Hände des Täufers erreicht. Die Taufe sollte „ wenn möglich ein Tauchbad“[40] sein.
Ein Beispiel für eine Taufe mit Tauchbad wäre Johannes der Täufer. Falls die Taufe, ergo das Tauchbad als Reinigung, in der Urgemeinde anerkannt wurde, so Bultmann, dann „ hat die Taufe in der Urgemeinde schon sakramentalen Charakter gehabt, ist also vollständig als eschatologisches Sakrament, das zum Gliede der heiligen Gemeinde der Endzeit macht, zu be- zeichnen.“[41]
3.2 Abendmahl; Herrenmahl
In der Urgemeinde gab es anscheinend zwei Arten vom Abendmahl. Zum einen das Brot- brechen und zum andern die Eucharistie. Der Unterschied zwischen den beiden Formen des Abendmahls liegt darin begründet, daß das Brotbrechen eine Fortsetzung der Mahlge- meinschaft Jesu mit den Jüngern ist ohne sakramentalen Charakter. Bei der Eucharistie hin- gegen soll das Mahl erinnern an den Tod Jesu. Diese Variante der Abendmahlsfeier ist im Gegensatz zum Brotbrechen eine gottesdienstliche Form. „ Bei der Eucharistie wird die empfangende Gemeinde zum > totus Christus < ( > ganzer Christus < ); die Gläubigen der Gemeinde sind Glieder des in ihnen handelnden Christus. Die Kirche ist also wahrer Leib Christi, im Mysterium der Eucharistie repräsentiert.“[42]
Über die Bedeutung und Anzahl der Abendsmahlsfeiern läßt sich folgendes sagen: „ Was nun das Abendmahl betrifft, so ist das Wichtigste, dass seine Feier immer mehr der Mittelpunkt wurde nicht nur für den Cultus der Gemeinde, sondern für ihr Leben als Gemeinde überhaupt.“[43] Das Abendmahl ist „ von der ersten Generation der Christenheit an regelmäßig, zunächst täglich ( Apg 2, 42 ,46 f ), dann wöchentlich an jedem ersten Tag der Woche ( Apg 20, 7 u. a. ) gefeiert worden (...).“[44] Bei Form und Intention der Abendmahlsfeier sagt die Literatur, daß die Deutehandlungen, Brot und Wein, die Feier eingerahmt hatten.[45]
„ Die Form, welche dieser Feier zukommt - die gemeinsame Mahlzeit -, liess sie geeignet erscheinen, Ausdruck der brüderlichen Einheit der Gemeinde zu sein (...); die Gebete die sie einschloss, boten sich als Vehikel dar, um im Dank und Bitte Alles vor Gott zu bringen, was die Gemeinde bewegte, und die Aufbringung der Elemente für die h. Handlung erweiterte sich naturgemäss zur Darbietung von Gaben für den armen Mitbruder, der sie auf diese Weise aus der Hand Gottes empfing. In all diesen Beziehungen stellte sich aber die h. Handlung als ein Gemeindeopfer dar, und zwar als ein Opfer des Dankes (...), wie sie denn auch genannt worden ist.“[46]
3.3 Der Gottesdienst bzw. die täglichen Versammlungen
Wie in Punkt 3.2 zu lesen war, wurde das Abendmahl anfangs täglich gefeiert und später nur noch einmal pro Woche. Wie es für das Abendmahl zwei Bezeichnungen gab, gab es auch zwei Bezeichnungen für den Gottesdienst. Zum einen den Gottesdienst, zum anderen die Um- schreibung, die täglichen Versammlungen. Diese zwei Bezeichnungen meinen aber das selbe, nämlich den Gottesdienst. Der Ausdruck der täglichen Versammlung läßt darauf schließen, daß zu Beginn der Urgemeinde jeden Tag ein Gottesdienst statt fand.. Conzelmann vermutet, daß der erste Tag der Woche ( also der Sonntag ) ein geeigneter Tag gewesen sei um einen Gottesdienst abzuhalten.[47] Bezüglich des Sonntags schreibt er: „In den Evangelien ist dieser Tag der Tag der Auferstehung Jesu: Jesus starb an einem Freitag und wurde > am dritten Tag < bzw. > nach drei Tagen < auferweckt. Beide Ausdrücke sind gleichbedeutend und um- spannen den Zeitraum von Freitag zum Sonntag.[48]
Ein weiterer Grund für die Wahl des Sonntags läßt sich begründen durch die Ablehnung des jüdischen Kalenders durch die Christen. Dadurch wurde der Tag des Herrn bestimmend für den Gottesdienst.[49]
Nun drängt sich aber die Frage auf, woher kommt der urchristliche Gottesdienst? Ist der Gottesdienst etwas Urchristliches oder stammt er auch wie das Christentum aus dem Judentum?
Es kann davon ausgegangen werden, daß der Gottesdienst ursprünglich dem Vorbild der Synagoge folgt d. h. „ > Wortgottesdienst < mit Gebet, Schriftlesung und Lehre“[50] ohne Opferkult. Bei der Liturgie und der Intention des Gottesdienstes kann festgehalten werden, daß der Grundsatz jedes Gottesdienstes die > Erbauung < ist.[51]
In der Frühform des Gottesdienstes gab es auch eine aktive Beteiligung der Gemeinde, die sich in zurufen äußerte. So z. B. entstand das Vaterunser.[52] „ Frühe liturgische Elemente sind der eschatologische Ruf > maranatha <, die Gebetsanrede > abba < und natürlich das ( christo- logische ) Bekenntnis.“[53]
Der eschatologische Ruf > maranatha < bedeutet übersetzt > Unser Herr, komm! < oder > Unser Herr ist gekommen <.[54] Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist aber, daß maranatha eine Bitte ist; > Komm! <[55]. Bei dem Wort > abba < ist die Übersetzung einfacher, denn > abba < bedeutet > Vater <.[56] Mit der Intention verhält es sich so, daß der Gottesdienst einerseits lehrend, erbauend ist und eine Feier darstellt, um die Gemeinde als eine Gemeinschaft darzustellen. Gleichzeitig soll diese Gemeinschaft anhand dieses Gottesdienstes ihren Daseinsgrund festigen und verge- wissern.[57]
In die gleiche Richtung geht G. Brüning indem er sagt, daß die Christen Gemeinschaftswesen sind, „ weil der Heilige Geist Gemeinschaft stiftet, und zwar durchaus auch unter Menschen, die von Natur aus nicht alle zusammenpassen. Der Mangel an Gemeinschaft lässt nicht nur den Glauben erhalten, sondern widerspricht diametral dem Willen Jesu, der zusammengebracht hat, was von Gott her zusammen gehört: Gott, den Schöpfer, mit seinen geliebten Kindern, die bei allen menschlichen Unterschieden eint, dass sie ohne Ausnahme der Umkehr und der Gnade Gottes bedürfen.“[58]
Wenn man die vorangegangene Aussage zugrunde legt, ist es auch verständlich warum die Gottesdienste allen zugänglich waren. Egal ob sie Christen sind oder einer anderen Religion angehörten. So gesehen kann man den Gottesdienst als die Urform der Missionierung an- sehen.[59]
4. Die Organisation der Urgemeinde
Bei der Organisation der Urgemeinde gibt uns die Apostelgschichte einen sehr guten Einblick.
An der Spitze der Gemeinde sind die Apostel. Bei denen Petrus so zusagen der oberste war.
Dann folgen die Ältesten, auch bekannt als > die Presbyter. Danach kommen die Diakone, die . Die letzte Instanz, von der in der Apostelgeschichte zu lesen ist, ist die Gemeindeversammlung. Aber diese Struktur der Gemeinde, so Conzelmann, ist nur ein Bild.[60]
Wie war es nun wirklich?
Es gab in der Gemeinde > geistliche < Funktionen, die die > Geistträger < inne hatten.
> Geistträger < waren charismatische Menschen wie Apostel, Propheten und Lehrer. Sie waren zuständig für die Gesamtkirche. Da sie aber nicht alle Aufgaben der Gemeinde bewältigen konnten, wurden Episkopen, = Aufseher über die Seelen, Bischof[61] und Diakone, = Diener, Helfer, Diakon[62], ausgewählt, die den > Geistträgern <
helfen sollten.[63] In die selbe Richtung geht auch Adolf von Harnack. Er sagt, daß der Ge- meinde eine doppelte Organisation überliefert ist. „ Die gründet sich auf die und galt als direct von Gott gesetzt: die andre stand mit der Oekonomie der Ge- meinde, vor Allem mit der Gabendarbietung - also dem Opferdienst - im engsten Zu- sammenhang. Dort waren es von Gott berufene und ausgerüstete, der Christen - nicht einer einzelnen Gemeinde geschenkte , die als , und das Evangelium zu verbreiten resp. die Kirche Christi zu erbauen hatten; (...) von der Einzelgemeinde bestellte und , welche die Gaben entgegenzunehmen und zu verwalten, den Opferdienst ( wenn keine Propheten vorhanden waren ) zu vollziehen und die Gemeindeangelegenheiten zu besorgen hatten.“[64]
Conzelmann/ Lindemann stimmt mit A. v. Harnack dahingehend überein, daß die Leitung der Urgemeinde in den Händen der Zwölfen lag. Aber wann die Institution der Ältesten be- gann, vermögen sie nicht genau zu datieren.[65]
Bultmann schließt sich bezüglich der Leitung der Urgemeinde Conzelmann/ Lindemann an.
Bei der Datierung zum Beginn der Ältesten als Instutition kann er zwar auch keine Datierung liefern, er geht allerdings davon aus, daß es recht früh zu der Wahl der Ältesten gekommen sein muß.[66]
Soeben konnten unterschiedliche Standpunkte bezüglich der Organisation der Urgemeinde gelesen werden. Da aber weder Heussi noch Harnack eine Jahreszahl liefern konnten, schließe ich mich aufgrund der Erscheinungsjahre der jeweiligen Werke ( siehe Literaturverzeichnis ) der Stellung von Conzelmann, Bultmann und Conzelmann/ Lindemann an.
5. Das Selbstverständnis und die Eschatologie der Urgemeinde
Im folgenden Abschnitt soll geklärt werden, ob die Urgemeinde ein Selbstverständnis gehabt hat und wie dieses sich im Einklang mit der eschatologischen Grundhaltung verhielt.
Die Urgemeinde hatte zwei Möglichkeiten:
„ Die Gemeinde kann sich an den Rand des Kulturlandes zurückziehen, wie die Gruppe von Qumran, und dort in Erwartung des kommenden Menschensohnes zum Himmel starren. In diesem Fall überläßt sie die Welt den bösen Mächten. Sie reserviert lediglich für sich einen geschützten Raum. Sie geht mit ihrer Botschaft in die Welt, sondern lädt ein, die Kirche zu besuchen.“[67]
Durch dieses Zurückziehen würde sie aber den Verdacht erwecken, daß sie eine Sekte sei.
So bleibt nur noch die zweite Möglichkeit.
„ Die Kirche mußte aufgrund ihres Glaubens einen anderen Weg wählen. Sie bleibt in der Welt ( ist also, von außen gesehen, konservativer als die Qumran - Gruppe ). Damit stellt sie sichtbar dar, daß sie keine Sekte ist. Sie dokumentiert den Anspruch Jesu auf Israel.“[68]
Martin Metzger legt dar, daß die Jerusalemer Urgemeinde fast nur aus Juden bestand. Die Gemeindeglieder nahmen am Tempelkult teil, befolgten das Gesetz und hatten nicht vor sich vom Judentum zu trennen, geschweige denn eine eigenständige Religion zu gründen. Durch die Auferstehung „ ist die eschatologische Heilszeit angebrochen. Die Urgemeinde erwartet, daß der Auferstandene in Kürze als Messias, als der bei Daniel geweissagte Menschensohn, vom Himmel kommen werde, um das Weltende herbeizuführen, das Endgericht zu vollziehen und die Herrschaft auf Erden anzutreten.“[69]
Bei dem Selbstverständnis der Urgemeinde stellt Metzger fest, daß die Urgemeinde sich als das eschatologische Gottesvolk ansah und, wie schon erwähnt, nicht als eine Sonderform des Judentums geschweige denn eine neue Religion. Die Urgemeinde sah sich als Repräsentant Israels. Ihre Verkündigungen waren am Anfang nur an Juden gerichtet, um unter den Juden ganz Israels die Ankunft des Messias zu verbreiten.[70]
„ Die Messiasvorstellung bekam durch die Verbindung mit der Person des gekreuzigten Jesus einen neuen Inhalt, das national - jüdische trat zurück hinter dem menschlich - sittlichen Charakter des barmherzigen Freundes der Mühseligen und Beladenen und des unschuldig verfolgten Dulders, der durch Leiden zu seiner Herrlichkeit eingegangen ist; der Gedanke > des leidenden Messias <, der dem Judentum bis dahin völlig fremd gewesen, brachte einen ganz neuen Ton in die religiöse Stimmung und Denkart. (...) die Abkehr von der jetzigen vergehenden und das sehnsüchtige Harren auf die kommende neue Welt, die eine Erlösung von allem Druck der Gegenwart bringen werde, wurde dadurch in noch viel stärkerem Grade als sonst der Grundton des frommen Glaubens.“[71]
In die selbe Richtung geht auch Bultmann, wenn er sagt, „ daß sie Jesus versteht als den, den Gott durch die Auferweckung zum Messias gemacht hat, und daß sie ihn als den kommenden > Menschensohn < erwartet.“[72]
Mehr auf Paulus und die Evangelien eingehend, aber doch in die selbe Richtung, argumentiert Conzelmann. „ Früh kommt (...) die Bezeichnung > ekklesia < auf, die wir mit > Gemeinde < und > Kirche < übersetzen; sie hat denselben Sinn: die Gemeinde der Erwählten Gottes in der Endzeit. In der theologischen Fachsprache ausgedrückt: Die christliche Gemeinde versteht sich als eschatologische Gemeinschaft.“[73]
Das Selbstverständnis und die Eschatologie der Urgemeinde muß man zusammen behandeln, da das eine das andere beinhaltet und es das eine ohne das andere nicht geben kann.
Da die Urgemeinde in einer Naherwartung bezüglich der Rückkehr des Messisas lebt, ist auch der Glaube der Endzeit, der Eschatologie = die Lehre von den letzten Dingen, ohne Zweifel angepaßt worden.
6. Gruppen und Strömungen in der Urgemeinde
In diesem Punkt soll geklärt werden ob in der Urgemeinde Gruppen und Strömungen vorhanden waren und wie für die entstehenden Probleme Lösungen gefunden wurden.
„ Bereits vor der Bekehrung des Paulus ( zwischen 32 / 35 ) zeigte sich in der Jerusalemer Urgemeinde eine Differenz zwischen den traditionell gestzestreuen, aramäisch sprechenden Christen und den aus der Diaspora stammenden Hellenisten, die dem Tempelkult und - wie der faktische Verzicht auf die Beschneidung ( Apg 15, 1 ) in der von ihnen betriebenen Mission zeigt - der Verpflichtung auf das ganze jüdische Gesetz kritisch gegenüberstanden. Der geistige Exponent dieser Gruppe war offenbar Stephanus, der erste uns bekannte Märtyrer der Geschichte.“[74]
Bei der erwähnten > traditionell gesetzestreuen, aramäisch sprechenden Christen < muß aber unterschieden werden zwischen der Gruppe des leiblichen Bruders Jesu, Jakobus, und der Gruppe von Petrus. Die Jakobus Gruppe hielt am Gesetz fest und forderte die Beschneidung.[75]
Heute könnte man sie als > Hardliner < bezeichnen.
Die Gruppe um Petrus zu der auch die Söhne des Zebedaios gehörten, Jakobus und Johannes, hielt zwar auch am Gesetz fest, doch vertraten sie eine gemäßigtere Haltung. Sie folgten der > noachischen <, der milderen Rabbinenschule.[76]
Den Gipfel erreichte dieser Streit zwischen, Hellenisten und Judenchristen, als er Bestandteil des Apostelkonzils in Jerusalem ( etwa 48 n. Chr. ) war.[77] Dieser Streit bedrohte die Gemein- schaft der Christenheit. Es hätte passieren können, daß die Kirche an diesem Streit zerbricht.[78]
Bei diesem Apostelkonzil kam es dann zum Aufeinandertreffen der einzelnen Gruppen.
Jakobus, Petrus und als Vertreter der Hellenisten trat Paulus heran.
„ Um den Streit zu schlichten, wurden in Jerusalem Bestimmungen erlassen, die von den Heidenchristen gewisse Konzessionen forderten; es ist das sog. Aposteldekret ( Act 21, 25 )“[79]
Bevor ich zur Lösung dieses Problems komme, möchte ich noch als einen kleinen Exkurs die Zwiespältigkeit Petrus bezüglich des enstandenen Problems mit einem Zitat andeuten.
„ (...) daß er als von der Jerusalemer Gemeinde abhängiger Missionsleiter den Jakobus- leuten gegenüber einen viel schwereren Stand hatte als der unabhängige Paulus, und daß dieser Konflikt den Petrus, das ehemalige und erste Haupt der Gemeinde, in ein besonders schmerzliches Dilemma gebracht haben muß, daß wir nur ahnen können, da uns von Petrus keine umfangreiche Briefsammlung wie von Paulus erhalten ist und er außerdem gerade wegen seiner Abhängigkeit von Jerusalem wohl kaum wie Paulus die Möglichkeit hatte, darüber ebenso offen zu sprechen.“[80]
Nun aber zur Lösung des Problems. Grundsätzlich kann gesagt werden, daß die Heiden nicht zu Juden werden mußten. „Diese Grundentscheidung des Apostelkonzils ist vor allem Simon Petrus zu verdanken Apg 15, 7 ff; Gal 2, 7 f.“[81]
Der Grund, warum Petrus diese Grundentscheidung zu verdanken ist, liegt darin, daß er „ in der Frage der Stellung zum Heidenchristentum und zum Gesetz viel näher bei Paulus als bei Jakobus steht.“[82] Daß Petrus näher an Paulus Stellung war ist so zu verstehen, daß Paulus die Auffassung des Stephanus vertrat. Dies bedeutet, daß er keinen Grund darin sah warum die bekehrten Heiden sich beschneiden lassen und zum Judentum übertreten sollten.[83]
Den Heidenchristen wurde zugestanden, unbeschnitten zu bleiben und gesetzesfrei zu leben, sie sollten allerdings „ sich vor der Befleckung durch die Götzen, durch Unzucht, durch Genuß von Ersticktem und Blut hüten Apg 15, 20. Diese Reinigungsforderungen schließen sich an Satzungen des AT in Lev 17 u. 18 an: Verbot fremder Opfer, von Blutgenuß, des nicht rituell geschlachteten Fleisches, von Verwandtenehen.“[84]
Dieses Konzil hatte einen großen Hintergrund: „ Abfalljudentum ( 1 Makk 1, 15 f; 1 Kor 7, 18) und Loslösung von dem Bund der Väter sollen auf jeden Fall verhindert werden.“[85]
In der Literatur wird allerdings ein Problem aufgewiesen, bezüglich des Aposteldekrets. Das Problem liegt darin, daß zwei Arten des Aposteldekrets vorliegen. Zum einen in der Apostelgeschichte, zum anderen im Galaterbrief. Dibelius nimmt an „ das > Apostel- dekret < ist wohl in späterer Zeit und bestimmt ohne Beteiligung des Paulus entstanden und hat mit dem Apostelkonzil nichts zu tun. Auch sonst zeigt der Bericht der Apostelgeschichte über das Apostelkonzil, daß Lukas keine genaueren Kenntnisse über das dort Vorgefallene hatte, so daß wir für dieses Ereignis ganz auf den Bericht des Paulus angewiesen bleiben.“[86]
Bestätigt wird die Aussage Dibelius von Bornkamm[87] und Conzelmann/ Lindemann[88]. Aus diesem Grund finde ich die folgende Annahme von Dibelius am ehesten wahrscheinlich. Paulus konnte die Forderungen von der Jakobus Gruppe ablehnen, da auf seiner Seite die Urapostel standen, welche ihm recht gaben und seine Berufung durch Gott anerkannten, „ und den Paulus zugestanden, daß von den Heiden keinerlei Erfüllung des jüdischen Gesetzes gefordert werden dürfe, wenn sie Christen wurden.“[89]
Um künftigen Konflikten aus dem Wege zu gehen, beschloß man am Ende des Konzils, „ daß Paulus und Barnabas im heidnischen Gebiet Mission treiben sollten, während die Urapostel sich wesentlich der Gewinnung von Juden widmen wollten.“[90]
7. Das Ende der Urgemeinde
Um das Ende der Urgemeinde anschaulich darstellen zu können, muß man das Hauptaugen- merk dazu auf die Geschichte Israels legen.
„ Judäa und Samaria hatten schon in der Zeit von der Amtsenthebung des Archelaus (9 n. Chr.) bis zum Königtum Agrippas ( 41 n. Chr. ) einem Prokurator unterstanden. Der Prokurator be- fehligte die Besatzungstruppen. Er hatte die Aufgabe, für Ruhe und Ordnung zu sorgen und die Steuerhebung. Ihm oblag die Rechtssprechung in letzter Instanz.“[91]
Mit der Ruhe und der Ordnung war es aber nicht so weit her. In den Jahren zwischen 9 n. Chr. bis 41 n. Chr. kam es des öfteren zu schweren Konflikten.
Die Juden waren vom Kaiserkult befreit, genauso wie im Tempel von Jerusalem keine Kaiser- statuen zur Anbetung standen. Der Prokurator residierte in Cäsarea, um den Kaiserkult vom jüdischen Kultzentrum entfernt abzuhalten. Also um Konflikte zu vermeiden.[92]
Der erste Streit entbrannte, als Quirinius zur Steuererfassung den Census ( = Aufstellung von Bürgerlisten zum Zwecke der Vermögensschätzung und Musterung[93] ) einführte. Der zweite Streit entbrannte, da der allseits bekannte Pilatus zum einen eine Weiheinschrift, die dem Kaiser gewidmet war, aufstellen wollte, und zum anderen der Wasserleitungsbau nach Jerusalem den ganzen Tempelschatz beanspruchte.[94]
Ein weiterer Konflikt kam auf, als sich Caligula für Gott hielt und überall den Kaiserkult einführte. Natürlich weigerten sich die Juden dies zu tun. So kam es zu Judenverfolgungen, ge- waltsamen Aufstellen von Kaiserstatuen in Synagogen und Brandanschlägen auf Synagogen.
Dieser Konflikt gipfelte darin, daß gesetzestreue Juden ( 39 n. Chr. ) einen Kaiseraltar zer- störten. Caligula befahl daraufhin, ein Kaiserbild im Jerusalemer Tempel aufzustellen. Der Statthalter Petronius erkannte die Gefahren, die eine solche Tat heraufbeschwören würde, und bat den Kaiser zur Einsicht. Ohne Erfolg. So überging er den Befehl des Kaisers. Zum Glück der Jerusalemer Gemeinde und zum Glück Petronius wurde Caligula 41 n. Chr. ermordet.[95]
In diesem Jahr kam Agrippa I. an die Macht. In seiner dreijährigen Herrschaft beruhigte sich die Lage wieder etwas.[96]
Nach seinem Tod wurde das Land von römischen Prokuratoren verwaltet. Es bildete sich die Widerstandsgruppe der Zeloten.[97]
Unter dem Prokurator Ventidius Cumanus ( 48 - 52 n. Chr. ) kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Römern und Zeloten. Unter dem Nachfolger des Cumanus, dem Prokurator Antonius Felix ( 52 - 60 n. Chr. ), schloß sich die Gruppe der Sikarier zu- sammen, die jeden ermordeten, der nicht an der antirömischen Bewegung teilnehmen wollte.
Sie ermordeten sogar den Hohepriester Jonatan. Wanderpropheten verschärften die Spannungen durch die Erweckung messianischer Hoffnungen. Unter den Prokuratoren Albinus ( 63 - 64 n. Chr. ) und Florus ( 64 - 66 n. Chr. ) eskalierte die Lage.[98]
Anlaß des blutigen Aufstandes war, daß Florus den Tempelschatz um 17 Talente plünderte.
Die Empörung der Juden beantwortete Florus mit einem Überfall auf die Stadt und Plünderungen. Als er mit seinen Kohorten in die Stadt einzog, brach der Aufstand los. Florus mußte sich nach Cäsarea absetzen. In Jerusalem blieb nur eine Kohorte zurück, die in der Burg Antonia stationiert war. Das Opfer für den Kaiser wurde eingestellt und die Burg Antonia gestürmt. Kaiser Nero schickte seinen General Vespasian in den Krieg gegen die Juden. Dieser überrannte Galiläa und belagerte die jüdischen Widerstandskämpfer unter Josephus in Jotapata. Josephus wurde gefangen genommen und wurde zum Augenzeugen und Geschichts- schreiber des jüdischen Krieges in Gefangenschaft. Als 69 n. Chr. Vespasian zum Kaiser aus- gerufen wurde, begab er sich zurück nach Rom und übertrug den Oberbefehl im jüdischen Krieg seinem Sohn Titus. Dieser griff Jerusalem an und es gelang ihm, in die Stadt einzu- dringen. Bei diesem Einbruch in die Stadt wurde auch der Tempel zerstört. Als Siegestrophäe nahm Titus den Siebenarmigen Leuchter und den Schaubrottisch mit nach Rom. Mit dem Untergang des Tempels und der Stadt war das Zentrum des Judentums untergegangen. Letzten Widerstand leisteten Widerstandskämpfer auf der Festung Masada, die erst 74 n. Chr. von den Römern eingenommen werden konnte. Die jüdischen Freiheitskämpfer starben durch Freitod, als ihre Lage aussichtslos geworden war.[99] Während des jüdischen Krieges verließ die urchristliche Gemeinde Jerusalem und zog sich zurück nach Pella, im Dekapolis Gebiet, außerhalb des Kriegsgebietes.[100] Mit dieser Flucht nach Pella könnte man das Ende der Urgemeinde datieren.
Literaturverzeichnis
1. Die Bibel; Nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen; revidierte Fassung von 1984
2. de Boor, Walter/ Pohl, Adolf ( Hrsg. ); Wuppertaler Studienbibel; Reihe: Neues Testament, Die Apostelgeschichte; R. Brockhaus Verlag; Wuppertal 1983
3. Bornkamm, Günther; Paulus; zweite, durchgesehene Auflage; Stuttgart u. a. 1969
4. Brandes, Georg; Urchristentum; Berlin 1927
5. Brüning, Gerhard; Roter Faden Apostelgeschichte, Ihr werdet meine Zeugen sein; Wuppertal 1997
6. Bultmann, Rudolf; Theologie des Neuen Testaments; 7., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage; Tübingen 1977
7. Calwer Bibellexikon; Schlatter, Theodoer u. a. ( Hrsg. ); fünfte Bearbeitung; sechste Auf- lage; Stuttgart 1989
8. Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969
9. Conzelmann, Hans/ Lindemann, Andreas; Arbeitsbuch zum Neuen Testament; Tübingen 1975
10. Cullmann, Oscar; Petrus, Jünger - Apostel - Märtyrer: Das historische und das theologische Petrusproblem; Zürich 1952
11. Deresch, Wolfgang ( Hrsg. ); Der Glaube der religiösen Sozialisten; Hamburg 1972
12. Dibelius, Martin/ Kümmel, Werner G.; Paulus; in: Sammlung Göschen, Band 1160; vierte verbesserte Auflage; Berlin 1970
13. Drehsen, Volker u. a. ( Hrsg. ); Wörterbuch des Christentums; Sonderausgabe 1995; Düsseldorf 1988
14. Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde; Burkhardt, Helmut/ Swarat, Uwe ( Hrsg. ); Band 1 A - F; 2. Auflage, korrigierter Nachdruck der 1. Auflage; Wuppertal 1998
15. Harnack, Adolf von; Lehrbuch der Dogmengeschichte; Erster Band: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas; Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage; Freiburg I. B. und Leipzig 1894
16. Heussi, Karl; Kompendium der Kirchengeschichte; 14. Auflage; Tübingen 1976
17. Der Kleine Pauly; Lexikon der Antike; Ziegler, Konrat/ Sontheimer, Walther ( Hrsg. ); Band 1: Aachen - Dichalkon; München 1979
18. Lohse, Eduard; Umwelt des Neuen Testaments; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 1; 5., durchgesehene und ergänzte Auflage; Göttingen 1980
19. Meffert, Franz; Das Urchristentum, Apologetische Abhandlungen; Mönchengladbach 1922
20. Metzger, Martin; Grundriss der Geschichte Israels; 5. Auflage; Neukirchen - Vluyn 1979
21. Neudorfer, Heinz - Werner; Die Apostelgeschichte, 1. Teil; in: Die Reihe des Edition C Bibelkommentars zum Neuen Testament; Band 8; Neuhausen - Stuttgart 1996
22. Noth, Martin; Geschichte Israels; vierte, unveränderte Auflage; Göttingen 1959
23. Ökumenische Kirchengeschichte; Kottje, Raymund/ Moeller, Bernd ( Hrsg. ); Band 1, Alte Kirche und Ostkirche; zweite Auflage; Mainz 1978
24. Pfleiderer, Otto; Die Entstehung des Christentums; zweite, unveränderte Auflage; München 1907
25. Preuschen, Erwin; Griechisch - Deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament; 5., verbesserte und vermehrte Auflage; Berlin 1963
26. RGG; Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft; Galling, Kurt ( Hrsg. ); Sechster Band Sh - Z; Ungekürzte Studienausgabe; Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage; Tübingen 1986
27. Schneider, Carl; Das Christentum; in: Propyläen Weltgeschichte; Band 4; Rom; Die römische Welt; Frankfurt a. M.; Berlin 1963
28. Steinmann, Alphons; in: Die Heilige Schrift des Neuen Testaments, Band IV: Die Apostel- geschichte; vierte, neu überarbeitete Auflage; Bonn 1934
[...]
[1] Meffert, Franz; Das Urchristentum, Apologetische Abhandlungen; Mönchengladbach, 1922; Seite 80
[2] ebenda; Seite 80
[3] Schneider, Carl; Das Christentum; in: Propyläen Weltgeschichte; Band 4: Rom; Die römische Welt; Frankfurt a. M.; Berlin 1963; Seite 442
[4] RGG; Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft; hrsg. Galling, Kurt; Sechster Band: Sh - Z; Ungekürzte Studienausgabe; Dritte , völlig neu bearbeitete Auflage; Tübingen 1986; Spalte 1188
[5] Meffert, Franz; Das Christentum, Apologetische Abhandlungen; Mönchengladbach, 1922; Seite 80
[6] Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde; Burkhardt, Helmut/ Swarat, Uwe (Hrsg.); Band 3 R - Z; 2. Auflage, korrigierter Nachdruck der 1. Auflage; Wuppertal 1998; Seite 2065
[7] ebenda; Seite 2065
[8] Deresch, Wolfgang ( Hrsg. ); Der Glaube der religiösen Sozialisten; Hamburg 1972; Seite 39
[9] ebenda; Seite 39
[10] ebenda; Seite 39
[11] ebenda; Seite 39
[12] Meffert, Franz; Das Urchristentum, Apologetische Abhandlungen; Mönchengladbach 1922; Seite 81 f
[13] Brandes, Georg; Urchristentum; Berlin 1927; Seite 54
[14] de Boor, Walter/ Pohl, Adolf ( Hrsg. ); Wuppertaler Studienbibel; Reihe: Neues Testament, Die Apostel- geschichte; R. Brockhaus Verlag; Wuppertal 1983; Seite 75
[15] Steinmann, Alphons; in: Die Heilige Schrift des Neuen Testaments, Band IV: Die Apostelgeschichte; vierte, neu überarbeitete Auflage; Bonn 1934; Seite 43
[16] Meffert, Franz; Das Urchristentum, Apologetische Abhandlungen; Mönchengladbach 1922; Seite 82 f
[17] Die Bibel; Nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen; revidierte Fassung von 1984; Apg 4, 32 - 37; Seite 145
[18] de Boor, Walter/ Pohl, Adolf ( Hrsg. ); Wuppertaler Studienbibel; Reihe: Neues Testament, Die Apostel- geschichte; R. Brockhaus Verlag; Wuppertal 1983; Seite 106
[19] Neudorfer, Heinz - Werner; Die Apostelgeschichte, 1. Teil; in: Die Reihe des Edition C Bibelkommentars zum Neuen Testament; Band 8; Neuhausen - Stuttgart 1996; Seite 108
[20] Meffert, Franz; Das Urchristentum; Mönchengladbach 1922; Seite 83
[21] Die Bibel; Nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen; revidierte Fassung von 1984; Apg 5, 1-4; Seite 145
[22] Meffert, Franz; Das Urchristentum; Mönchengladbach 1922; Seite 83
[23] de Boor/ Pohl, Adolf ( Hrsg. ); Wuppertaler Studienbibel; Reihe: Neues Testament, Die Apostelgeschichte; R. Brockhaus Verlag; Wuppertal 1983; Seite 111 f
[24] Steinmann, Alphons; in: Die Heilige Schrift des Neuen Testaments; Band IV: Die Apostelgeschichte; vierte. neu überarbeitete Auflage; Bonn 1934; Seite 56 f
[25] Neudorfer, Heinz - Werner; Die Apostelgeschichte, 1. Teil; in: Die Reihe des Edition C Bibelkommentars zum Neuen Testament; Band 8; Neuhausen - Stuttgart 1996; Seite 111f
[26] Steinmann, Alphons; in: Die Heilige Schrift des Neuen Testaments; Band IV: Die Apostelgeschichte; vierte, neu überarbeitete Auflage; Bonn 1934; Seite 43
[27] Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 34
[28] ebenda; Seite 34
[29] ebenda; Seite 34
[30] ebenda; Seite 34
[31] Meffert, Franz; Das Urchristentum, Apologetische Abhandlungen; Mönchengladbach 1922; Seite 89
[32] ebenda; Seite 89
[33] Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 34
[34] Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 35
[35] Bultmann, Rudolf; Theologie des Neuen Testaments; 7., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage; Tübingen 1977; Seite 41
[36] ebenda; Seite 41
[37] Harnack, Adolf von; Lehrbuch der Dogmengeschichte; Erster Band: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas; Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage; Freiburg I. B. und Leipzig 1894; Seite 198
[38] Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 36
[39] ebenda; Seite 36
[40] ebenda; Seite 36
[41] Bultmann, Rudolf; Theologie des Neuen Testaments; 7., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage; Tübingen 1977; Seite 42
[42] Drehsen, Volker / u. a.( Hrsg. ) ; Wörterbuch des Christentums; Sonderausgabe 1995; Düsseldorf 1988; Seite 18
[43] Harnack, Adolf von; Lehrbuch der Dogmengeschichte; Erster Band: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas; Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage; Freiburg I. B. und Leipzig 1894; Seite 200
[44] Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde; Burkhardt, Helmut/ Swarat, Uwe ( Hrsg. ); Band 1 A - F; 2. Auflage, korregierter Nachdruck der 1. Auflage; Wuppertal 1998; Seite 4
[45] Drehsen, Volker/ u. a. ( Hrsg. ); Wörterbuch des Christentums; Sonderausgabe 1995; Düsseldorf 1988; Seite 17
[46] Harnack, Adolf von; Lehrbuch der Dogmengeschichte; Erster Band: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas; Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage; Freiburg I. B. und Leipzig 1894; Seite 200
[47] Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 36 f
[48] ebenda; Seite 37
[49] Calwer Bibellexikon; Schlatter, Theodor u. a. ( Hrsg. ); fünfte Bearbeitung; sechste Auflage; Stuttgart 1989; Spalte 450
[50] Conzelmann, Hans/ Lindemann, Andreas; Arbeitsbuch zum Neuen Testament; Tübingen 1975; Seite 395
[51] Calwer Bibellexikon; Schlatter, Theodor u. a. ( Hrsg. ); fünfte Bearbeitung; sechste Auflage; Stuttgart 1989; Spalte 450
[52] ebenda; Spalte 450
[53] Conzelmann, Hans/ Lindemann, Andreas; Arbeitsbuch zum Neuen Testament; Tübingen 1975; Seite 395
[54] Preuschen, Erwin; Griechisch - Deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament; 5. Verbesserte und vermehrte Auflage; Berlin 1963; Seite 118
[55] Conzelmann; Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 37
[56] Preuschen, Erwin; Griechisch - Deutsches Taschenwörterbuch zum Neuen Testament; 5. Verbesserte und vermehrte Auflage; Berlin 1963; Seite 7
[57] Drehsen, Volker u. a. ( Hrsg. ); Wörterbuch des Christentums; Sonderausgabe 1995; Düsseldorf 1988; Seite 437
[58] Brüning, Gerhard; Roter Faden Apostelgeschichte, Ihr werdet meine Zeugen sein; Wuppertal 1997; Seite 58
[59] Conzelmann, Hans; Die Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 39
[60] ebenda; Seite 40
[61] Preuschen, Erwin; Griechisch - Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament; 5. Verbesserte und vermehrte Auflage; Berlin 1963; Seite 82
[62] ebenda; Seite 55
[63] Heussi, Karl; Kompendium der Kirchengeschichte; 14. Auflage; Tübingen 1976; § 10, Seite 37
[64] Harnack, Adolf von; Lehrbuch der Dogmengeschichte; Erster Band: Die Entstehung des kirchlichen Dogmas; Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage; Freiburg I. B. und Leipzig 1894; Seite 204
[65] Conzelmann, Hans/ Lindemann, Andreas; Arbeitsbuch zum Neuen Testament; Tübingen 1975; Seite 394
[66] Bultmann, Rudolf; Theologie des Neuen Testaments; 7., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage; Tübingen 1977; Seite 62
[67] Conzelmann, Hans; Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 33
[68] ebenda; Seite 34
[69] Metzger, Martin; Grundriß der Geschichte Israels; 5. Auflage ; Neukirchen - Vluyn 1979; Seite 213 f
[70] ebenda; Seite 214
[71] Pfleiderer, Otto; Die Entstehung des Christentums; Zweite, unveränderte Auflage; München 1907;Seite 120 f
[72] Bultmann, Rudolf; Theologie des Neuen Testaments; 7., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage; Tübingen 1977; Seite 46
[73] Conzelmann, Hans; Die Geschichte des Urchristentums; in: Grundrisse zum Neuen Testament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 5; Göttingen 1969; Seite 35
[74] Ökumenische Kirchengeschichte; Hg.: Kottje, Raymund/ Moeller Bernd; Band 1, Alte Kirche und Ostkirche; 2. Auflage; Mainz 1978; Seite 32
[75] Schneider, Carl; Das Christentum; in: Propyläen Weltgeschichte; Band 4: Rom; Die römische Welt; Frankfurt a. M.; Berlin 1963; Seite 442
[76] ebenda; Seite 442
[77] Bornkamm, Günther; Paulus; Zweite, durchgesehene Auflage; Stuttgart u. a. 1969; Seite 52
[78] ebenda; Seite 52
[79] Bultmann, Rudolf; Theologie des Neuen Testaments; 7., durchgesehene, um Vorwort und Nachträge erweiterte Auflage; Tübingen 1977; Seite 60
[80] Cullmann, Oscar; Petrus, Jünger - Apostel - Märtyrer: Das historische und das theologische Petrus- problem; Zürich 1952; Seite 51
[81] Calwer Bibellexikon; Schlatter, Theodor u. a. ( Hrsg. ); fünfte Bearbeitung; sechste Auflage; Stuttgart 1989; Spalte 76
[82] Cullmann, Oscar; Petrus, Jünger - Apostel - Märtyrer: Das historische und das theologische Petrus- problem; Zürich 1952; Seite 51
[83] Dibelius, Martin/ Kümmel, Werner G.; Paulus; in: Sammlung Göschen, Band 1160; vierte verbesserte Auf- lage; Berlin 1970; Seite 118 f
[84] Calwer Bibellexikon; Schlatter, Theodor u. a. ( Hrsg. ); fünfte Bearbeitung; sechste Auflage; Stuttgart 1989; Spalte 77
[85] ebenda; Spalte 77
[86] Dibelius, Martin/ Kümmel, Werner G.; Paulus; in: Sammlung Göschen, Band 1160; vierte, verbesserte Auf- lage; Berlin 1970; Seite 119
[87] Bornkamm, Günther; Paulus; Zweite, durchgesehene Auflage; Stuttgart u. a. 1969; Seite 52
[88] Conzelmann, Hans/ Lindemann, Andreas; Arbeitsbuch zum Neuen Testament; Tübingen 1975; Seite 412 f
[89] Dibelius, Martin/ Kümmel, Werner G.; Paulus; in: Sammlung Göschen, Band 1160; vierte, verbesserte Auf- lage; Berlin 1970; Seite 119
[90] ebenda; Seite 119
[91] Metzger, Martin; Grundriß der Geschichte Israels; 5. Auflage; Neukirchen - Vluyn 1979; Seite 201
[92] ebenda; Seite 201 f
[93] Der Kleine Pauly; Lexikon der Antike; Ziegler, Konrat/ Sontheimer, Walther ( Hrsg. ); Band 1: Aachen - Dichalkon; München 1979; Spalte 1107 f
[94] Metzger, Martin; Grundriß der Geschichte Israels; 5. Auflage; Neukirchen - Vluyn 1979; Seite 202
[95] ebenda; Seite 202
[96] Noth, Martin; Geschichte Israels; vierte, unveränderte Auflage; Göttingen 1959; Seite 387
[97] Metzger, Martin; Grundriß der Geschichte Israels; 5. Auflage; Neukirchen - Vluyn 1979; Seite 203
[98] ebenda; Seite 203 f
[99] Lohse, Eduard; Umwelt des Neuen Testaments; in: Grundrisse zum NeuenTestament, Das Neue Testament Deutsch, Ergänzungsreihe; Band 1; 5.,durchgesehene und ergänzte Auflage; Göttingen 1980; Seite 31 ff
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Sprachvorschau"?
Das Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt vor allem die Urgemeinde.
Was sind die Hauptthemen der Sprachvorschau?
Die Hauptthemen umfassen die Lokalisierung der Urgemeinde, die Frage, ob die Urgemeinde Urkommunismus war, die Riten, die Organisation, das Selbstverständnis und die Eschatologie der Urgemeinde, Gruppen und Strömungen innerhalb der Urgemeinde und das Ende der Urgemeinde.
Wo wird die Urgemeinde hauptsächlich lokalisiert?
Die Urgemeinde wird hauptsächlich in Jerusalem lokalisiert, obwohl es wahrscheinlich auch in Galiläa Auferstehungserscheinungen gab. Jerusalem wird als das gemeinsame, geographische Zentrum des Urchristentums angesehen.
Wird die Urgemeinde als Urkommunismus betrachtet?
Das Dokument untersucht die These, ob die Urgemeinde Urkommunismus war. Es werden Argumente dafür und dagegen diskutiert, wobei die Schlussfolgerung gezogen wird, dass der urchristliche Kommunismus nie soziale Realität war.
Welche Riten werden in der Urgemeinde praktiziert?
Die Hauptriten, die im Dokument behandelt werden, sind die Taufe, das Abendmahl/Herrenmahl und der Gottesdienst bzw. die täglichen Versammlungen. Diese Riten dokumentieren die allmähliche Trennung vom Judentum.
Wie war die Urgemeinde organisiert?
Die Organisation der Urgemeinde umfasste Apostel, Älteste (Presbyter), Diakone und die Gemeindeversammlung. Es gab auch "Geistträger" wie Apostel, Propheten und Lehrer, die für die Gesamtkirche zuständig waren.
Wie war das Selbstverständnis und die Eschatologie der Urgemeinde?
Die Urgemeinde verstand sich als das eschatologische Gottesvolk und erwartete die baldige Wiederkunft des Messias. Ihr Selbstverständnis war eng mit ihrer eschatologischen Grundhaltung verbunden.
Gab es Gruppen und Strömungen in der Urgemeinde?
Ja, es gab Differenzen zwischen traditionell gesetzestreuen, aramäisch sprechenden Christen und Hellenisten, die aus der Diaspora stammten. Diese Differenzen führten zum Apostelkonzil in Jerusalem.
Wie endete die Urgemeinde?
Das Ende der Urgemeinde wird mit der Zerstörung Jerusalems im Jüdischen Krieg und der Flucht der Gemeinde nach Pella datiert.
Welche Literatur wurde für dieses Dokument verwendet?
Das Literaturverzeichnis umfasst verschiedene theologische Werke und Bibeln, die für die Analyse und Darstellung der Informationen verwendet wurden.
- Quote paper
- Carsten Rothe (Author), 1998, Die christliche Urgemeinde, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/96034