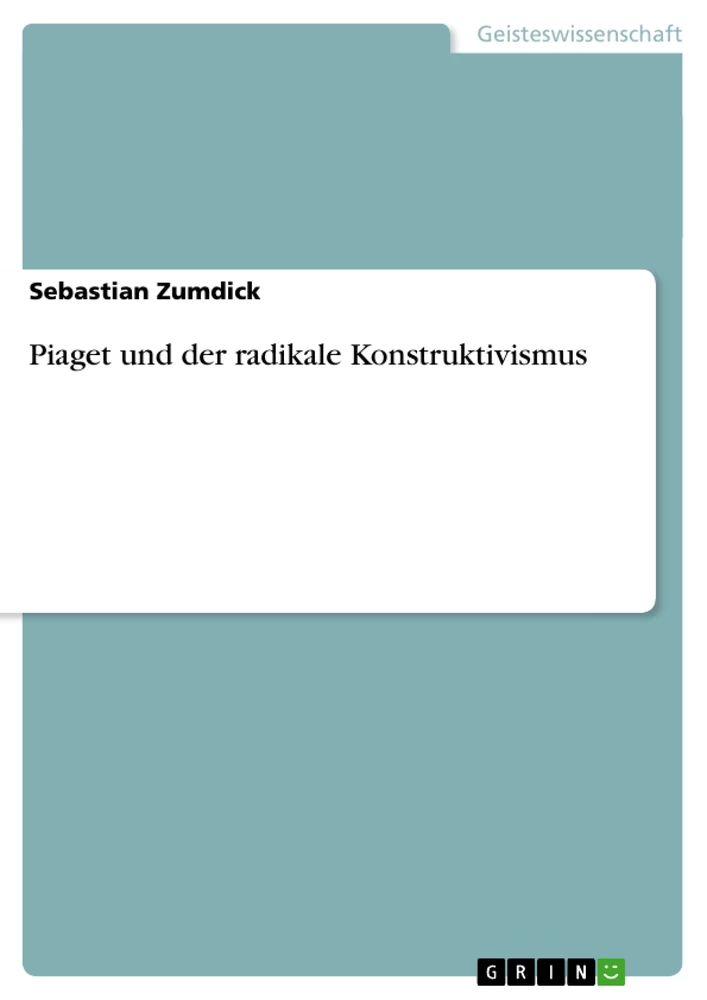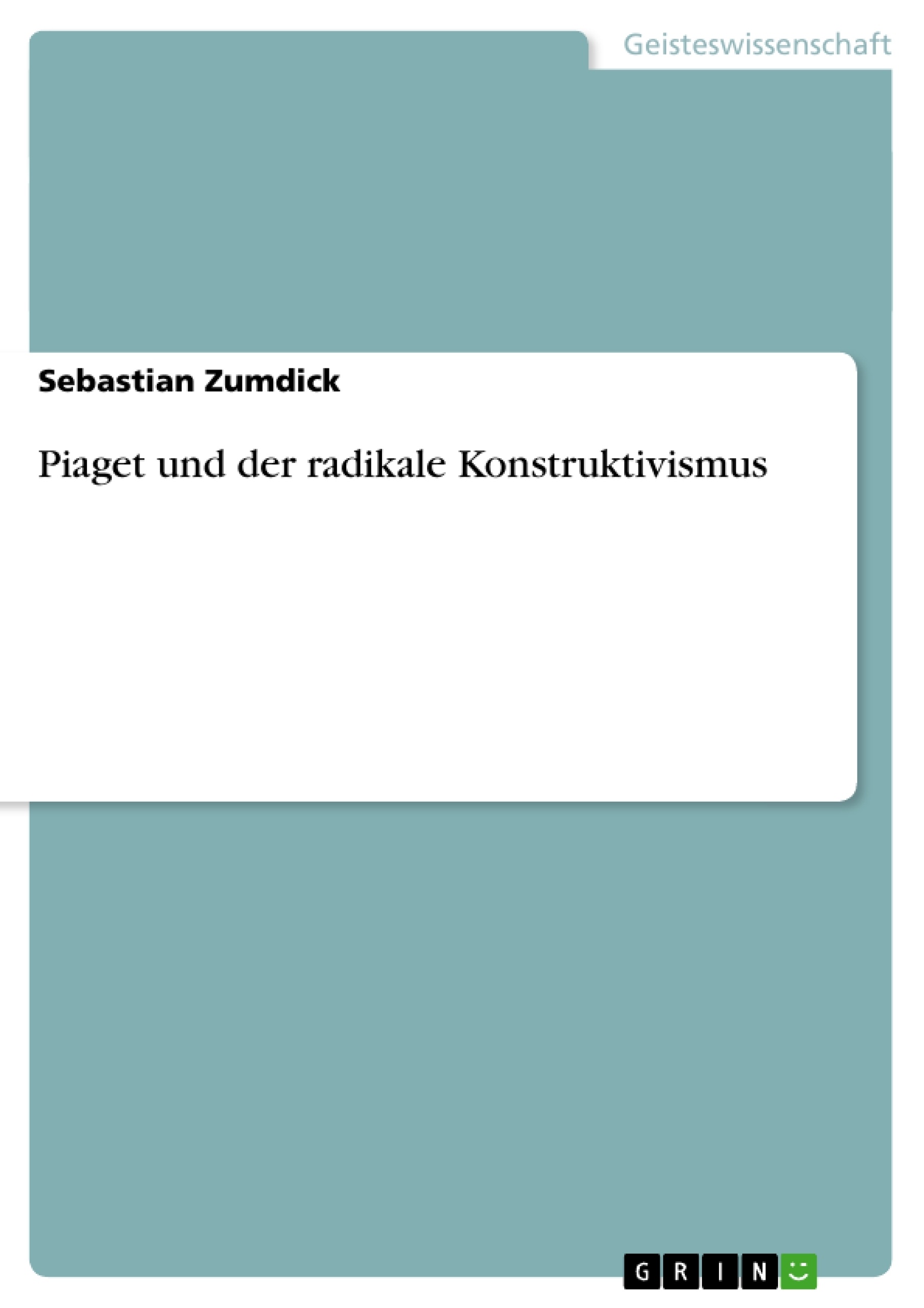In einer Welt, in der die Grenzen der Wahrnehmung verschwimmen und die Realität selbst zur Interpretation einlädt, offenbart sich eine revolutionäre Erkenntnistheorie: der Konstruktivismus. Dieses Buch entführt Sie in eine faszinierende Denkweise, die unsere tiefsten Überzeugungen über Wissen, Wahrheit und die Beschaffenheit der Welt in Frage stellt. Anstatt eine objektive Realität anzunehmen, die unabhängig von uns existiert, enthüllt der Konstruktivismus, wie jeder Einzelne seine eigene, einzigartige Wirklichkeit erschafft. Tauchen Sie ein in die Welt von Heinz von Foerster und seine kybernetischen Modelle selbstorganisierender Systeme, die das Beobachten des Beobachters in den Fokus rücken. Entdecken Sie mit Humberto R. Maturana und Francisco J. Valera die Autopoiesis, das Konzept der Selbsterzeugung, das Leben als einen sich selbst erhaltenden Prozess definiert und die Geschlossenheit lebender Systeme betont. Lernen Sie Kenneth Gergen kennen, der mit seinem sozialen Konstruktivismus die Auswirkungen der modernen Medien auf das Konzept des Selbst analysiert und die Vorstellung einer einheitlichen Persönlichkeit durch eine Vielzahl von Identitäten ersetzt. Erkunden Sie mit Ernst von Glasersfeld den radikalen Konstruktivismus, der die Viabilität in den Mittelpunkt stellt und die Anpassung an die Umwelt nicht als Übereinstimmung mit einer objektiven Realität, sondern als ein passendes Überleben interpretiert. Lassen Sie sich von Piagets genetischer Epistemologie inspirieren, die eine stufenweise artikulierte Wirklichkeit postuliert und die Bedeutung von Akkomodation und Assimilation für die Schaffung einer stabilen Erfahrungswelt hervorhebt. Dieses Buch ist eine Einladung, die eigenen Denkmuster zu hinterfragen, neue Perspektiven zu gewinnen und die unendlichen Möglichkeiten der Wirklichkeitskonstruktion zu erkennen. Es ist eine Reise in die Tiefen des menschlichen Geistes, die unser Verständnis von Wissen, Lernen und der Welt, die wir bewohnen, für immer verändern wird. Wagen Sie den Schritt in eine Welt, in der die Realität nicht gegeben, sondern erschaffen wird. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Psychologie, Philosophie, Erkenntnistheorie und die Konstruktion von Wissen interessieren. Es bietet neue Impulse für die Reflexion über epistemologische Positionen, die Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Patient und Therapeut, die Befreiung von Zwängen durch die Darstellung einer Vielzahl von Möglichkeitsräumen und die Aufstellung neuer ethischer Grundsätze.
I Einführung in den Konstruktivismus
Der Versuch den Begriff des Konstruktivismus zu definieren, steht meiner Meinung nach auf wackligen Beinen. Zum einen besteht die Gefahr, daß eine kurze bündige Definition dem Zuhörer nahelegt, sich diese zu merken und dann alles schnell wieder zu vergessen. Außerdem begrenzt jede Definition das Thema; sie verschließt sich gegen andere Sichtweisen und Akzentuierungen; dadurch verneint sie jede andere Definition. Dabei liegt es gerade dem Konstruktivismus nahe, stetig eine Vielzahl von Möglichkeiten und Sichtweisen vor Augen zu haben.
Am besten kann der Konstruktivismus vielleicht als eine Epistemologie (Erkenntnistheorie) verstanden werden (siehe Kasten). Es rücken die verschiedenen Mechanismen der Welterzeugung in den Vordergrund.
Das Verhältnis der Konstruktivisten zur Realität kann durch provokante Äußerungen (Die Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung) oder Buchtitel dargestellt werden: ,,Das Konstruieren einer Realität", ,,Von den Fanatikern der Wahrheit und den Tänzern mit der Welt" oder auch ,,Die erfundene Wirklichkeit".
Ein gemeinsamer Nenner aller Strömungen des Konstruktivismus ist die Ablehnung einer objektiven, vom Menschen unabhängigen Realität. Vielmehr wird davon ausgegangen, daß jeder Mensch sich seine eigene Umwelt erschafft. Die Welt wird durch den Gebrauch der Sinnesorgane erst ersonnen. Die Wirklichkeit ist also nicht einfach schon da, sondern wird vom Menschen konstruiert.
Dies wird zum einen durch die organisierende Tätigkeit des Gehirns begründet. Ein jeglicher Zustand der Umwelt (Musik, Sehreize etc.) besteht auf einem bestimmten Niveau der Übertragung im Gehirn lediglich aus dem Feuern der Neuronen. Das daraus sich ein derart komplexes Bild zusammenfügt, ist somit eine Leistung des Gehirns. Es wird also nicht davon ausgegangen, daß das Gehirn durch komplexe Prozesse die Realität abbildet, sondern erst durch seine eigene Funktionsweise erschafft. Die Farben, die wir sehen sind nicht bereits in der Umwelt enthalten, sie werden durch uns geschaffen; sie entstehen nicht im Auge als Abbild, sondern im Gehirn als Konstruktion. Diese ordnungschaffende Aktivität ist auch durch andere Experimente bewiesen (Blinder Fleck, order from noise - principle etc .)
Ein anderer Ansatzpunkt des Konstruktivismus ist die philosophische Schule des skeptischen Denkens. Dieser Denkrichtung zufolge ist an jeglicher Authentizität der Sinneswahrnehmungen zu zweifeln, da ihre ,,Echtheit" an nichts anderem bewiesen werden kann (außer an anderen Sinneswahrnehmungen).
Auch der Philosoph Ludwig Wittgenstein legt mit seinen sprachphilosophischen Untersuchungen ein Grundstein für den Konstruktivismus. Mit dem Aphorismus ,,Die Grenzen der Sprache...bedeuten die Grenzen meiner Welt" stellt er prägnant dar, wie die Sprache unsere Welt begrenzt und formt.
Ausgehend von dieser kurzen subjektiven Erläuterung einiger Grundgedanken des Konstruktivismus möchte ich nun kurz einige Vertreter der Schule des Konstruktivismus vorstellen, um die Spannbreite diese Feldes darzustellen und deutlich zu machen, daß der Konstruktivismus ein interdisziplinärer Forschungsansatz ist.
1) Heinz von Foerster
Der 1911 in Wien geborene Physiker macht durch sein Lebenswerk deutlich, daß der radikale Konstruktivismus unter anderem aus dem Geiste der Kybernetik hervorgegangen ist. Die Kybernetik (kybernetes = griech.: Steuermann) beschäftigt sich mit der Regelung und mit den Nachrichten-übertragungen im Lebewesen und der Maschine. Als einfachstes Beispiel für die kybernetische Steuerung einer Maschine mag das Thermostat in einer Wohnung gelten. Es besteht aus 3 verschiedenen Einheiten: einer Sensor - Einheit; einer Komparator - Einheit und einer Effektor - Einheit. Fällt die Temperatur in der Wohnung, so wird dies vom Sensor bemerkt und weitergeleitet, die Vergleichseinheit registriert den Unterschied zwischen tatsächlicher Temperatur und dem zuvor eingestellten Soll - Wert. Somit wird ein Befehl an die Effektor - Einheit gegeben, die Heizung anzustellen. Dies ist dann ein Kreislauf, da die Heizung auch wieder abgestellt wird, wenn es wieder zu warm ist. Heinz von Foerster benutzt nun diese kybernetischen Terminologien, um aufzuzeigen, daß Lebewesen sich selbst organisierende Einheiten sind. Diese Art der Kybernetik wird im allgemeinen als Kybernetik 1. Ordnung bezeichnet. Darüber hinaus existiert auch eine Kybernetik der Kybernetik, die Kybernetik 2. Ordnung. In ihr geht es um die Frage wie das Beobachten von Beobachtern stattfindet. Als Beispiel hierfür gilt das Experiment des blinden Flecks. Hier beobachtet man sich selbst, wie man etwas beobachtet. Als Ergebnis ist zu nennen, daß wir nicht sehen, was wir nicht sehen.
2) Humberto R. Maturana & Francisco J. Valera
Diese beiden Biologen gelten als Hauptvertreter der ,,Chilenischen Schule und mit ihren neuro-physiologisch orientierten Arbeiten zum Thema ,,Was ist Leben?" bilden sie einen naturwissenschaftlichen Ansatz zum Konstruktivismus. Als Antwort auf diese Frage erschufen sie das Kunstwort ,,Autopoieisis". Dieses Wort setzt sich aus den beiden Wörtern ,,autos" (selbst) und ,,poiein" (machen) zusammen und bedeutet soviel wie Selbsterzeugung. Leben wird also definiert, als ein sich selbst aufrechterhaltender Prozeß. Dieses Konzept kann vielleicht mit einem Beispiel aus der Biologie erläutert werden. Die Zelle ist durch die Zellwand von der Umgebung getrennt und durch die Zellwand ist erst klar, wo Zelle anfängt und Umgebung aufhört. Innerhalb der Zellwände ist es der Zelle möglich Moleküle zu produzieren. Die produzierten Moleküle sind aber wiederum Grundlage für die Aufrechterhaltung der Zellwände. So gesehen ist die Zelle ein autopoietisches System, da sie die Komponenten erzeugt, die sie zur Aufrechterhaltung der Organisation benötigt. Maturana und Valera sprechen hier weiterhin von der Geschlossenheit solcher Systeme. Da sie die Produkte ihrer Operationen als Grundlage für weitere Operationen verwenden, spricht man hier von Rekursivität.
Die Geschlossenheit kann auch noch auf den Kontakt mit der Umwelt bezogen werden. Maturana und Valera kreierten das Wort ,,Pertubation" (von pertubare = stören, verwirren). Ihnen zufolge kann das Nervensystem, von der Umwelt lediglich pertubiert werden. Ein neuronaler Zustand kann auch als ein Produkt des vorhergegangenen neuronalen Zustands aufgefaßt werden. Somit wird das Nervensystem von der Umwelt nicht determiniert und instruiert, das heißt es leistet kein Abbild der Umwelt, sondern es konstruiert mit Hilfe seiner eigenen Operationen ein eigenes Bild der umgebenden Umwelt. Wahrnehmung wird also aufgefaßt als eine systeminternen Konstruktion einer systemexternen Umwelt und nicht als eine Widerspiegelung der äußeren Welt.
3) Kenneth Gergen
Gergen steht in dieser Auswahl als Vertreter für den ,,sozialen Konstruktivismus" . Ausgehend von der Theorie, daß der Mensch durch die modernen Medien einer überwältigenden Vielzahl von Beziehungen, Gedanken und Meinungen ausgesetzt ist, nähert sich Kenneth Gergen in seinem Buch ,,Das übersättigte Selbst" grundlegenden Auswirkungen dieser Entwicklungen auf das Konzept des Selbst. Dabei wird das einheitliche Persönlichkeitskonzept in Frage gestellt und durch eine Collage aus Beziehungen und Teil - Identitäten ersetzt. Gergen verbindet diesen Wandel des Persönlichkeitskonzepts mit dem Wandel der Moderne zur Postmoderne. Während in der Moderne das Selbst als ein rationaler, das Handeln bestimmender, fester Kern betrachtet wurde, wird dies in der Postmoderne durch eine Selbst abgelöst, welches von unzähligen, unter Umständen auch widersprüchlichen, Identitäten bevölkert ist.
Konstruktivistisch an dieser Position ist m. E., daß hier davon Abstand genommen wird, das Selbst als einen objektiven und existierenden, rationalen Block zu beschreiben. Des weiteren werden auch aus konstruktivistischer Sicht überholte Begriffe, wie Wahrheit, Rationalität oder Fortschritt erfolgreich demontiert und in einen postmodernen Kontext eingegliedert.
4) Ernst von Glaserfeld
Ernst von Glaserfeld lernte schon als Kind mehrere Sprachen und somit war ihm die Möglichkeit gegeben, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Vielleicht ist durch diesen Umstand auch Glaserfelds Interesse für linguistische und semantische Problemstellungen geweckt worden. Glaserfeld mag in dieser beschränkten Auswahl als ein Vertreter des ,,radikalen Konstruiktivismus" gelten. Glaserfeld gelang es außerdem, unter Zuhilfenahme kybernetischer Begrifflichkeiten Piagets genetische Epistemologie als eine konstruktivistische Lerntheorie zu interpretieren. Außerdem thematisiert er in seinen Werken den Begriff der Viabilität. In traditioneller Auffassung gelingt es im Laufe der Evolution einigen Tieren sich der Umwelt anzupassen und zu überleben und anderen Tieren nicht (Dinosaurier). Glaserfeld versucht hier zwischen zwei Wörtern zu trennen: ,,to match = übereinstimmen" und ,,to fit = passen". Nach Glaserfelds Auffassung ist die Anpassung der Lebewesen an ihre Umwelt keine Übereinstimmung einer objektiven Wirklichkeit mit den einzelnen Lebewesen. Vielmehr ist sie lediglich passend, das heißt dem Lebewesen gelingt es zu existieren und nicht ausgelöscht zu werden. Dies liefert jedoch keinen Anhaltspunkt über die wahren Gegebenheiten der Natur. Das Lebewesen ist lediglich ,,viabel". Um dies zu veranschaulichen kann man die Fahrt eines Bootes durch eine Meerenge im Nebel betrachten. Der Steuermann kann zwar das Boot durch bestimmte Manöver erfolgreich durch die Meerenge lenken, er wird jedoch nie seine Bewegungen als wahr oder den einzig richtigen Weg interpretieren können. Sein Kurs war entweder viabel oder nicht. Ebenso wird er nie über die Positionen der einzelnen Sandbänke etc. Aussagen treffen können.
Ausgehend von dieser zu kurzen subjektiven Darstellung weniger Vertreter des Konstruktivismus ist nun zu überlegen, welche Bedeutung der Konstruktivismus für die Psychologie haben könnte:
- Psychologen fabrizieren durch ihre Untersuchung Wahrheit
- Psychologen entscheiden im klinischen Bereich über Patienten, anhand objektiver und rationaler Grundlagen, darüber ob ein Patient als gesund oder krank eingestuft wird.
- Reflexionen über epistemologische Positionen der Psychologie
- Das Verhältnis von Patient und Therapeuten kann neu überdacht werden
- Befreiung von Zwängen durch die Darstellung einer Vielzahl von Möglichkeitsräumen
- Neue Impulse durch den interdisziplinären Ansatz des Konstruktivismus
- Ethische Grundsätze werden neu aufgestellt: Handle stets so, daß weitere Möglichkeiten entstehen!
II Piagets Konstruktivismus
- eine Interpretation -
Zu Beginn bezeichnet Ernst von Glaserfeld einige Einschränkungen, die diese Interpretation erschweren.
1) Piaget hat in seiner 60jährigen regen Publikationstätigkeit einen unüberschaubaren und sich im Laufe der Zeit verändernden Wust an Veröffentlichungen geschaffen.
2) Piaget drückt sich oftmals in einer nicht ganz klaren Sprache aus, er benutzt Begriffe oft in verschiedenen Zusammenhängen; dabei versetzt er sich nicht in den Leser hinein, durch seine Bemühungen Gedanken genau auf den Punkt zu bringen verliert sein Werk an Lesbarkeit.
Was trotz all dieser Probleme möglich bleibt ist der Versuch einer Interpretation von Piaget. Dies liegt wiederum im Sinne eines Konstruktivisten, da ich nicht exakt die Gedanken eines anderen wiedergeben kann, sondern lediglich meine Einschätzung seiner Gedanken. Ebenfalls konstruktivistisch bleibt daran, daß ich mit diesem Versuch den Zuhörern lediglich einen Vorschlag machen möchte, sich zumindest ein Teil dieser Gedanken anzueignen. Wissen ist demnach nicht ein Gut, daß sich in fremde Köpfe eintrichtern läßt, sondern ein Angebot.
,,Líntelligence organise le monde en s `organisant elle-meme"
,,Intelligenz ... organisiert die Welt, indem sie sich selbst organisiert"
(Piaget 1937, La construction du reel chez lénfant / Die Konstruktion der Wirklichkeit des Kindes)
I Konstruktion der Erkenntnis
Piaget ist der Ansicht, daß alles Wissen auf Organisation beruht, und die Art der Organisation ist seiner Meinung nach bedingt durch zielstrebiges Handeln. Piaget verbindet Wissen und Handeln unter anderem durch den Begriff des Handlungsschemas.
Glaserfeld ist der Auffassung ,daß dies ein Begriff ist, der ziemlich häufig mißverstanden worden ist. Ursprünglich leitete Piaget diesen Begriff von dem biologischen Begriff des Reflexes ab. Dieser Umstand und weitere subtile Umdeutungen machten es möglich Piagets als interaktionistisch zu betrachten. Und diese Umdeutung macht es möglich von einer allgemeinen, wirklichen Umwelt auszugehen, mit der der Organismus interagieren kann. Auf der kognitiven Ebene bedeutet der Begriff des Handlungsschemas, daß eine Interaktion dem Organismus Wissen geben könnte, so daß letztendlich eine optimale Annäherung an ein objektives Wissen erreicht werden kann.
Dieses Mißverständnis wird durch Piagets häufigen Gebrauch des Wortes ,,Anpassung" noch unterstützt. Wie weiter oben dargestellt bedeutet bei Ernst von Glaserfeld ,,Anpassen" keineswegs das Angleichen an eine objektive Wirklichkeit. Er deutet Piaget so, daß die Konstruktion des Verstehens immer nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Gegenstand diese Konstruktion zuläßt. Also ist hier die Abkehr von einer objektiven Wirklichkeit zu erkennen und weiterhin wird von einem veränderten Umgang mit der Wirklichkeit (konstruieren statt erkennen) gesprochen.
Der veränderten Umgang des Organismus mit der Wirklichkeit wird von Glaserfeld weiter ausgebaut, indem er den Organismus mit einem selbstregulierenden System vergleicht. Dem Organismus stehen mit der Assimilation und der Akkomodation zwei Möglichkeiten offen, seinen eigenen Zustand zu organisieren. Diese beiden Mechanismen treten immer dann auf, wenn es zu einer Störung des Gleichgewichts beim Organismus kommt (so z. b. Nicht - passen einer Begriffsbezeichnung, Nicht - erreichung eines Zielzustandes) Um diesen Vergleich von den ,,Stimulus - Response" Ketten der Behavioristen abzugrenzen, weist von Glaserfeld auf die Zielgerichtetheit der Aktionsschemata hin. Die Handlungen haben jeweils ein Ziel und sind somit von bloßen Reaktionen verschieden. Somit wird deutlich, daß nach Glaserfelds Meinung die ontische Realität nicht mit Hilfe der Sinnesorgane oder mit Hilfe eines Aktionschematas erfaßt werden kann. Aktionschemata und Ähnliches treten nur bei Versagen mit der Wirklichkeit in direkten Kontakt. Sie werden auf Grund ihres Erfolgs bewertet und dieser Erfolg kann letztendlich nur aus einem Passen bestehen.
II Konstruktion der Wirklichkeit
Statt einer Wirklichkeit, die für sich selbst und unabhängig vom erlebenden Organismus ,,existiert", postuliert Piagets genetische Epistemologie eine stufenweise artikulierte Wirklichkeit. Dank Akkomodation und Assimilation wird es dem Organismus ermöglicht, sich auf eine so geschaffene invariante Umwelt zu beziehen. Über diese gebildeten Strukturen sind nun wiederum Vorhersagen zu treffen und ermöglichen dem Organismus sein Gleichgewicht zu bewahren. Durch Einführung dieses Systems ist Piaget in der Lage zu Erklären, wie ein Lebewesen eine stabile Erfahrungswelt schafft, selbst wenn sich die ontische Erfahrungswelt in einem Fluß dauernder Veränderung befindet. Akkomodation und Assimilation sind in ihrer Funktion als zwei verschiedenen Elemente des selben Systems zu begreifen. Sie gewährleisten laut Piaget die ,,Nachkonstruktion der Wirklichkeit in der strukturellen Organisation des tätigen Organismus". In ihrer Form jedoch sind sie gegenläufig: Die Richtung der Assimilation zielt auf das Objekt, die der Akkomodation auf die Struktur selber. Dennoch ergänzen sie sich, das eine kann ohne das andere nicht stattfinden. Die Assimilation besitzt einen verallgemeinernden Effekt, da sie dem Subjekt zielgerichtetes Handeln auch dann ermöglicht, wenn die Situation in der das Kind in einer bestimmten Weise gehandelt hat in leicht veränderter Form wieder auftauchen. Hier werden also geringfügige Unterschiede übersehen um eine andauernde kognitive Struktur zu schaffen. Konstruktivistisch an dem Assimilationsvorgang ist nun, daß ein Subjekt (Kind) die Eigenschaften eines Gegenstandes nicht abliest, sondern an ihn heranträgt. Der Erkennende wendet seine Assimilationschemata auf bestimmte Gegenstände an und erkennt sie erst dann. Erkenntnis bleibt dann auch in diesem Rahmen begrenzt. Das Kind das den invarianten (unveränderlichen) Mengenbegriff noch nicht kennengelernt hat, kann nicht entscheiden oder erkennen, ob die Menge Saft die gleiche geblieben ist, nachdem man sie in ein schmaleres Glas geschüttet hat. Es kann erst dann zur Erkenntnis gelangen, wenn z.B. der Mengenbegriff in sein eigenes Verständnis eingebaut wurde.
Der Akkomodationsvorgang läßt sich konstruktivistisch betrachten und mit dem Begriff der Viabilität in Verbindung setzen. Zu einer Akkomodation kommt es immer dann, wenn es zu einer Störungen in den Handlungschemata kommt. Diese Störung führt dann zu einer Abänderung (entweder Beschränkung eines alten oder Hinzunahme/Erweiterung eines neuen Schemas) des alten Schemas, so daß ein neues Handlungschema entsteht. Hier kommt es somit zu einer Änderung der Handlungschemata in Richtung einer größeren Viabilität des Organismus. Wichtig hieran ist zu bemerken, daß mit dem Begriff des Handlungschemas keine Abbildung der Wirklichkeit gemeint ist. Wenn ein Handlungschema erfolgreich ist (Öffnen einer Tür mit einem Schlüssel), heißt dies noch nicht, daß dieses Handlungschema das einzige oder das "richtige / wirkliche" ist.
III Begriffe der Wahrheit und Objektivität
Piaget unterscheidet zwischen Wahrheit und Weisheit. Weisheit ist der koordinierte Vergleich von kognitiven Elementen zwischen mehreren Menschen, Piaget hält diese Weisheiten für vielfältig. Wahrheit hingegen ist jedoch streng betrachtet nur eine einzige Meinung, die ultimativen Charakter hat. Piaget verbindet wiederum den Begriff der Viabiltiät mit der Wahrheit. Ein Theorie kann sich demnach nur als wahr erweisen, da sie bisher nicht als unwahr erwiesen worden ist. Niemals kann sie Anspruch auf absolute Gültigkeit erheben, da sie nur begrenzten Ausblick in die ontische Realität geben kann. Dies erinnert stark an die These von Popper, nach der eine Theorie niemals verifiziert werden kann. Theorien können nur falsifiziert werden, d.h. ich kann nur sagen wann eine Theorie nicht die Wirklichkeit widerspiegelt.
Außerdem versucht Glaserfeld aufzuzeigen, daß Wahrheit nur in einem Moment der Reflexion entstehen kann. Ein Handlung erfüllt ihr Ziel, oder tut es nicht. Glaserfeld geht davon aus, daß es ab einer Reflexion möglich ist zwei Stufen der Wahrheit zu trennen. Vor der Reflexion gibt es lediglich die Wahrheit des Wiedererkennens. Ein Gegenstand wird als gleich wahrgenommen, sei dies durch tatsächliche Übereinstimmung oder Assimilation. Sobald der Organismus fähig ist zu reflektieren, ist es ihm möglich, ein Objekt unabhängig von seinem jeweils assimilierten Handlungsmotiv zu benutzen. So kann ich aus Mangel an geeignetem Werkzeug einen Schuh dazu benutzen, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Dies bedeutet nicht, daß ich ihn mit einem Hammer verwechsle, sondern, daß ich mit der neu gegebenen Möglichkeit der Reflexion den Schuh in einem Handlungschema benutze, ohne ihn in dieses Schema zu assimilieren. Auf diesem erweiterten Niveau bedeutet Wahrheit also, daß Gegenstände und Ereignisse in festgelegte Strukturen passen, ohne daß wir sie absichtlich assimilieren.
IV Zusammenfassung
Glaserfeld merkt an, daß Piaget einen wichtigen Beitrag zum Umgang mit Begriffen wie Wahrheit und Objektivität geleistet hat. Piaget hat es seiner Meinung nach geschafft die Welt des Erlebenden von einer Welt des Übersubjekts, oder einer Gottperspektive zu trennen. Dadurch, daß er aufzeigt, wie das Kind die Welt auf seine Weise aufnimmt kehrt er einer a priori festgelegten Welt, die es zu erkennen gibt, den Rücken. Seine Analyse beschäftigt sich nicht dem sensomotorischen Inhalt des Denkens, sondern mit der Struktur. Es wird also ein Modell des Wissenden gesucht und nicht ein Modell des Seins. Dies macht Piaget zu einem Epistemologen; daß er darüber hinaus noch sich von einer zu erkennenden Umwelt abwendet und er verstärkt die Konstruktion der Umwelt in den Vordergrund rückt, dies läßt eine Bezeichnung als Konstruktivist durchaus zu. Glaserfeld ist der Meinung, daß Piagets umfangreiches Werk sich nur vor einem konstruktivistischem Hintergrund kohärent verbinden läßt.
Zusammenfassend möchte ich nun ein längeres Zitat aus einem anderen Aufsatz Glaserfelds zitieren:
,,Die radikal konstruktivistische Interpretation der genetischen Epistemologie Piagets lautet daher folgendermaßen: Die Vorstellung, die ein Organismus sich von der Umwelt macht, das heißt dessen Wissen von der Welt, ist in jedem Falle das Ergebnis seiner kognitiven Tätigkeit. Das Rohmaterial seiner Konstruktionen sind ,,Sinnesdaten", und damit meint der Konstruktivist ,,Partikel der Erfahrung", also Elemente, die keinerlei spezifische ,,Interaktionen" oder Verursachungen auf seiten einer bereits strukturierten ,,Realität" jenseits der Erfahrungschnittstelle des Organismus voraussetzen. Diese ,,Schnittstelle" entspringt als kognitives Konstrukt der Externalisierung der Konstrukte des Organismus, einer Operation, die konkret an jedem bewußtem selbst- oder erfahrungsbezogenen Akt beteiligt ist. Auch wenn Externalisierung ein notwendige Bedingung für das ist, was wir ,,Realität" nennen, ist diese Realität dennoch gänzlich unser eigenes Konstrukt und darf in keinem Sinne als Widerspiegelung oder Abbildung der von den Philosophen sogenannten ,,objektiven" Realität angesehen werden, denn kein Organismus kann kognitiven Zugang zu Strukturen haben, die nicht von ihm selbst gemacht sind." (aus (1), S.111-S.112)
Die Zeit wird zeigen, inwieweit Piagets Theorien sich in Zukunft als viabel erweisen werden; seine Theorie behauptet jedenfalls nicht von sich (hier auf sich selbst angewandt) eine Realität abzubilden.
V Literatur
Als Einführung zum Konstruktivismus zu lesen: Die erfundene Wirklichkeit -Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? -Beiträge zum Konstruktivismus, Paul Watzlawick, 1998 Piper Verlag GmbH, München
Zu Piaget und dem Konstruktivismus: (1)Wissen, Sprache und Wirklichkeit - Arbeiten zum radikalen Konstruktivismus, Ernst von Glaserfeld, 1987 Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig
Häufig gestellte Fragen
Was ist Konstruktivismus laut diesem Text?
Der Konstruktivismus wird als eine Epistemologie (Erkenntnistheorie) verstanden, die die verschiedenen Mechanismen der Welterzeugung in den Vordergrund rückt. Er lehnt eine objektive, vom Menschen unabhängige Realität ab und geht davon aus, dass jeder Mensch sich seine eigene Umwelt erschafft. Die Wirklichkeit wird also vom Menschen konstruiert.
Welche Vertreter des Konstruktivismus werden im Text vorgestellt?
Der Text stellt folgende Vertreter des Konstruktivismus vor:
- Heinz von Foerster: Betont die Kybernetik und die Selbstorganisation von Lebewesen.
- Humberto R. Maturana & Francisco J. Valera: Entwickelten das Konzept der "Autopoiesis" (Selbsterzeugung) zur Definition von Leben.
- Kenneth Gergen: Vertreter des "sozialen Konstruktivismus", der das einheitliche Persönlichkeitskonzept in Frage stellt.
- Ernst von Glaserfeld: Vertreter des "radikalen Konstruktivismus", der sich mit Viabilität und linguistischen Problemstellungen auseinandersetzt.
Was ist "Autopoiesis" nach Maturana und Valera?
"Autopoiesis" bedeutet Selbsterzeugung und beschreibt Leben als einen sich selbst aufrechterhaltenden Prozess. Ein System ist autopoietisch, wenn es die Komponenten erzeugt, die es zur Aufrechterhaltung der Organisation benötigt.
Was versteht man unter Kybernetik 1. und 2. Ordnung?
Die Kybernetik 1. Ordnung beschäftigt sich mit der Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschinen. Die Kybernetik 2. Ordnung ist eine Kybernetik der Kybernetik, die sich mit dem Beobachten von Beobachtern befasst.
Was ist Gergens Ansatz zum sozialen Konstruktivismus?
Gergen argumentiert, dass die moderne Medienlandschaft den Menschen einer Vielzahl von Beziehungen, Gedanken und Meinungen aussetzt, was das einheitliche Persönlichkeitskonzept in Frage stellt und durch eine Collage aus Beziehungen und Teilidentitäten ersetzt.
Was bedeutet "Viabilität" nach Glaserfeld?
"Viabilität" bedeutet, dass ein Lebewesen oder eine Theorie überlebensfähig ist, ohne unbedingt die objektive Realität widerzuspiegeln. Es geht um das "Passen" und nicht um die "Übereinstimmung" mit einer objektiven Wirklichkeit.
Welche Bedeutung könnte der Konstruktivismus für die Psychologie haben?
Der Konstruktivismus könnte in der Psychologie zu folgenden Überlegungen anregen:
- Reflexionen über epistemologische Positionen der Psychologie.
- Neubetrachtung des Verhältnisses von Patient und Therapeut.
- Befreiung von Zwängen durch die Darstellung einer Vielzahl von Möglichkeitsräumen.
- Neue Impulse durch den interdisziplinären Ansatz des Konstruktivismus.
Welche Einschränkungen sieht Glaserfeld bei der Interpretation von Piagets Werk?
Glaserfeld merkt an, dass Piagets umfangreiches und sich im Laufe der Zeit veränderndes Werk unübersichtlich ist und dass Piaget sich oft in einer nicht ganz klaren Sprache ausdrückt.
Wie interpretiert Glaserfeld Piagets Begriff des Handlungsschemas?
Glaserfeld interpretiert Piagets Begriff des Handlungsschemas so, dass die Konstruktion des Verstehens immer nur dann erfolgreich sein kann, wenn der Gegenstand diese Konstruktion zulässt. Er betont die Abkehr von einer objektiven Wirklichkeit und den veränderten Umgang mit der Wirklichkeit (konstruieren statt erkennen).
Was sind Assimilation und Akkomodation nach Piaget und wie werden sie konstruktivistisch interpretiert?
Assimilation ist die Integration neuer Erfahrungen in bestehende kognitive Strukturen, während Akkomodation die Anpassung der kognitiven Strukturen an neue Erfahrungen ist. Konstruktivistisch betrachtet trägt das Subjekt (Kind) Eigenschaften an einen Gegenstand heran und erkennt ihn erst dann (Assimilation). Akkomodation wird mit Viabilität in Verbindung gesetzt, indem sie die Handlungsschemata in Richtung einer größeren Viabilität des Organismus verändert.
Wie unterscheidet Piaget zwischen Wahrheit und Weisheit?
Piaget unterscheidet zwischen Wahrheit als einer einzigen Meinung mit ultimativem Charakter und Weisheit als dem koordinierten Vergleich von kognitiven Elementen zwischen mehreren Menschen. Wahrheit ist demnach viabel, da sie sich als bisher nicht unwahr erwiesen hat.
Welche Literatur wird im Text empfohlen?
Es werden folgende Bücher empfohlen:
- Die erfundene Wirklichkeit -Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? -Beiträge zum Konstruktivismus von Paul Watzlawick
- Wissen, Sprache und Wirklichkeit - Arbeiten zum radikalen Konstruktivismus von Ernst von Glaserfeld
- Arbeit zitieren
- Sebastian Zumdick (Autor:in), 1999, Piaget und der radikale Konstruktivismus, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95932