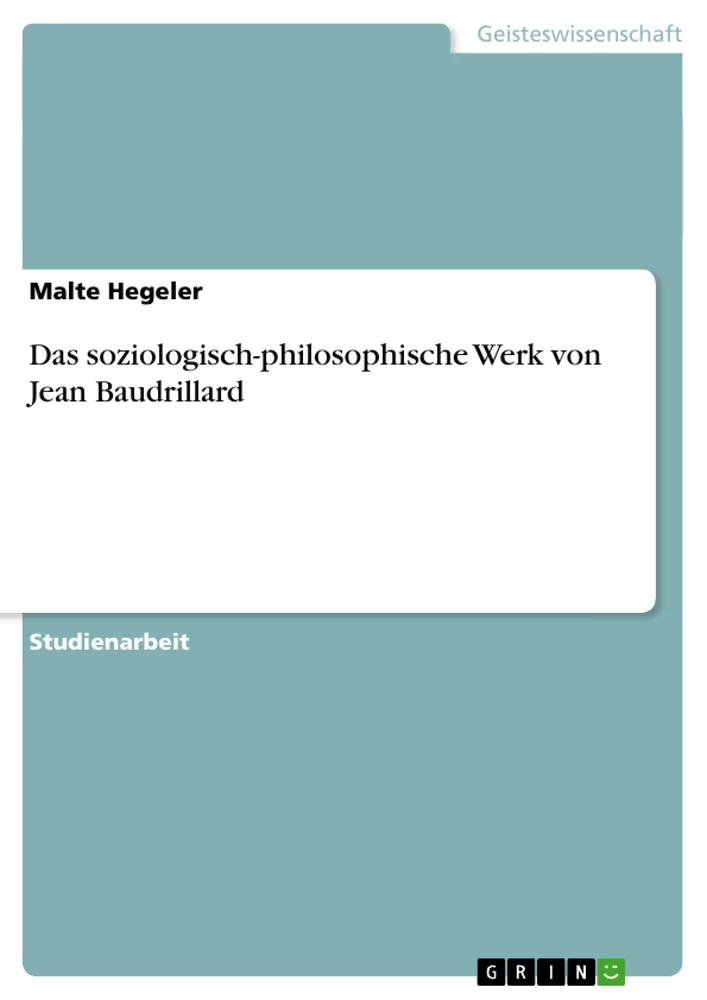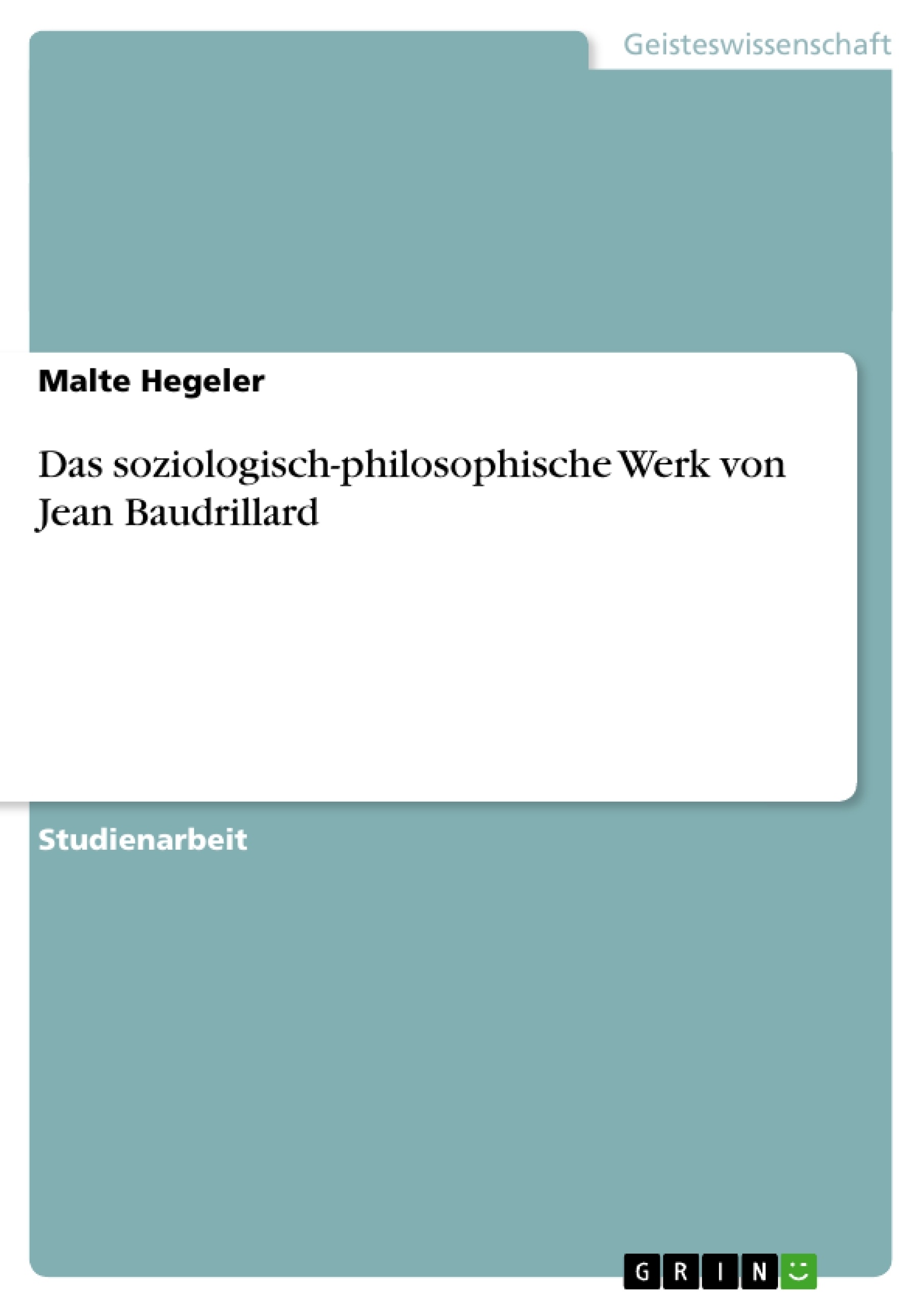In einer Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Simulation verschwimmen, entführt uns dieses Buch in die intrigenreiche Gedankenwelt von Jean Baudrillard, einem der provokantesten und einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Wir begeben uns auf eine fesselnde Reise durch die drei Ordnungen der Simulakren – von der Renaissance-Imitation über die industrielle Produktion bis hin zur alles durchdringenden Simulation unserer heutigen Zeit. Baudrillards These der Hyperrealität, in der Zeichen nicht mehr auf eine Realität verweisen, sondern lediglich auf sich selbst, wird anhand von Beispielen aus Medien, Politik, Musik und Konsum eindrücklich veranschaulicht. Kritisch hinterfragt das Buch die Macht der Bilder, die Auflösung des Individuums in der Massenkultur und die scheinbare Endlosigkeit der Geschichte im Zeitalter des Recyclings. Dabei werden Bezüge zur Popkultur, zu Philosophen wie Vilem Flusser und zu aktuellen Ereignissen wie dem Schulmassaker von Littleton gezogen, um die Relevanz von Baudrillards Überlegungen für unser Verständnis der modernen Gesellschaft zu verdeutlichen. Eine tiefgreifende Analyse, die nicht nur Baudrillards Kernthesen prägnant darstellt, sondern auch zur Reflexion über unsere eigene Rolle in einer zunehmend virtuellen und entfremdeten Welt anregt. Ob im Fernsehen, in der Werbung oder in der Politik – die Mechanismen der Simulation prägen unseren Alltag. Dieses Buch bietet eine essentielle Orientierungshilfe, um die verführerischen Illusionen der Hyperrealität zu durchschauen und die Frage nach der Authentizität in einer Welt der künstlichen Realitäten neu zu stellen. Es ist eine Einladung, die Welt mit neuen Augen zu sehen und die subtilen Kräfte zu erkennen, die unser Denken und Handeln bestimmen. Tauchen Sie ein in eine faszinierende Auseinandersetzung mit der Postmoderne, die Ihr Weltbild nachhaltig verändern wird. Entdecken Sie die brisante Aktualität von Baudrillards Thesen und stellen Sie sich den Herausforderungen einer Gesellschaft, in der die Realität oft nur noch eine blasse Kopie ihrer selbst ist. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die sich mit den drängenden Fragen unserer Zeit auseinandersetzen und die komplexen Zusammenhänge zwischen Medien, Kultur und Gesellschaft verstehen wollen. Es ist eine provokante und inspirierende Lektüre, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet. Lassen Sie sich von Baudrillards radikalen Ideen herausfordern und entdecken Sie die verborgenen Wahrheiten hinter den glitzernden Fassaden der Hyperrealität.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die drei Simulakren
2.1 Zeitalter der Imitation
2.2 Zeitalter der Produktion
2.3 Zeitalter der Simulation
3. Thesen der Hyperrealität
3.1 Macht und Hyperrealität im Bereich der Medien
3.2 Verschwinden des Menschen
3.3 Das unendliche Ende bzw. der Leerlauf der Geschichte
4. Fazit und Kritik
4.1. Einleitung
4.2. Über den Umgang mit Jean Baudrillard
4.3. Selbstreferentialität bzw. Referenzlosigkeit
4.4. Ausdifferenzierung der Gesellschaft und Individualisierung der Menschen
Hyperrealität
Anhang
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Kernteil des philosophisch- soziologischen Werkes Jean Baudrillards. Ziel ist es, neben der Darstellung der wesentliche Elemente diese zu überprüfen und vor allem praktische Bezüge unter besonderer Berücksichtigung des Feldes der Medien herzustellen und zudem eine kritische Stellungnahme abzugeben.
Dabei widmet sich der erste Teil der Beschreibung und Erläuterung der drei Simulakren Imitation, Produktion und Simulation. Dies geschieht unter Zuhilfenahme verschiedener Texte von und über Jean Baudrillard, im besonderen durch das 1976 erschienene Buch "Der symbolische Tausch und der Tod".
Der zweite Teil geht vertiefend auf das Zeitalter der Simulation und der Hyperrealität ein und stellt die drei bedeutendsten Thesen Baudrillards einerseits vor und untersucht andererseits unter Anwendung verschiedener Beispiele aus den Bereichen Kino, Musik und Fernsehen u.a. diese Thesen mit dem Ziel, ihren Gehalt in der Alltagswelt zu eruieren.
Dabei geht es zunächst um Macht und Hyperrealität im Bereich der Medien (3.1.) und der Gesellschaft. Besondere Berücksichtigung findet hierbei der theoretische Aspekt unterstützt durch Bezug auf die Welt der Filme und der Literatur sowie des demokratischen Systems.
Abschnitt 3.2. setzt sich mit der These vom Verschwinden des Menschen auseinander.
Hierbei widme ich mich im besonderen dem Bereich der modernen Musik in Person von Karlheinz Stockhausen und der elektronischen Musik der Gruppe Kraftwerk sowie den daraus entstandenen Musikrichtungen und deren Begleiterscheinungen.
Der dritte und letzte Abschnitt (3.3.) handelt von der These des unendlichen Endes bzw. des Leerlaufs der Geschichte. Neben der allgemeinen theoretischen Darstellung steht dabei der Recyclingbegriff Baudrillards und Vilem` Flussers im Vordergrund. Beispiele aus der Lebenswelt ließen sich auch hier im Bereich des Films finden.
Abschnitt 4. befaßt sich zunächst mit einer allgemeinen Abhandlung über das Phänomen Jean Baudrillard und seinen Kritikern, gefolgt von einer Erläuterung der wesentlichen Kritikpunkte beginnend mit der These der Selbstreferentialität bzw. Referenzlosigkeit, gefolgt von der scheinbaren Ignoranz der Ausdifferenzierung der Gesellschaft seit der industriellen Revolution und abgeschlossen durch den Aspekt der Hyperrealität. Hierbei nehme ich aus aktuellem Anlaß Bezug auf das Attentat zweier Schüler in Littleton, USA.
Im Anhang (5.) finden sich unter anderem Songtexte der Gruppe Kraftwerk.
2. Die drei Simulakren
Jean Baudrillard unterteilt die Geschichte der Menschheit seit der Renaissance in drei Stadien, die er als die "Drei Ordnungen der Simulakren" bezeichnet.
Simulakren sind in diesem Zusammenhang ein abstraktes System von Zeichen, die in einem bestimmten Verhältnis zur materiellen Welt stehen und so ein jeweils unterschiedliches Modell der Realität darstellen. Ein solches Modell ist für die Menschen unerläßlich, denn nur so können sie die Welt verstehen, deuten, reproduzieren und manifestieren. Nach Auffassung Baudrillards beeinflussen die Simulakren die Realität, doch genauso beeinflusse selbige auch die Simulakren bis schließlich beide zur Hyperrealität verschmelzen würden. Bis dahin sei die Beziehung reziprok.
Die erste Ordnung der Simulakren bezeichnet Baudrillard als Zeitalter der Imitation, die zweite als Zeitalter der Produktion und die dritte als Zeitalter der Simulation. Diese drei Stadien werde ich nun in chronologischer Reihenfolge erläutern.
2.1. Zeitalter der Imitation
Dieses ist zeitlich einzuordnen zwischen Renaissance und industrieller Revolution. In der vorausgegangenen Zeit des Feudalismus seien Anzahl und Art der Distinkstionszeichen noch beschränkt gewesen. Der Zugang zu ihnen sei zum einem stark reglementiert und vom Status der Personen abhängig gewesen, die diesen Zugang erwünschten, zum anderen sei die Verletzung dieser Regeln als eine Übertretung der gezogenen Grenzen verstanden und somit als Angriff auf die herrschende Ordnung und dementsprechend bestraft worden. Dadurch seien die Zeichen eindeutig gewesen und kaum interpretierbar. Dies habe eine Sicherheit geschaffen, die aber nur aufgrund dieser qualitativen und quantitativen Beschränkungen funktioniert habe.
Zu Beginn der Renaissance habe sich das Prinzip des Status zu einem Prinzip der Nachfrage entwickelt. Die Exklusivität der Zeichen sei aufgebrochen worden, sie seien frei interpretierbar und kombinierbar und auch abbildbar geworden. Diese nun vervielfachten Zeichen hätten nichts mehr mit dem aufgezwungenen Zeichen des Feudalismus zu tun gehabt, sie hätten eine "Erweiterung eines Materials, dessen vollständige Klarheit von der Beschränkung abhing, der es unterworfen war" ( Jean Baudrillard, "Der symbolische Tausch und der Tod" ) dargestellt. Sie waren Imitationen der Originale, artifizielle Nachbildungen. Der Referenzhorizont bleibe hier noch unangetastet. Die Zeichen hätten eine Welt repräsentiert, die noch nicht von den Menschen manipuliert worden sei, deren Durchleuchtung aber hier ihren Anfang genommen habe. Das Streben des Menschen, sich neues Wissen anzueignen, äußere sich in dieser Zeit laut Baudrillard in dem Streben nach Universalität und dem Versuch "den Dingen ihre natürliche Beschaffenheit auszutreiben" ( Jean Baudrillard, ebd.). Die Fortschritte in den Naturwissenschaften machen dies am deutlichsten. Die Erforschung des menschlichen Körpers und der Natur, der Wunsch, hinter die Oberfläche zu blicken und durch die Imitation des Selbst sich zu erkennen, besonders verdeutlicht in Mary Shelleys Roman "Frankenstein", seien hier beispielhaft genannt. Doch vor allem dem Stuck weist Baudrillard eine besondere Bedeutung zu. Durch diese "geistige Masse", die fast beliebig formbar sich den Wünschen des Menschen anpaßt, sei es ihm möglich, Natur nachzubilden und das Natürliche durch das Künstliche zu ersetzen. Baudrillard sieht den Stuck als universelle Masse, die als einzige zu dieser Zeit dem Menschen die Möglichkeit gebe, sein Universalitätsstreben zu verwirklichen und ein Äquivalent für alle Dinge zu schaffen.
2.2. Zeitalter der Produktion
Durch die industrielle Revolution ist laut Baudrillard eine neue Klasse von Zeichen entstanden. Diese Zeichen hätten nicht mehr die Natur imitiert und bilden somit einen radikalen Gegensatz zur Theatralik der Renaissance.
Die neuen Zeichen, hergestellt durch mechanische Reproduktion und Fließbänder, hätten die Referenzsysteme Natur und Vernunft verloren und ein Auseinanderbrechen der vormalig selbstverständlichen Beziehungen zwischen Signifikat und Signifikant und eine gleichzeitige Implosion von Bedeutungen bewirkt. Unter diesen Voraussetzungen entsteht die Massenkultur, die als Zugangsberechtigung zu den einzelnen Zeichen nur noch das Geld kennt und deren neue Realität auf dem ökonomischen Prinzip gründet. Damit einher geht die Entzauberung des metaphysischen Glaubens an die Zeichen. Die Simulakren der 2.Ordnung hätten eine Realität "ohne Echo, ohne Bild, ohne Schein" erzeugt, "so ist die Maschine, so ist das gesamte System der industriellen Produktion"( Jean Baudrillard, ebd.). Es herrsche vor eine beliebige Austauschbarkeit der Waren, des Geldes, eine grenzenlose Konvertierbarkeit und Indifferenz. Die Zeichen, produziert aus der Maschine, seien ohne Tradition. Die Anzahl der Objekte werde beliebig und die Objekte seien ununterscheidbar geworden und dadurch auch der Mensch. Während er im Zeitalter der Imitation noch ein aktives und kreativeres Wesen gewesen sei, werde der Mensch nun passiv. Er richtet sich nach den Laufzeiten der Fließbänder, nach den Vorgaben der Maschinen und den Standorten der Fabriken, erkennbar zur Zeit der industriellen Revolution im Pauperismus, in der Landflucht und damit zusammenhängend im Zusammenbruch der sozialen Netze der Dorfgemeinschaften und der Anonymisierung in den Städten, nicht nur bedingt durch das Zusammentreffen sich unbekannter Menschen aus zum Teil ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands , sondern auch durch die Unmöglichkeit des Aufbaus neuer sozialer Netze bei Arbeitszeiten von 15 Stunden und mehr täglich. Statt der Theatralik der Imitation nun die Nüchternheit der Produktion, der Beginn der "Mensch-Maschine" ( Wolfgang Pirscher ).
Trotz dieser einschneidenden Veränderungen in der gesellschaftlichen Struktur und im menschlichen Zusammenleben bezeichnet Baudrillard das Zeitalter der Produktion als relativ unbedeutende Phase in der menschlichen Entwicklung, denn unbegrenzte Reproduzierbarkeit sei vielleicht quantitativ eine beeindruckende Leistung, doch qualitativ eine eher dürftige Lösung zur Beherrschung der Welt.
2.3. Zeitalter der Simulation
Durch die Revolution im Bereich der Informationstechnik werden die Grenzen, die es für die mechanische Reproduktion gab, aufgelöst. Wissen, Daten und Kultur können nun durch den digitalen Code und die Erfindung des Computers beliebig oft und schnell verarbeitet, verbreitet und kopiert werden. Damit verschwinde auch das letzte Referenzsystem Raumzeit. Dieses neue Zeitalter ermögliche die Erschaffung digitaler Welten und eine Dematerialisierung der vorhandenen Welt sowie die Verdrängung der Realität aus der Sinneswahrnehmung. Die Simulation verwische den Unterschied zwischen Imaginärem und Realität.. Damit seien sowohl die physischen als auch die metaphysischen Referenzsysteme verschwunden. Die Zeichen verweisen also nicht mehr länger auf Inhalte und Ursachen, sondern nur noch auf Oberflächen und sich selbst. Dadurch verschwänden Bedeutungen und Differenzen, Kritik, Vernunft und Gut und Böse. Anhand des Geldes seien diese Thesen der Selbstreferentialität verdeutlicht:
Marx und Simmel sahen Geld als immateriell, losgelöst von der wahrnehmbaren Lebenswelt und dem Raumzeitkontinuum. Die Wege des Geldes seien subversiv und nicht durchschaubar. Eine Auffassung, derer man sich aufgrund der Tatsache, daß heutzutage nur fünf Prozent des Geldverkehrs Bartransaktionen sind, anschließen kann. Baudrillard geht mit seiner Einschätzung noch weiter, er glaubt, daß Geld sich nur noch mit sich selbst austausche und sowohl dem Gebrauchswert als auch dem Tauschwert entzogen sei und seine Funktion als Tausch-, Zahlungs-, Rechen-, und Wertaufbewahrungsmittel eingebüßt habe und somit referenzleer sei.
Die These des Verlustes des Tauschwertes erscheint mir sehr zweifelhaft, da Geld, welches nicht gegen Ware austauschbar ist, sowohl ökonomisch als auch soziologisch wert- und funktionslos ist. Als Indiz für Baudrillards These wäre vielleicht das Europäische Währungssystem zu nennen, welches sich durch die Bindung der Währungen aneinander auszeichnet. Dies bedeutet, daß sich der Wert der jeweiligen Währung hauptsächlich durch den Vergleich mit den anderen Währungen errechnet und somit relativ losgelöst von der realen Warenwelt existiert und somit zumindest zum Teil als selbstreferentiell bezeichnet werden könnte
Einschränkend stellt Baudrillard fest, daß es zwar noch reale Ereignisse gebe, diese aber hätten aufgrund ihrer Referenzlosigkeit ihren realen Bezugsrahmen verloren. In dieser referenzlosen Welt, in der es keinen Unterschied mehr gäbe zwischen Realität und Fiktion, entstehe die Hyperrealität.
Diesen Begriff der Hyperrealität, welcher wohl am engsten mit dem Autor verbunden wird, will ich im folgenden anhand verschiedener Thesen und Beispiele erläutern und seine Absolutät in Baudrillard´schen Sinne in unserer Welt darstellen.
3.1 Macht und Hyperrealität im Bereich der Medien
Die Faszination, die Bilder in uns auslösen, sieht Baudrillard begründet in ihrer Asexualität und Unsterblichkeit in einer Zeit in der die Bedeutung des Geschlechts und des Todes immer mehr zurückweiche, wobei er verheimlicht hierbei nicht seine Sympathie für die archaischen Völker, die noch bilderlose Gottheiten verehren und somit Respekt für das Nicht-Menschliche und noch nicht vom Menschen Manipulierte zeigen würden. Im Gegensatz hierzu stehe die christliche Religion und im besonderen der Papst, welcher als eine Art Medienstar parallel zum Verschwinden des Christentums und seiner ursprünglichen Lehre um die Welt reise und somit genauso flüchtig werde wie alle Ereignisse in der Hyperrealität: Gott und die Religion verschwänden hinter Bildern genauso, wie es mit der Realität geschehe.
Die Bilderflut, die die Medien erzeugen, sei nicht länger visuell, sondern taktil. Nach Baudrillard verschwinden die Inhalte und das Angebot verschlingt die Nachfrage. Wir werden permanent durch Botschaften sowohl der Radio-, als auch der Fernsehprogramme getestet und betäubt. Durch diese brachiale doch uns unbewußte Gewalt der Tests werde ein In-Sich- Gehen unmöglich. Eine Sinnentleerung vollziehe sich durch Überinformation. Abstraktion und der Aufbau einer Distanz zum Erlebten werde verhindert, vor allem durch Liveübertragungen. Diesen Aspekt bezeichnet Virillio als "Tyrannei der Echtzeit" und sieht sie verkörpert in dem Fernsehsender CNN, welcher auch in Baudrillards Schriften zum Golfkrieg eine besondere Rolle einnimmt. Baudrillard bezweifelt hierbei das "Statt-finden" des Golfkrieges, da der Konflikt nur in der Hyperrealität der Medien auftauche. Der eigentliche Kriegsschauplatz sei nicht der Irak, sondern das Medium, welches virtuelle Bilder einer Kriegssimulation gleich gesendet habe. Es verschwinde die Vorstellung von Zeit und Raum, selbst der eigene Tod werde hyperreal, da der Mensch durch die Echtzeitübertragungen die Möglichkeit erhalte, seinen eigenen Tod zu beobachten, etwa dann, wenn er die Bilder der raketeneigenen Kamera in seinem Fernseher sieht und erkennt, daß diese Rakete auf sein Haus zu rast und ihn töten wird.
Die durch dieses besonders drastische Beispiel verdeutliche Taktilität der Bilder lasse es nicht mehr zu, sich und anderen Fragen zu stellen über das Gesehene, denn die Fragen, die uns das Medium stellt, würden zu schnell aufeinander folgen und uns die Zeit nehmen, selber zu denken. Die Medien testen, modulieren und formen uns zugleich. Nach Baudrillard´scher Vorstellung hat das Blatt sich also gewendet und die Medien haben unsere Rolle übernommen.: nicht mehr wir schaffen mit unseren visuellen bzw. sinnlichen Wahrnehmungen und unserem Verstand aus Umwelt Realität, sondern die Medien haben ein Eigenleben entwickelt und erzeugen (Hyper-) Realität. Nur die Ereignisse, die in den Medien stattfinden, finden wirklich statt. Ereignisse werden im Hinblick auf die Medien erzeugt. Kameras, die die Demonstranten dazu anstiften gewalttätig zu werden, Kameras, die von den Menschen an der Berliner Mauer erwarten, diese nun zu stürmen und auch genau das erreichen. Der Zuschauer hingegen wird nicht zur Aktivität gedrängt. Ganz im Gegenteil dazu wird die zuschauende Gesellschaft bedingt durch die Implosion des Sozialen (Massenproduktion -> Produktion einer Masse) zur gleichgültigen Masse und verlangt durch ihre Indifferenz gleichzeitig ein indifferentes Medium. Die Aktivität des Menschen geht verloren, übrig bleibt Passivität, die getestet werden muß, da ein Selbstausdruck nicht mehr stattfindet. Der Zuschauer wird zum schwarzen Loch, welches in einer Art apathischen Begierde alles in sich aufsaugt und doch nichts reflektiert.
Herbert Marshall McLuhans Vorstellung "Medium is the Message" ist wahr geworden, doch sicherlich anders als von ihm erhofft. Statt einer aufgeklärten Gesellschaft, in der jeder Bürger die Möglichkeit hat, sich die Informationen zu beschaffen, die er braucht, und diese Möglichkeit auch nutzt, entwickelte sich ein Stadium, in der es weder Kommunikation noch Reziprozität gibt, und die Menschen Mülleimern gleich den unendlichen Fluß der Bilder in sich aufnehmen. Würden sie aufwachen, würden sie vielleicht die Leere und Ereignislosigkeit erkennen, die sie umgibt. Und genau aus diesem Grund dürfen die Ereignisse in der Hyperrealität nicht aufhören.
Die Indifferenz und Inhaltslosigkeit äußert sich laut Baudrillard desweiteren in dem bisher noch nicht angesprochenem Simulakrum der Wahlen und Umfragen. Auch hier liege, genau wie bei der Vielzahl der Radio- und Fernsehsender, die Täuschung einer Wahlmöglichkeit vor.
Aufgrund der Indifferenz der Parteien, Institutionen, Interessengemeinschaften und Organisationen manifestiere das Trugbild der freien Meinungsäußerung die Unfreiheit. Bei einer Bundestagswahl hat der Bürger nur die Möglichkeit eine Partei zu wählen, welche in diesem System und von dieser Gesellschaft als demokratisch zugelassen ist ( im Gegensatz zur Weimarer Zeit, welche laut Baudrillard vor dem Zeitalter der Simulation existierte ) und unterstütze somit ganz unabhängig von seiner letztendlich getroffenen Wahl doch das Bestehende. Möchte er gegen diese Beschränkung klagen, kann er dies nur bei einem Gericht dieses Systems und spricht somit selbigen eine Legitimation aus, durch die er es wiederum manifestiert und reproduziert. Ähnlich der schönen neuen Welt des Aldous Huxley ist der Mensch unweigerlich in der vorgetäuschten Freiheit gefangen. Im Gegensatz zu den repressiven Staatsformen vergangener Tage, ist ihm diese Unfreiheit nicht bewußt und dadurch ist sie um so perfekter und absoluter. Sie ist ein Gefängnis in dem die Gefangenen nicht um ihre Gefangenschaft wissen und somit noch ausgereifter als das Panopticon Jeremy Benthams, in dem die Insassen zwar nicht wußten, wann und ob sie kontrolliert werden, doch zumindest über das Wissen um die Existenz einer Beschränkung ihrer Freiheit und die Existenz einer Kontrolle verfügten. Die Perfektion dieses System und seine Fähigkeit, sich selbst noch durch begangene Fehler zu reproduzieren, erläutert Baudrillard anhand des Todes von Andreas Baader im Stammheimer Gefängnis. Die lange Zeit ungeklärten Umstände und die Fehler bei den Ermittlungen hätten im Endeffekt nur dem System geholfen, da so vom eigentlichen Tod des Terroristen und der Bedeutung für die Gesellschaft abgelenkt werden konnte. Die Menschen protestierten gegen die Ermittelnden und gegen die Staatsmacht, beschäftigten sich somit mit dem System, welches sich dadurch weiter reproduzierte, während das zu Tode gekommene Individuum aus dem Mittelpunkt des Interesses verschwand.
Der Ausdruck einer Individualität wird wie beschrieben also nur simuliert. Doch nicht nur bei der Wahl des Fernsehprogramms oder der Partei ist dies der Fall. Auch der Ausdruck des eigenen Selbst, der Wunsch, etwas Außergewöhnliches zu leisten, zu erleben und aus der Masse herauszutreten, wird betäubt und kanalisiert durch die Wirkung der Medien. Dies will ich anhand zweier Beispiele näher erläutern.
Durch die unaufhörliche Flut der Bücher und Filme zieht sich ein bestimmtes Thema in unendlichen Variationen: ein durchschnittlicher Bürger gerät durch wie auch immer geartete Verwicklungen und Handlungsfäden in bedrohliche Situationen, die nicht nur ihn, sondern auch andere Menschen in Gefahr bringen, sei es seine Familie oder die Gesellschaft, in der er lebt. In dieser Situation wächst der Durchschnittsmensch über sich hinaus und beschützt, befreit und/oder errettet sich selbst sowie alle anderen betroffenen Menschen. Ist ihm dies gelungen, endet der Film bzw. das Buch zumeist mit der Rückkehr des anfangs unfreiwilligen Helden in sein vertrautes Leben und vor allem mit der Wiederaufnahme des selbigen. Er wird selten der Führer beim Wiederaufbau der zerstörten Welt, noch drängt es ihn, sich in seinem weiterem Leben für das Verhindern weiterer Katastrophen gleicher Art einzusetzen. Dem Konsumenten wird beim Lesen bzw. Zuschauen ein Ventil gegeben, den aufgestauten Sozialisationsdruck abzubauen und seine Träume, Wünsche und Triebe durch die Identifikation mit der Figur stellvertretend ausleben zu lassen, und gleichzeitig erfährt er die Botschaft, daß auch der Held am Ende lieber sein Haus pflegt als evtl. revolutionäre Vereinigungen zu gründen oder die durch seine Handlungen sich ihm eröffnenden Möglichkeiten zu einer machtvollen und außergewöhnlichen Position zu nutzen
Ähnlich funktioniert das Prinzip der ewigen Helden. Man könnte meinen, daß in diesen Filmen und Büchern der Charakter des Durchschnittsmenschen nicht auftaucht, da der Hauptdarsteller eben nicht die Sehnsucht nach einem geregelten Leben verspürt. In diesen Filmen wird diese Funktion zumeist durch eine Nebenfigur übernommen, welche den Hauptdarsteller bei seinen Abenteuern begleitet und die Ängste, Wünsche und Sehnsüchte des Publikums ausdrückt. Diese Rolle ist es auch, der üblicherweise die meiste Sympathie entgegengebracht wird.
Ein weiteres, nicht nur in diesem Zusammenhang ( ich werde später darauf zurückkommen ), interessantes Beispiel sind die neueren Entwicklungen in der Kinobranche. 1998 und ´99 sorgten zwei Filme für Furore, die ohne reale Schauspieler auskamen. "A Bug´s Life" " und "Antz" sind nach "Toy Story" die ersten Filme, deren Handlung vollständig in einer virtuellen Welt spielt, doch unterscheiden sie sich vom letztgenannten in einem wichtigen Punkt. Beide Trickfilme spielen im Reich der Ameisen, welche ein nahezu perfektes Beispiel für den Staat der Massen in Indifferenz und für die Nichtexistenz von Individualität darstellen. Die Wahl des Ameisenstaates verbunden mit der neuen Technologie der durch Computer geschaffenen Filme verknüpfen zwei der wichtigsten Thesen Baudrillards: zum einen die Hyperrealität der Medien und zum anderen das Verschwinden des Menschen aus der Welt. Auf die letzt genannte These will ich nun im folgenden eingehen. Hierbei komme ich noch einmal auf die erwähnten Filme zurück.
3.2. Verschwinden des Menschen
Durch das neue Genre des computeranimierten Films setzt sich der Trend vom Rückzug der Menschen aus der Welt fort. Übriggeblieben sind in diesen Filmen die Stimmen der Synchronsprecher. Der Mensch wird reduziert auf die Funktion eines Werkzeuges und tritt nicht mehr visuell wahrnehmbar in Erscheinung. Ähnlich ersetzt sich der Mensch durch Erfindungen wie der des Anrufbeantworters, der für uns das Telefonieren übernimmt, oder der des Videorecorders, der für uns die Filme schaut. Es scheint fast so, als ob wir ein schlechtes Gewissen hätten, uns dem System und den Medien zu entziehen und so elektronische Geräte zwischenschalten.
Bevor ich näher auf weitere Beispiele eingehe, will ich zunächst den theoretischen Aspekt kurz beleuchten. Jean Baudrillard sieht die Erklärung für das Verschwinden des Menschen in der Gleichgültigkeit, die die Bilder über Kriege, Katastrophen und Elend nur noch in ihm auslösten. Der Mensch habe sich zurückgezogen aus der Welt, seine Gefühle und Sinne würden nicht mehr berührt, sondern nur noch betäubt. Allein durch die Möglichkeit der atomaren Selbstvernichtung scheine der Mensch bereits gestorben zu sein. Der Drang, seine Menschlichkeit abzustoßen, werde deutlich in dem Bestreben, die eigene Gestalt durch chirurgische Eingriffe zu verändern. Die Forschung im Bereich der Gentechnik scheint hierbei nur die konsequente Fortführung dieses Bestrebens zu sein.
Doch Baudrillard eröffnet einen tröstlichen Ausblick. Vielleicht sei es eine Gnade und eine Erlösung, aus dieser Welt zu verschwinden und somit die Erfüllung eines Menschheitstraumes. Und vielleicht sei das Verschwinden nur notwendige Bedingung um wiederzukehren. Doch dieser Gedanke bleibt unausgereift und unbegründet wie so vieles in seinen Schriften. Es scheint fast so, als ob Baudrillard für einen kurzen Moment seinen fatalistischen und deterministischen Gedanken entkommen wollte und als ob ihm dies nicht gelungen sei.
Ein Indiz für den Wunsch, sich aus dieser Welt zurückzuziehen scheint wieder einmal die Filmindustrie Hollywoods zu liefern. Filme der 90er wie Armageddon, Deep Inpact, Independence Day, Vulcano oder Outbreak verdeutlichen dies weniger auf subtilerer Ebene als vielmehr durch die Beschäftigung mit apokalyptischen Themen. Interessant hierbei ist, daß die Bedrohungen in diesen Filmen nicht durch menschliches Handeln ausgelöst werden, wie es noch zu Zeiten des Kalten Krieges der Fall gewesen ist. Der Zusammenbruch der UdSSR und des Ostblocks hat weiter zu einer indifferenten Welt beigetragen, die ein Feindbild nicht mehr länger innerhalb der menschlichen Gesellschaft finden kann und sich somit andere suchen muß.
Den Rückzug des Menschen aus der Welt sei nun im folgenden erläutert anhand der elektronischen und modernen Musik und dabei im besonderen an der Musik Karlheinz Stockhausens und der Gruppe Kraftwerk.
Stockhausen, Zeit seines Lebens sowohl umstrittener als auch gefeierter Musiker, gilt als Begründer der modernen Musik. Ohne ihn und die Gruppe Kraftwerk, auf die ich später noch eingehen werde, ist elektronische Musik nicht vorstellbar. Während Musik im allgemeinen verstanden wird als Form der Lebendigkeit, als Ausdruck der Gefühle und eines zumindest momentanen Lebensgefühls, nimmt Stockhausen aus seinen Werken diese Lebendigkeit und Spontanität heraus. Seine Stücke basieren häufig auf mathematischen Formeln und sind die Ergebnisse einer vorausgehenden wissenschaftlichen und extrem rationalen Arbeit. Die einzelnen Klänge werden nicht nach ästhetischen, sondern nach statistischen Kriterien zusammengefügt und ergeben ein Klangbild, welches nicht mehr auf der Lebendigkeit der Musik und damit auf Menschlichkeit, sondern auf dem leblosen Feld der Mathematik und der Zufallsoperationen basiert.
Interessanterweise findet sich auch der im Vorigen behandelte Gedanke der vorgetäuschten Freiheit wieder. Im Klavierstück XI von 1956 ließ Stockhausen ein überdimensionales Notenblatt mit 19 verschiedenen Notengruppen herstellen und hielt den Pianisten an, durch einen zufälligen Blick eine dieser Gruppen auszuwählen und zu spielen. Am Ende einer jeden Notenstruktur fand der Pianist Anweisungen für Grundlautstärke, Geschwindigkeit und Anschlagsform und spielte nach einem weiteren absichtslosen Blick nach diesen Angaben das nächste Teilstück. Die daraus entstehende Beliebigkeit der Abfolge und des Klangs der einzelnen Elemente scheint dem Pianisten eine Gestaltungs- und Wahlfreiheit zu geben über die er sonst nicht verfügt. Doch sind die tieferen Strukturen des Gesamtwerkes so angelegt, daß diese Freiheit eine Illusion bleibt und der Musiker das Gesamte nicht wirklich verändern kann. Er bleibt zum einen in dem vorgegebenen Rahmen gefangen und zum anderen sind die von ihm an der Oberfläche getroffenen Entscheidungen unterschwellig kanalisiert und begradigt. Dies scheint mir eine Parabel für Baudrillards Vorstellung von der Weltgesellschaft im Zeitalter der Simulation zu sein.
Die Gruppe Kraftwerk, die bereits Anfang der 70er Jahre mit Hilfe selbst hergestellter Instrumente elektronische Musik produzierte, ist ebenso wie Karlheinz Stockhausen für ihren Perfektionismus und ihre arkadische Arbeitsweise bekannt. Keine andere Band hat in der folgenden Zeit die Musikgeschichte stärker beeinflußt als die Gruppe aus Düsseldorf. Künstler wie David Bowie, Depeche Mode oder auch OMD, um nur einige zu nennen, haben sich stark von Kraftwerk inspirieren lassen, die Musikrichtungen der elektronischen Musik, wie zum Beispiel Techno, Rave, EBM, Drum´n Bass, Trance etc. sind ohne Kraftwerk nicht vorstellbar. Der Mythos, der um diese Band entstanden ist, resultiert nicht zuletzt aus ihrer Zurückgezogenheit, die ihre Konzerte zu einen seltenen Ereignis machen. Bei öffentlichen Auftritten haben sie sich des öfteren durch Roboterfiguren ersetzen lassen und treten, wenn sie live auf der Bühne stehen, stets uniformiert auf. Berühmt gemacht haben sie dabei ihre roboterhafte pantomimische Choreographie, die besonders durch Stücke wie "Die Roboter" oder "Die Mensch-Maschine" unterstützt wird (Songtexte im Anhang). Die Künstler verschwinden hierbei hinter ihrer Musik und verhalten sich dementsprechend auch in ihrem Privatleben. Einladungen zu Festivals oder Presseauftritten werden zumeist abgesagt, Alben werden zurückgezogen um Jahre verspätet veröffentlicht zu werden, ohne jemals die jeweilige Entscheidung zu begründen, Interviews zu bekommen erweist sich als fast unmöglich.
Auch wenn die heutige Techno- und Raveszene dieses introvertierte Verhalten nicht übernommen hat, symbolisiert sie doch wie keine andere Richtung in der Musik die Zurückgezogenheit des Menschen. Auf Texte wird fast vollkommen verzichtet und selbst menschlichen Stimmen werden, wenn überhaupt, nur stark verzerrt und somit entmenschlicht verwendet. Der DJ verschwindet akustisch hinter seiner Musik und visuell hinter den Turntables, der elektronischen Ausrüstung und der die Dunkelheit durchbrechenden Licht- und Lasershow. Zusätzlich ist er zumeist auf ein Podest erhoben, welches ihn auf die Menschen herab- und vor allem selbige zu ihm aufschauen läßt. Die Tanzenden versammeln sich um dieses Podest und die Assoziation einer Vergöttlichung seiner entmenschlichten und gestaltlosen Person durch die Besucher läßt sich nur schwerlich vermeiden. Der Trancezustand, den die Tanzenden durch die sich ständig wiederholenden Klangfrequenzen erreichen, wird häufig unterstützt durch die aufputschenden Drogen der Technomusik, XTC und Speed. Während von den Drogen der 70er Jahre, Marihuana und LSD, zumindest auf der ideellen Ebene noch eine Bewußtseinserweiterung und eine Form der Selbstfindung in Sinne der Individualität erwartet und Heroin als Fluchtmöglichkeit aus der sie umgebenden Welt verstanden wurde, liegt XTC und Speed lediglich der Wunsch zu Grunde, die Musik sowohl qualitativ (XTC) als auch quantitativ (XTC und Speed) stärker in sich aufnehmen zu können, sich davon erfüllen und durchdringen zu lassen und möglichst lange in diesem Stadium der Bewußt-losigkeit zu bleiben.
3.3. Das unendliche Ende bzw. der Leerlauf der Geschichte
Jean Baudrillards Vorstellung von der Hyperrealität erscheint ihm neben den bereits vorgestellten Thesen verdeutlicht in einem unendlichen Ende der Geschichte. Nach der linearen Fortbewegung der Zeit habe sie nun ein Stadium erreicht in dem sie stillstehe bzw. rückwärtslaufe. Diese beiden an sich widersprüchlichen Thesen verbindet er in seinem theoretischen Konzept im besonderen mit dem Begriff des Recyclings, auf den ich im folgenden auch mit Hilfe Vilem Flussers eingehen möchte.
Baudrillard sieht in unserer heutigen Welt die Ansammlung eines riesigen Müllhaufens, bestehend nicht nur aus industriellem sondern vor allem aus intellektuellem Müll. Dieser Müll habe sich angehäuft in der Geschichte der Menschheit, die ihn immer weiter mit sich herumgetragen und ständig vergrößert habe. Erst durch die Erfindung der Recyclinganlagen habe sich dies geändert. Recycling ermögliche den ständigen Rückgriff auf bereits Vorhandenes und bringe somit die Linearität der menschlichen Entwicklung zum Stillstand. Es entstehe nicht mehr länger Neues, sondern Altes werde wiedererschaffen und moduliert im Sinne unserer Zeit. Filme werden noch einmal gedreht, diesmal in Farbe, reingewaschen von Widersprüchen und in einer Perfektion, die unwirklich erscheint: hyperreal.
Nach Baudrillard ist nichts vor dem Prozeß des Recyclings gefeit, weder Religionen, Demokratie, Ethnien noch Ideologien. Nichts löst sich auf im Sinne einer Verwesung, alles wird wiederverwendet und genau dies ist gemeint mit der Unmöglichkeit eines Endes der Geschichte. Das neu Erschaffene ist nicht mehr als das Simulakrum des Alten, doch ohne wirklichen Verweis auf dieses, denn die Perfektion der Reproduktion zerstört auch hier den Referenzhorizont. Durch den ständigen Rückgriff wird ein Neuanfang, ein Schnitt verunmöglicht. Die Moderne ist nicht zu befreien von dem recycelten Müll der Vergangenheit und gibt sich statt dessen der Sehnsucht nach dem Vergangenen hin, eine Sehnsucht, die nach der Authentizität vergangener Tage sucht, doch diese nicht finden kann, da die aufgewandten Mittel Mittel der heutigen Zeit und damit der Hyperrealität sind.
Flusser und Baudrillard scheinen hierbei einer Meinung zu sein, doch will ich Flussers Sicht gesondert darstellen, da er mehr an einem argumentativen Diskurs interessiert zu sein scheint als Baudrillard und so ein Verstehen einfacher macht.
Flusser sieht in dem Phänomen des Recyclings einen Wandel der Geschichte von einem univoken und eindimensionalen in einen zirkulären Prozeß. Während der Geschichtsbegriff bisher linear und ohne die Möglichkeit eines Feedbacks verstanden worden sei, eröffne die Wiederverwertung des Abfalls neue Perspektiven. In der Zeit vor dem Recycling sei nur das umwandeln von Natur in Kultur möglich gewesen. Diese Kultur löse sich durch Verfall und Konsumption in den stetig wachsendem und eigenständiger werdenden Bereich des Abfall auf. Neben diesen wachsenden Müllberg entstehe ein weiterer Bereich, den Flusser als Bereich der "Halbfabrikate" bezeichnet und damit z.B. begradigte Flüsse, Getreide- oder Forstwirtschaften meint. Diese Halbfabrikate würden die Natur, genauso wie der Abfall die Kultur, in den Hintergrund drängen. Dies ergebe sich durch die Möglichkeit des Recyclings und so werde ein neuer Ausgangspunkt für Produktion und Konsumption gefunden, der eine zeitliche Entwicklung von Natur zu Kultur kaum mehr zulasse, da das Recycling einen zirkulären Prozeß erschaffen habe. Aus diesem Grund wird ein Fortschrittsgedanke sinnlos, denn in einem zirkulären Prozeß. hat nichts mehr Vorrang vor dem anderen. Daher ersetzt Flusser den Fortschrittsbegriff durch den Begriff der Information: Kultur ist informierte Kultur, Abfall ist teilweise desinformierte Kultur und Natur ist desinformierter Abfall.
Der Stillstand der Geschichte und der Rückgriff auf bereits Vorhandenes sei im folgenden kurz erläutert. Die vergangenen Jahrzehnte und hierbei vor allem die 90ger scheinen sich im zeitlich ansteigenden Maße dadurch zu kennzeichnen, daß die Zahl der Rückschauen und Rückblicke immer mehr zunimmt. Dies ist vor allem durch die Verbreitung der visuellen Medien gefördert worden. Im Bereich des Films erlebten wir gerade in den vergangenen Jahren zum einen eine Flut von Neuverfilmungen und zum anderen eine starke Beschäftigung mit historischen Themen. Beispielhaft seien hier Frankenstein, Jurassic Park I und II, Titanic, Shakespeare in Love, 1492, Schindlers Liste und Saving Private Ryan, um nur einige der kommerziell erfolgreichsten zu nennen, sowie die Star Wars Triologie, die vergangenes Jahr noch einmal in den Kinos lief, aufbereitet mit den technischen Möglichkeiten der 90er und die Verfilmung der nachträglich erfundenen Teile eins bis drei, die in den nächsten Monaten Jahrzehnte nach den Teilen vier bis sechs in die Kinos kommen. Hierbei werden bekannte Stoffe recycelt oder neue in einem bekannten historischen Kontext erfunden und im Sinne unserer Zeit umgesetzt, doch ohne dabei wirklich neues zu schaffen. Doch auch Filme oder Serien, die kein historisches Vorbild haben, gelingt es nicht wirklich neu zu sein, denn zuviel ist bereits erschienen und alles schon verfaßt worden. Ein Fortschritt bzw. Weiterschreiten ist also nicht mehr möglich, denn Fortschritt bedeutet neues zu entdecken und zu erschaffen. Statt dessen modulierte Wiederholung und Aufsplitterung in Fraktalität, beispielhaft hierfür ist die Pornographie, die den vormals langen Weg vom Kennenlernen bis zum sexuellen Akt abschneidet und sich nur auf selbigen beschränkt und diesen gleichzeitig mikroskopisch vergrößert, fraktal, darstellt in dem die Gesamtheit des Körpers reduziert wird auf die Geschlechtsorgane.
Das Problem unserer Zeit ist also, daß es nichts mehr zu entdecken gibt, oder mit Baudrillards Worten zu sagen: ich schreibe hier , daß es nichts mehr zu schreiben gibt. Die Menschheit unserer Zeit löst dieses Problem wie beschrieben in einem hyperrealen Anachronismus. Die Mittel, die Hyperrealität erschaffen und sie gleichzeitig darstellen, angewandt auf längst vergangenes, bilden eine Symbiose, die selbst die Vergangenheit zum Simulakrum werden läßt.
4. Fazit und Kritik
Einleitung
Jean Baudrillards Bücher und Aufsätze haben in einer erstaunlichen Bandbreite sowohl Zustimmung als auch Ablehnung erfahren. Vertreter identischer Denkrichtungen sind sich uneins in einer Beurteilung, Vertreter gegensätzlicher Ansätze loben ihn gemeinsam und interpretieren ihn doch völlig unterschiedlich. Dies alles ficht Baudrillard nicht an, denn er glaubt schon längst erkannt zu haben, daß Kritik sinnlos ist, da es eben keine Referenzen mehr gäbe. Trotzdem will ich versuchen, eine Beurteilung vorzunehmen, etwas über die an ihm geäußerte Kritik zu schreiben und gleichzeitig nach ihrem Sinn, ihrem Hintergrund und ihrem Gehalt zu fragen.
Über den Umgang mit Jean Baudrillard
Es ist offensichtlich, daß Jean Baudrillard kein Empiriker ist. Desweiteren scheint er mir auch kein Theoretiker in dem Sinne zu sein, als daß er versuchen würde seine Thesen anhand eines argumentativen Diskurses zu entwickeln. Viele seiner Kritiker haben ihn aber genau nach diesen Kriterien beurteilt und an ihm etwas bemängelt, daß er nie hat erfüllen wollen. Waldenfels hat über diese Kritiker einmal geschrieben, daß ihre Resonanzflächen zu schmal und unelastisch sein und meinte damit, daß der gewählte Weg sich Baudrillards Texten zu nähern, zu sehr verhaftet ist in bestehenden methodischen Denkmustern und den Blick und die Aufnahmefähigkeit zu sehr einschränkt. Auf diese Art ist ein Zugang nur schwerlich möglich und Ablehnung wahrscheinlich, denn zu groß sind oftmals die Brüche zwischen der Baudrillard´schen Theorie und der Wirklichkeit und zu absolut, zu deterministisch sind seine Aussagen über unsere Welt. Es ist also nötig, einen anderen und vielleicht weniger wissenschaftlichen Zugang zu erlangen. Wenn man keine wissenschaftlichen und soziologischen Abhandlungen erwartet und auch nicht in diesem Kontext heraus Baudrillard liest und wenn es zudem gelingt den Frust über die von ihm gewählte Art des Schreibens zu überwinden, läßt sich der Gehalt und die Faszination seiner Texte erschließen. Ohne den Anspruch einer die Gesellschaft erklärenden Theorie zu haben und sich statt dessen auf eine spielerische Art des Lesens und Nachvollziehens einzulassen, eröffnet die eigentliche Tiefe Baudrillard´schen Denkens. Trotzdem soll die Kritik an seinem Werk nicht ausbleiben.
4.3. Selbstreferentialität bzw. Referenzlosigkeit
Hierbei beginnen will ich mit der These der Selbstreferentialität bzw. Referenzlosigkeit der Zeichen. Baudrillard hat hier sicherlich einen wichtigen Trend erkannt, unübersehbar ist die Tendenz zur Oberflächlichkeit und zum verschwinden der Inhalte in den westlichen Gesellschaften. Beispielhaft genannt sein das Fernsehen und die zunehmende plakative Darstellung von Themen in diesem Medium sowie die abnehmende Bereitschaft der Bevölkerung sich gesellschaftlich oder politisch zu betätigen bzw. sich weitreichend in diesem Bereich zu informieren sowie das verschwinden der Inhalte aus den christlichen Religionen, näher erläutert in Abschnitt 3.1.. Vielleicht ergibt sich aus der fortschreitenden Komplexität der Gesellschaft die Notwendigkeit bisher bekannte Referenzen in einem Teilbereich der Alltagswelt zu vergessen, um zumindest ein Grundverständnis über neu hinzugekommene Bereiche zu erlangen. Aus einer eher vertikalen Bildung, die sich auf einige wenige Bereiche konzentrieren konnte, scheint sich eine horizontale zu entwickeln, die vorhandenes geistiges Potential weiter streuen muß. Zweifellos falsch aber ist die Pauschalisierung, die Baudrillard vornimmt. Ein gänzlicher Referenzverlust der Zeichen würde jede Gesellschaft zusammenbrechen lassen. Nur eine gemeinsame Assoziation ermöglicht ein geregeltes Zusammenleben. Gäbe es keine Referenzen mehr, würde uns das simple Rot einer Ampel nicht das Gebot zum Halt vermitteln, wäre uns gar die Verbindung Auto-Mobilität nicht mehr zugänglich und ich wäre nicht fähig diese Hausarbeit zu schreiben, da mir die Nutzung des PCs unbekannt geworden wäre, um nur drei Beispiele zu nennen. Ein weiterer Kritikpunkt soll sich mit dem verschwinden der Individualität von dem Zeitalter der Imitation bis hin zum Zeitalter der Simulation beschäftigen.
4.4. Ausdifferenzierung der Gesellschaft und Individualisierung der Menschen
Baudrillard ist vorgeworfen worden, daß er die Individualisierung des einzelnen Menschen und die Ausdifferenzierung der Gesellschaft seit der industriellen Revolution ignorieren würde. Da die Ausdifferenzierung in den letzten 200 Jahren ein offensichtliche Tatsache ist, die auch Baudrillard kaum übersehen haben dürfte, will ich versuchen eine mögliche Baudrillard´schen Sicht darzustellen, obwohl mir keine Reaktion auf die an ihm geäußerte Kritik bekannt ist. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß sein Individualitätsbegriff stark mit dem des Originals und der Imitation verbunden ist. In der Zeit vor der industriellen Revolution waren die meisten Menschen Landwirte und somit Selbstversorger. Sie produzierten sowohl ihr Essen als auch ihre Kleidung zumeist selbst, genauso wie Möbel, Werkzeuge, Häuser etc.. Die Objekte, die sie umgaben, waren also selbstproduziert und symbolisierten eine hohe Individualität. Die Menschen erschufen etwas aus eigener Hand, und das Erschaffene war in einem gewissen Sinne einzigartig, auch wenn es beispielsweise bereits andere Werkzeuge gleicher Art gab. Im Laufe der Geschichte verliert sich diese Individualität, da der Mensch seine Selbständigkeit im Bereich der Produktion immer mehr aufgibt und sich einen immer größer werdenden Teil der benötigten Objekte kauft. Diese Objekte sind nicht Ausdruck einer Individualität, da sie zum einen Massenprodukte sind und zum anderen von anderen Menschen und vor allem durch tote Maschinen produziert werden. In diesem Sinne hat der Mensch seine Individualität verloren und dies scheint mir der von Baudrillard gemeinte Aspekt zu sein. Zweifelsohne liegt auch hier ein Begründungsdefizit und eine unangebrachte Pauschalisierung vor, die die Auflösung der Ständegesellschaft und die sich entwickelte demokratische Struktur und die entstandene Wahlmöglichkeiten der Menschen in unserer Gesellschaft ignoriert. Will man Baudrillards Theorie in dieser Hinsicht retten, könnte man zumindest für den Bereich der Freizeitgestaltung behaupten, daß die Vielzahl von entstandenen Möglichkeiten im Bereich des Konsums und der Dienstleistungen von ihm nicht als wirklichen Ausdruck der menschlichen Freiheit verstanden werden würden, sondern viel mehr als Multiplikation von Leere und vorgetäuschter Individualität. Ein Massenprodukt, wie das Parfum, welches mit dem Slogan "be different" vertrieben wird, bleibt trotzdem ein Massenprodukt, genau wie das Auto, welches ein "anderes Auto für andere Menschen ist". Und so bleibt auch der Käufer dieses Produkts ein Massenmensch, denn neben ihm besitzen Hunderttausende andere Menschen dieses andere Auto oder ein Äquivalent einer anderen Marke.
Hyperrealität
Zum Abschluß möchte ich mich dem Begriff der Hyperrealität Baudrillard´scher Vorstellung beschäftigen. Der Vorwurf ist auch hier der gleiche: die Tendenz in der Gesellschaft wurde erkannt, doch dann geradezu, um mit der Sprache des Autors zu schreiben, hyperreal aufgeblasen und zur Absolutät erklärt. Baudrillard unterliegt auch hier der Impulsivität seiner Gedanken und seinem Hang zu Provokation.
Sein neben dem Golfkrieg liebstes Beispiel, die Freizeitparks des Walt Disney Konzerns, widerlegt ihn denkbar einfach. Zweifellos ist es richtig, daß in dieses Parks eine Scheinrealität aufgebaut wird in dem die Märchenfiguren und Comicfiguren des Konzerns dreidimensionalen Charakter erhalten durch kostümierte Angestellte und die Nachbildung ihrer Behausungen und der Nachstellung ihrer Abenteuer. Nur ist der Mensch durchaus in der Lage zu erkennen, daß Micky und Minnie nicht wirklich existieren, sondern daß in Eurodisneyland Pariser Studenten unter den Kostümen stecken, genauso wie ein Jugendlicher den Unterschied zwischen einer 70er Jahre Schlagerparty und der Realität zu erkennen vermag. Allenfalls Kleinkinder unterliegen dieser Illusion und glauben dem leibhaftigen Helden aus den Zeichentrickfilmen gegenüber zu stehen. Diese kindliche Naivität ist aber gewiß nicht neu, man denke an den Jahrhunderte alten Glauben an die Existenz des Weihnachtsmanns oder der Trolle, Kobolde und Heinzelmännchen.
Vielleicht ließe sich behaupten, daß dieser Glaube durch die Möglichkeiten der Technik in unserer heutigen Gesellschaft verstärkt wird, doch erscheint mir auch dies nicht unstrittig, da den Kindern der heutigen Zeit sehr viel mehr Informationsmöglichkeiten offenstehen und in Zukunft noch sehr viel mehr offenstehen werden, so daß sie sehr viel früher als in vergangenen Zeiten Zusammenhänge erkennen und Wissen erlangen.
Als sehr viel gehaltvoller erweist sich Baudrillards subtileres Beispiel der Infrastruktur in einigen US-Bundesstaaten, auf die ich folgenden auch im Zusammenhang mit dem Attentat der beiden Schüler aus Littleton eingehen möchte. In diesen Staaten findet sich vor allem in den Vorstädten der großen Zentren Detroit, Dallas oder Denver eine geradezu klinisch gereinigte und sterilisierte Umwelt. Die Agrarflächen, oder besser die Halbfabrikate der Getreidewirtschaft, sind ebenso exakt und geradlinig ausgemessen wie die Grundstücke auf denen die luxuriösen Wohnhäuser stehen, deren Luxus sich die Bewohner nur durch den Rückgriff auf Massenanfertigungen leisten können. Dies hat zur Folge, daß die Häuser sich lediglich durch geringfügige Modulationen ein und desselben Modells unterscheiden, und somit kaum als Ausdruck entwickelter in Bausubstanz umgesetzter Individualität verstanden werden können. Die Wohnsiedlungen, geometrischen Formen gleich durch Mauern von der evtl. real existierenden Umwelt getrennt , werden ergänzt durch ausgelagerte Industrieanlagen und Shopping Malls, die -und hier kommt diese Realität einer Hyperrealität sehr nahe- die Ansammlung der Konsumtempel innerhalb des Gebäudes unterbrechen durch künstliche Ruheorte, die aus Hydrokultur und künstlichen Biotopen bestehen und Dorfplatzatmosphäre simulieren sollen, eine Dorfplatzatmosphäre, die sich aus hyperrealen Anachronismen verschiedenster Kulturen und/oder aus einem Konglomerat erfundener Traumwelten zusammensetzt.
Die Entwicklung einer Individualität scheint unter diesen Umständen schwerlich möglich zu sein , da ein solches Bestreben in dieser Umwelt kaum einen Anhaltspunkt finden kann an dem es sich festsetzten bzw. auf dem es bauen könnte. Zu perfekt sind selbst die Ausweichzonen mit in das System eingegliedert. Die Umwelt ist durch den Konsumgedanken bereinigt, die Fast-Food-Restaurants sind keimfrei und der Abbau überschüssiger bzw. aufgestauter Energie wird in dem Sport- und Fittnesswahn der Gesellschaft vor allem in den Schulen, Studios und Highschools kanalisiert. Neue Ideologien können nicht entwickelt werden, alte werden nicht kennengelernt, denn zu verführerisch sind die beschriebenen Ablenkungsmöglichkeiten, die schon nicht mehr als Ablenkung, sondern als einzige Realität verstanden werden, sowie die noch nicht beschriebenen, wie das Fernsehen, das Internet oder Computerspiele bzw. -simulationen. In dieser perfekt simulierten und taktilen Welt scheint es keinen Ansatzpunkt mehr zugeben für begründete Kritik und so vollzieht sich der Protest referenzleer und sinnlos. Eric Harris und Dylan Klebold lebten lange Zeit diese Form der sinnlosen Gewalt in den Computersimulationen des Shoot´ em up-Genres aus, deren Rahmengeschichte die angewendete Gewalt nicht mehr wie in früheren Spielen moralisch ummantelt und rechtfertigt, sondern sie selbstreferentiell darstellt und fordert. Die These, daß diese Spiele als solches die eigentliche Ursache gewalttätigen Verhaltens sind, ist sicherlich kurzsichtig und zu eindimensional. Vielmehr sind sie nur Teil des beschriebenen Systems, ein selbstverständlicher Bestandteil mit der Zusatzfunktion, ähnlich der exzessiven sportlichen Betätigung, aufgestaute Energie zu kanalisieren und abzubauen. Moralische Werte verschwinden also nicht durch das Spiel in virtuellen Welten, sondern sind nie aufgebaut worden. Der Effekt dieser Spiele ist nicht gegen das System gerichtet in dem es sich gegen bestehende moralische Referenzen auflehnt, sondern im System integriert, um der Haltlosigkeit, Ungerichtetheit, Schwerelosigkeit aufgrund fehlender Basis und Orientierung scheinbar zu entkommen. Da diese Kanalisation jedoch nicht ausgereicht hat und schließlich zu dem Amoklauf führte ist die Perfektion, die Baudrillard uns vermitteln will, nicht vollkommen. Er selbst hat sich mit einem Phänomen auseinandergesetzt, welches sicherlich in seinen Sinne vergleichbar ist mit dem beschriebenen und das er unter dem Stichwort des "rechten Terrorismus" faßt und die angewendete Gewalt als "pure, die reine Gewalt, sinnlose Gewalt, also die reinste Form der Gewalt, gar nicht mehr determiniert, bzw. keine historische Gewalt mehr" ( Eckhard Hammel, Rudolf Heinz; Jean Baudrillard: Der reine Terror. Gewalt von rechts. Wien: Passagen Verlag, 1993 ) bezeichnet.
In Littleton haben wir also den Ausbruch dieser Form der Gewalt erlebt, die sich selbst hyperrealer Anachronismen aus dem Bereich der Mythologie und des Nationalsozialismus bediente, und durch ihre Sinn- und Referenzlosigkeit die Gesellschaft vor ein Rätsel stellt, daß diese nicht lösen kann und es versucht durch bekannte Schuldzuweisungen an die Rockmusik und die Computerindustrie. Der Anschlag in Littleton scheint so ein den Mördern unbewußter Anschlag auf die Hyperrealität gewesen zu sein, die diese vor viel größere Probleme stellt als politisch oder ideologisch motivierte Gewalt, da sie diese nicht in das System integrieren kann. Zumindest in diesem Zusammenhang kann man berechtigterweise von Hyperrealität sprechen, auch wenn es auch hier sicherlich keine absolute ist.
5. Anhang
Die Roboter
Die Roboter
Wir laden unsere Batterie
Jetzt sind wir voller Energie
Wir sind die Roboter
Ja tvoi sluga (=I'm your slave)
Ja tvoi Rabotnik robotnik (=I'm your worker)
Wir funktionieren automatik
Jetzt wollen wir tanzen mechanik
Wir sind die Roboter
Wir sind auf Alles programmiert
Und was du willst wird ausgeführt
Die Mensch Maschine
Die Mensch Maschine
Halb Wesen und halb Ding
Die Mensch Maschine
Halb Wesen und halb Überding
"Nein, ich kenne keinen Bill Gates,
und der Himmel kommt mir auch nicht komisch vor "
sagt eine Frau in einem Uli Stein Comic, deren Ehemann mit ihr
auf einer Wiese sitzend mißtrauisch-ängstlich in einen blauen Windows-Himmel blickt.
"Das in sich selbst bewegende Leben des Todes"
Hegel
6. Literaturverzeichnis
Baudrillard, Jean: Transparenz des Bösen : ein Essay über extreme Phänomene /- Berlin : Merve , 1992 .
Baudrillard, Jean: Cool memories : 1980 - 1985 / München : Matthes & Seitz , 1989 .
Baudrillard, Jean: Das System der Dinge : über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen / Frankfurt [u.a.] : Campus-Verl. , 1991 .
Baudrillard, Jean: Kool Killer oder Der Aufstand der Zeichen / Berlin : Merve-Verl. , 1978.
Baudrillard, Jean: Die fatalen Strategien / München : Matthes & Seitz , 1985 .
Baudrillard, Jean: Der symbolische Tausch und der Tod / Anh.: Baudrillard und die Todesrevolte / von Gerd Bergfleth . - München : Matthes & Seitz , 1982 .
Baudrillard, Jean: Agonie des Realen / aus d. Franz. übers. von Lothar Kurzawa ... - Berlin : Merve, 1978.
Baudrillard, Jean: Amerika / aus dem Franz. übers. von Michaela Ott. - München : Matthes & Seitz, 1987.
Baudrillard, Jean: Das perfekte Verbrechen / Aus dem Franz. übers. von Riek Walther München : Matthes und Seitz, 1996.
Kellner, Douglas: Baudrillard: a critical reader / Oxford [u.a.] : Blackwell , 1995 . - IX
Eckhard Hammel, Rudolf Heinz; Jean Baudrillard: Der reine Terror. Gewalt von rechts. Wien: Passagen Verlag, 1993.
Kreye, Adrian: "Amok in Suburbia" / Südeutsche Zeitung, Feuilleton.
Bohn, Ralf und Fuderer, Hrsg.: Baudrillard. Simulation und Verführung / München : Fink ,1994
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit über Jean Baudrillard?
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Kernteil des philosophisch-soziologischen Werkes von Jean Baudrillard. Ziel ist es, die wesentlichen Elemente darzustellen, zu überprüfen und praktische Bezüge unter besonderer Berücksichtigung des Feldes der Medien herzustellen sowie eine kritische Stellungnahme abzugeben.
Welche drei Simulakren werden in der Hausarbeit erläutert?
Die Hausarbeit erläutert die drei Simulakren: Imitation, Produktion und Simulation. Sie werden in chronologischer Reihenfolge beschrieben und erklärt.
Was versteht Baudrillard unter dem Zeitalter der Imitation?
Das Zeitalter der Imitation ist zeitlich zwischen Renaissance und industrieller Revolution einzuordnen. In dieser Zeit wurden Zeichen frei interpretierbar und abbildbar, waren aber noch Imitationen der Originale. Der Referenzhorizont blieb noch unangetastet, und die Zeichen repräsentierten eine Welt, die noch nicht von den Menschen manipuliert worden war.
Was kennzeichnet das Zeitalter der Produktion?
Das Zeitalter der Produktion beginnt mit der industriellen Revolution. Neue Zeichen, hergestellt durch mechanische Reproduktion, verlieren die Referenzsysteme Natur und Vernunft. Es entsteht eine Massenkultur, in der Geld als Zugangsberechtigung dient und die Zeichen austauschbar und ohne Tradition sind.
Was ist das Zeitalter der Simulation und was versteht Baudrillard unter Hyperrealität?
Das Zeitalter der Simulation wird durch die Revolution in der Informationstechnik ermöglicht. Wissen, Daten und Kultur können beliebig oft und schnell verarbeitet und kopiert werden. Die Grenzen zwischen Imaginärem und Realität verschwimmen, und die Zeichen verweisen nur noch auf sich selbst. In dieser referenzlosen Welt entsteht die Hyperrealität.
Welche Thesen der Hyperrealität werden in der Arbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Thesen der Hyperrealität: Macht und Hyperrealität im Bereich der Medien, Verschwinden des Menschen und das unendliche Ende bzw. der Leerlauf der Geschichte.
Wie wird die These vom Verschwinden des Menschen in der Hausarbeit behandelt?
Die These vom Verschwinden des Menschen wird anhand von Beispielen aus der modernen Musik (Karlheinz Stockhausen, Kraftwerk) und der Filmindustrie (computeranimierte Filme, apokalyptische Filme) erläutert.
Was bedeutet das "unendliche Ende" bzw. der "Leerlauf der Geschichte" nach Baudrillard?
Baudrillard beschreibt mit dem "unendlichen Ende" einen Zustand, in dem die Geschichte stillsteht bzw. rückwärtsläuft. Dies wird durch den ständigen Rückgriff auf bereits Vorhandenes (Recycling) ermöglicht, wodurch nichts Neues entsteht, sondern Altes wiedererschaffen und moduliert wird.
Welche Kritik wird an Baudrillards Theorien geübt?
Kritisiert wird vor allem Baudrillards Selbstreferentialität bzw. Referenzlosigkeit der Zeichen, die angebliche Ignoranz der Ausdifferenzierung der Gesellschaft und die absolute Darstellung der Hyperrealität. Viele seiner Aussagen werden als zu deterministisch und pauschalisierend empfunden.
Welche Rolle spielen die Medien in Baudrillards Konzept der Hyperrealität?
Die Medien erzeugen eine Bilderflut, die nicht länger visuell, sondern taktil sei. Durch Überinformation und Liveübertragungen werde eine Sinnentleerung erzeugt und eine Distanz zum Erlebten verhindert. Die Medien testen, modulieren und formen die Menschen, wobei nur die Ereignisse, die in den Medien stattfinden, wirklich stattfinden würden.
Inwiefern wird die Vorstellung der Gleichgültigkeit und Indifferenz durch die moderne Musik in den 70ern und 80ern und heutzutage durch Techno unterstrichen?
Karlheinz Stockhausen verarbeitete in seiner Musik Mathematik und Zufallsoperationen statt Lebendigkeit und Menschlichkeit, die Gruppe Kraftwerk versteckte sich hinter Robotern und gleichförmiger Kleidung. Die Techno- und Raveszene verzichtet auf Texte, entmenschlicht Stimmen und vergöttert DJs, deren Musik durch Drogen wie Ecstasy noch stärker aufgenommen werden soll.
Worin liegt Baudrillards Begründung für die Bedeutung des Recyclingsbegriffs für Flusser und Baudrillard?
Flusser sieht in dem Phänomen des Recyclings einen Wandel der Geschichte von einem univoken und eindimensionalen in einen zirkulären Prozeß. Während der Geschichtsbegriff bisher linear und ohne die Möglichkeit eines Feedbacks verstanden worden sei, eröffne die Wiederverwertung des Abfalls neue Perspektiven.
- Quote paper
- Malte Hegeler (Author), 1996, Das soziologisch-philosophische Werk von Jean Baudrillard, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95880