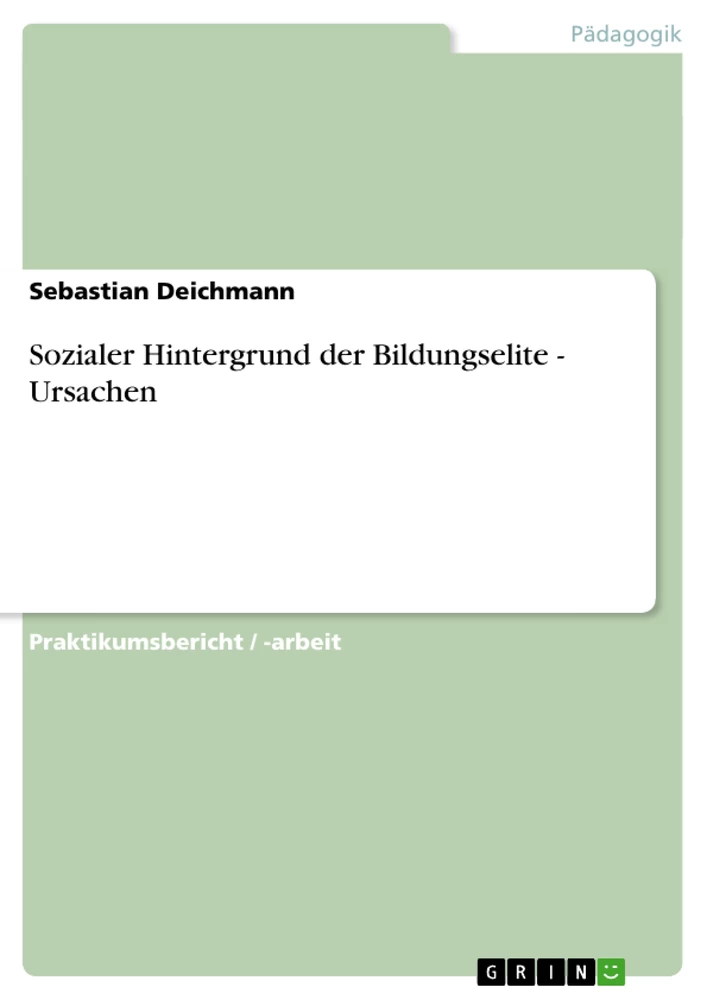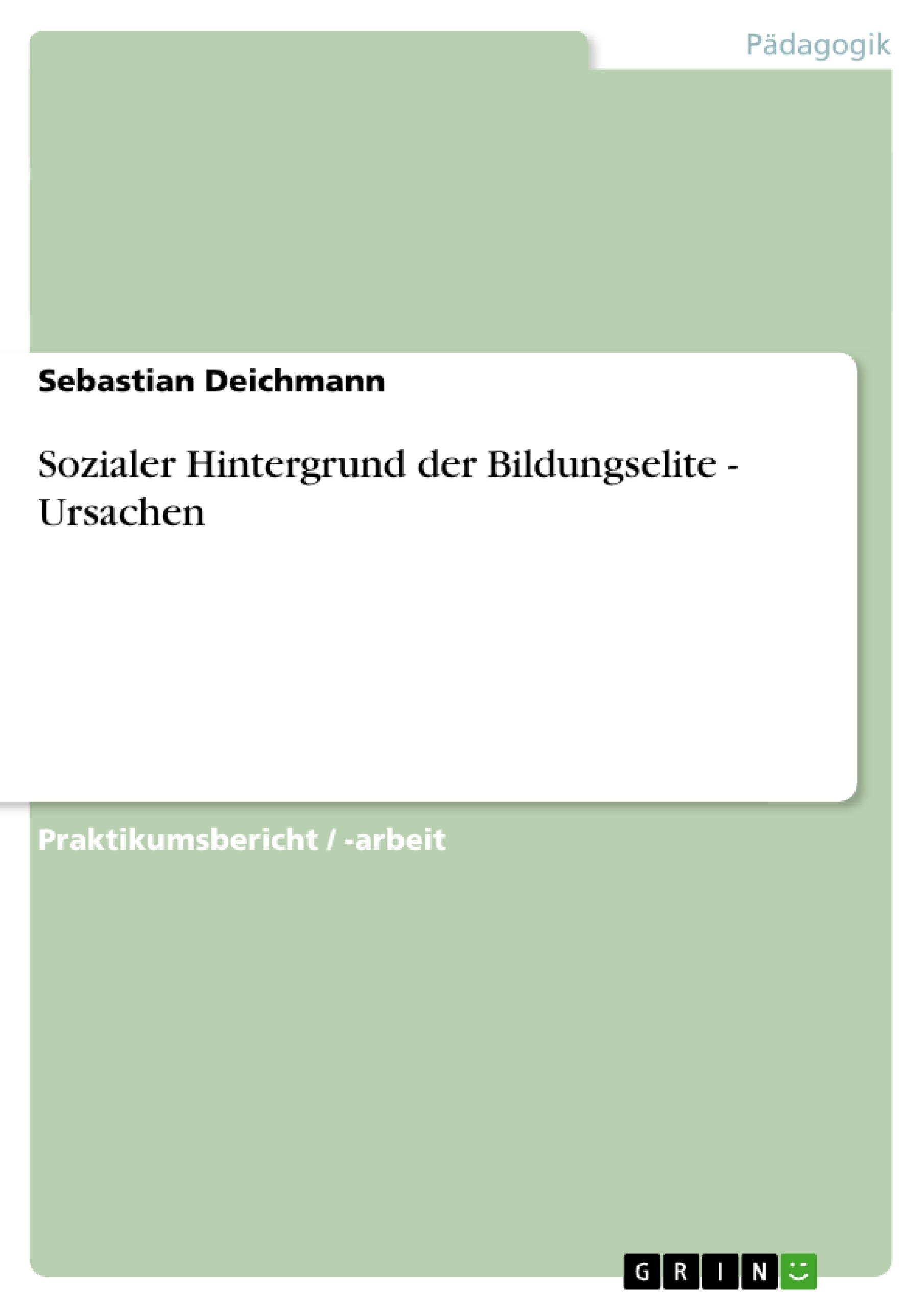Entdecken Sie die verborgenen Realitäten des Klassenzimmers! Tauchen Sie ein in eine fesselnde Erkundung der Wechselwirkungen zwischen sozialem Hintergrund und schulischem Erfolg, basierend auf den Erfahrungen eines Praktikums in einer deutschen Gesamtschule. Diese tiefgründige Analyse, angereichert mit Beobachtungen aus dem Unterricht einer 5. Klasse sowie eines Leistungskurses der 12. Klasse, enthüllt, wie sozioökonomische Umstände das Verhalten und die Leistungen von Schülern prägen. Von den Herausforderungen des Englischunterrichts mit begrenzten Ressourcen bis hin zu den komplexen Dynamiken des Politikunterrichts, der auf offene Lernformen setzt, werden die Schwierigkeiten und Erfolge im Umgang mit "schwierigen" Schülern schonungslos offengelegt. Der Bericht untersucht die Diskrepanz zwischen der Lebenswelt der Kinder und den bürgerlich geprägten Normen des Schulalltags, wobei der Fokus auf den sprachlichen Aspekten der Sozialisation liegt. Kritische Auseinandersetzung mit soziolinguistischen Theorien wie der Heriditäts-, Defizit- und Differenztheorie liefern neue Einblicke in die Ursachen ungleicher Bildungschancen. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen, die nicht nur Pädagogen, sondern auch Eltern und politische Entscheidungsträger dazu anregen, über die Gestaltung eines gerechteren Bildungssystems nachzudenken. Welche Rolle spielen die Erwartungen der Eltern, finanzielle Ressourcen und die subtilen Vorurteile der Lehrer bei der Weichenstellung für die Zukunft junger Menschen? Lassen Sie sich von dieser ebenso provokativen wie erhellenden Analyse dazu anregen, Ihre eigenen Annahmen über Bildung und soziale Gerechtigkeit zu hinterfragen. Schlüsselwörter: Schulpraktikum, soziale Ungleichheit, Bildungschancen, Soziolinguistik, Defizittheorie, Differenztheorie, Gesamtschule, Unterrichtserfahrung, Schülerverhalten, soziale Herkunft, Pädagogik, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, Bildungssystem, Klassenzimmer, Lehrerrolle, Erziehung, soziale Kompetenz, soziale Unterschiede, Lernverhalten, schulischer Erfolg, Jugendarbeit, soziale Arbeit, Lehrerbildung, Unterrichtsmethoden, soziale Kompetenzen, Schulerfolg, soziale Probleme, soziale Faktoren, Bildungspolitik, Schulsozialarbeit, soziale Integration, soziale Benachteiligung, Sprachentwicklung, Erziehungswissenschaft, Verhaltensauffälligkeiten, soziale Ausgrenzung, soziale Herkunft, sozialer Status, soziale Mobilität, Sprachförderung, Bildungschancen, Unterrichtsanalyse, Unterrichtsgestaltung, soziale Interaktion, Lernerfolg, soziale Unterstützung, soziale Ungleichheit im Bildungswesen, Bildung und soziale Gerechtigkeit, soziale Determinanten des Schulerfolgs, Praktikumsbericht, Unterrichtsbeobachtung, Schulalltag, Schülerpersönlichkeit, Lehrer-Schüler-Beziehung, soziale Verantwortung, soziale Gerechtigkeit in der Bildung, Benachteiligung, soziale Ungleichheit, Bildung, Kindheit, Jugend, Gesellschaft, Erziehungswissenschaft, Bildungswesen, soziale Gerechtigkeit, soziale Ungleichheit, Bildungspolitik, Bildungschancen, Chancengleichheit, soziale Herkunft, soziale Lage, soziale Mobilität, soziale Integration, soziale Ausgrenzung, Armut, Reichtum, Bildungssystem, Schulsystem, Unterricht, Lernen, Lehrer, Schüler, Eltern, Familie, Kindheit, Jugend, Gesellschaft, Erziehung, Erziehungswissenschaft, Pädagogik, Soziologie, Psychologie, Linguistik, Sprachwissenschaft, Sprachförderung, Sprachkompetenz, Kommunikation, Interaktion, soziale Kompetenz, Konfliktlösung, Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen, soziale Probleme, soziale Arbeit, Jugendarbeit, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Jugendhilfe, Jugendamt, Bildungsberatung, Erziehungsberatung, Familienberatung, Schulberatung, Karriereberatung.
Inhalt
Einleitung
Unterrichtserfahrungen
Englisch
Ausgangsbedingungen und Vorüberlegungen
Meine erste Englischstunde
Auswertung
Politik
Ausgangsbedingungen und Vorüberlegungen
Der Unterricht
Auswertung
Die 12. Klasse
Beobachtungsschwerpunkt
Zur Begründung
Verhalten
Ursachen
Konsequenzen für den Umgang mit S
Theoretische Erörterung des Zusammenhangs von sozialem Hintergrund und schulischem Verhalten (bzw. Erfolg)
Sozio-linguistische Ansätze
Heriditätstheorie
Defizittheorie
Differenztheorie
Schlußfolgerungen
Quellen
Einleitung
Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung meiner Erfahrungen aus dem Schulpraktikum vom 8.2. bis zum 5.3.1999. Ich habe mein ISP an der Julius-Leber Gesamtschule gemacht. Dort habe ich, zusammen mit einer anderen Praktikantin (Carolin), den Politik- und den Englischunterricht einer 5. Klasse begleitet und mitgestaltet. Außerdem habe ich den Unterricht eines Geschichte Leistungskurses (Jahrgangsstufe 12) begleitet. Ich habe darauf verzichtet in der 12. Klasse zu unterrichten, da der geringe Altersunterschied zu Problemen hätte führen können. Außerdem halte ich meine fachliche Kompetenz im Fach Geschichte noch für unzureichend, um eine Klasse der Jahrgangsstufe 12 zu unterrichten. Aus diesem Grund werde ich von meinen Unterrichtserfahrungen in der fünften Klasse berichten, und mich bei der zwölften Klasse auf Beobachtungen beschränken. Dabei werde ich vor allem auf pädagogische Unterschiede zwischen dem Unterrichten einer fünften Klasse und einer Oberstufenklasse eingehen. Mein Beobachtungsschwerpunkt war a) der soziale Hintergrund von - und b) der Umgang mit „schwierigen“ SchülerInnen (bzw. von SchülerInnen mit Schwierigkeiten). Ich habe mir aus diesem Grund das Verhalten des „auffälligsten“ Schülers der fünften Klasse angeschaut. Mein Beobachtungsschwerpunkt war allerdings unfruchtbarer, als ich mir erhofft hatte. Aus diesem Grund werde ich meinem Beobachtungsschwerpunkt in diesem Bericht weniger Raum einräumen als eigentlich vorgesehen war. Im theoretischen Teil werde ich mich hauptsächlich auf den ersten Teil der Fragestellung konzentrieren : Welchen sozialen Hintergrund haben „schwierige“ SchülerInnen im allgemeinen, bzw. warum haben SchülerInnen mit einem bestimmten Hintergrund mehr Schwierigkeiten in/mit der Schule als andere?
Aus Datenschutzgründen werde ich die Namen der SchülerInnen (und der LehrerInnen) durch Großbuchstaben ersetzen. Um eine Unterscheidung zwischen weiblichen und männlichen Schülern zu ermöglichen, werde ich an die abgekürzten Mädchennamen zudem mit einem „i“ versehen.
Unterrichtserfahrungen
Englisch
Ausgangsbedingungen und Vorüberlegungen
Leider war Herr W.(der Klassenlehrer) während der ersten Woche des Praktikums krank. Darum konnten wir (Carolin und ich) nicht langsam in den Unterricht einsteigen und erst einmal mit Herrn W zusammen unterrichten. Ich hatte jedoch bereits vor dem Praktikum, während des Englischunterrichts, in Herrn W´s Klasse (5a) hospitiert und auch schon einen Ausflug mit der Klasse gemacht. Darum war mir die Klasse und ich der Klasse bereits bekannt. Es handelte sich um eine Klasse, die unter vielen der LehrerInnen als schwierig galt. Ich hatte aber mit einigen SchülerInnen (vor allem mit den auffälligeren) schon Gespräche geführt und eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut. Erleichternd kam hinzu, daß die Kinder erst seit Beginn des 5. Schuljahres (also ca. seit einem halben Jahr) Englischunterricht hatten. Daher hatten sie ein recht großes Interesse an diesem Fach. Bei keinem der SchülerInnen hatte sich Resignation eingestellt, da noch niemand während der kurzen Zeit den Anschluß verlieren konnte. Eine solche Haltung hätte sicherlich zu mehr Unruhe in der Klasse geführt.Da aber alle wenigstens ein wenig Interesse und Spaß an dem Fach hatten, waren nicht so viele Unterrichtsstörungen zu erwarten, wie beispielsweise in Mathematik. Nichtsdestotrotz mußten wir mit sehr beschränkter Konzentrationsfähigkeit rechnen, da es Schülern der fünften Klasse noch an Selbstdisziplin mangelt. Darum waren beispielsweise die 5./6. Stunden anders zu planen als frühere Stunden. Zudem war bei Doppelstunden auf Abwechslungsreichtum bei den Lehrmethoden zu achten, um ein durchgehendes Interesse der SchülerInnen am Unterrichtsgeschehen zu gewährleisten. Außerdem waren ihre Englischkenntnisse auch noch sehr beschränkt. Dadurch waren bestimmte Probleme zu erwarten:
1) Da wir keinen Überblick über ihren derzeitigen Vokabelstand hatten, konnten wir nicht immer einschätzen, inwieweit sie englische Arbeitsanweisungen verstehen würden.
2) Kleinste Abweichungen von der englischen Aussprache würden zu Verwirrung führen
(z.B. bei can´t, love, dance oder anderen Worten, bei denen die u.s.-amerikanische
Aussprache von der englischen abweicht).
3) Es würde notwendig werden möglichst geschickt alles zu umgehen, das eine andere Zeit als Präsens (oder Verbveränderungen im Präsens) erfordert - sowohl bei dem was wir von uns geben, als auch bei dem was wir den SchülerInnen abverlangen.
4) Wenn es notwendig würde, Partizipien zu benutzen, sollte das nicht als andere Form des Infinitivs, sondern als neue Vokabel eingeführt werden (z.B. was - war; went - ging) Wir sprachen uns mit Herrn W ab, ließen uns den aktuellen Stand der Klasse und die Aufgaben und Lehrinhalte für die Zeit unseres Praktikums mitteilen.
Die Klasse arbeitete schon längere Zeit (seit dem 11. Januar) an einer Mappe - ihrem Portfolio. In diesem Portfolio sollten sie, nach und nach, eine Selbstdarstellung anfertigen. Diese Selbstdarstellung sollte mit Bildern und Fotos ergänzt werden. Jedes Thema, welches im Unterricht behandelt wurde, sollte in die Mappe einfließen (z.B. “my room”, “my hobbies”, “my family” usw. usf.). Auf diese Weise sollte zum einen das selbständige Lernen geübt werden und zum anderen sollten die Schüler erste eigene Texte auf englisch verfassen. Dadurch waren sie gezwungen, gewisse Vokabeln herauszusuchen und englische Sätze zu formulieren. Das bedeutet, daß sie ein Erfolgserlebnis haben und zudem ein gewisses Eigeninteresse daran entwickeln, bestimmte Vokabeln zu kennen. Positiv an diesem Portfolio ist zudem, daß die Unterrichtsinhalte mit der Lebenswelt der Kinder verbunden werden, so daß keine Distanz zwischen dem Unterrichtsstoff und dem Alltag der Schüler entsteht (bzw. keine größere als nötig). Ferner gab dieses Portfolio auch die Möglichkeit, schnellere Schüler still zu beschäftigen, oder die ganze Klasse still arbeiten zu lassen und die SchülerInnen einzeln zu betreuen. Auf diese Art und Weise ist es besser möglich, auf spezifische Probleme einzelner Schüler einzugehen (jedenfalls mit zwei Lehrpersonen oder angemessenen Klassengrößen).
Das primäre Lernziel bestand in der Vermittlung eines möglichst umfangreichen Wortschatzes, um eine Basis für das Nahebringen der Zeiten zu haben (womit Herr W schon im Verlauf dieses Schuljahres zu beginnen plant). Die LehrerInnen der fünften Klassen haben für diesen Zweck einen Vokabelordner für jeden Schüler hergestellt und gehen nicht nach den Vokabellektionen des Buches vor. Trotzdem ist diese Mappe natürlich am Buch orientiert, um die Arbeit mit dem Lehrbuch zu ermöglichen. In regelmäßigen Abständen werden Vokabeltests durchgeführt.
Meine erste Englischstunde
Die erste Stunde unterrichtete ich mit Carolin gemeinsam. Im Prinzip begannen wir mit einer Vertretungsstunde, da Herr W, wie erwähnt, krank war. Außer uns waren aber noch die zweite Klassenlehrerin (Frau H) und zwei andere PraktikantInnen anwesend. Diese haben allerdings niemals in unseren Unterricht eingegriffen, sondern waren lediglich Beobachter. Trotzdem ist anzunehmen , daß die Anwesenheit von Frau H ein wenig für Disziplin gesorgt hat. Die Klasse hatte als letzes das Thema Haustiere bearbeitet, und die letzte Vokabeleinheit, die sie gelernt hatten, gehörte zu diesem Themenbereich.
Wir hatten mit Herrn W besprochen, welche Aufgabe im Workbook (zum Lehrbuch gehörendes Arbeitsheft) angemessen wären. Wir beschlossen, die Stunde mit einem Quiz zu beginnen. Jeweils ein/e SchülerIn sollte nach vorne kommen und vor der Klasse sein/ihr Lieblingstier beschreiben (z.B. “my favorite animal is black...”). Die anderen SchülerInnen sollten erraten, welches Tier gemeint ist.
Die SchülerInnen waren sichtlich gespannt, als wir die Klasse betraten. Es war schnell klar, daß sie versuchen würden, Grenzen auszuloten ( T:”Wir machen euch fertig.”; Frage an Frau H :”Können die das überhaupt?” ; als wir am Stundenanfang auf die letzten Nachzügler warteten - S:”Sorgt doch mal für Ruhe - oder könnt Ihr das etwa nicht?”). Als wir dann begonnen haben, kam es zu keinerlei Autoritätsproblemen. Da wir die meisten Namen kannten, konnten wir Störer gezielt ansprechen und damit für Ruhe sorgen. Das war allerdings sehr selten nötig.
Das Quiz kam nur sehr schleppend in Gang. Wir haben beide je einmal exemplarisch vorgeführt, wie man Tiere beschreiben kann. Das war nicht ausreichend. Wir hätten besser ein Beispiel vorführen und jeden Satz davon übersetzen sollen. Trotz dieses Fehlers war die ganze Klasse sehr interessiert. Es herrschte Ruhe, da jeder verstehen wollte, was da gerade für ein Tier beschrieben wird. In späteren Stunden wurden wir oft darum gebeten, dieses Quiz zu wiederholen.
Die Stillarbeit verlief auch recht ruhig. Wir ließen ihnen die Wahl entweder die Aufgabe im Workbook zu lösen oder eine Seite zu Haustieren in ihren Portfolio zu gestalten. Der Rest sollte Hausaufgabe sein. Zu zweit war es uns beiden recht gut möglich, die SchülerInnen während der Stillarbeit zu betreuen. Wir waren allerdings trotzdem beide stark ausgelastet. An dieser Stelle war es sehr positiv, daß wir zu zweit waren.
Auswertung:
Es war uns gut gelungen die Aufmerksamkeit der SchülerInnen zu fesseln. Unser “teamteaching” hat gut funktioniert, auch wenn wir in späteren Stunden genauer besprochen haben, wer wann die aktive Rolle in der Klasse spielt.
Probleme
1) Es bereitete mir Schwierigkeiten, immer nur die englische Aussprache zu verwenden (z.B. bei „can´t“).
2) Später wurde ich von anderen Praktikanten auf meine Haltung hingewiesen. Ich hatte während des Unterrichts meine Hände in die Taschen gesteckt. Mir selbst war das nicht aufgefallen. In späteren Unterrichtsstunden habe ich das aber korrigiert, und deswegen bemerkt, wie häufig ich diese Angewohnheit bekämpfen mußte. Solche „Kleinigkeiten“ können durchaus eine unterbewußte Wirkung auf die SchülerInnen haben, da man u.a. durch die Körpersprache, eine gewisse Stellung zur Schau trägt. Ich bin jedoch der Meinung, daß sich solche Mängel in der Körpersprache relativ leicht durch andere Verhaltensweisen kompensieren lassen (wenn man einmal seine Autorität bei den SchülerInnen gefestigt hat, kann man auch die ganze Stunde die Hände in den Taschen haben). Gestik spielt eher für die ersten Einschätzungen eine größere Rolle.
3) Während der Stillarbeit, benutzte ich teilweise eine sehr lapidare Ausdrucksweise. Das führte teilweise zu Irritation und auch zu Spott. Eine eigentlich überraschende Reaktion, da die meisten SchülerInnen diese Ausdrucksweise selbst benutzen oder sie von zu Hause kennen. Sie erwarten aber von einer Lehrperson, daß sie die Hochsprache benutzt. Ich werde darauf noch einmal im theoretischen Teil eingehen.
4) Mein Schriftbild an der Tafel ist ein wenig unstetig. Da brauche ich noch etwas Übung In den folgenden Englischstunden haben wir uns vorher gezielter abgesprochen. Nachdem Herr W gesund war, haben wir uns den Unterricht zu dritt geteilt. Viele Beobachtungen aus der ersten Stunde haben sich bestätigt. Ich hatte in keiner der Englischstunden mit Disziplinproblemen zu kämpfen. Während einer Englischstunde am 17.2. war es zwar ein wenig unruhig, der Unterricht wurde aber nicht empfindlich gestört. Wir erfuhren nach der Stunde, daß die Klasse in allen früheren Stunden viel schwieriger war. Ich glaube, daß die Vertrauensbasis, die wir in der Klasse aufgebaut haben, im wesentlichen für die Durchsetzung unserer Autorität verantwortlich war. Wir waren zwar nie allein mit der Klasse, aber ich habe auch einmal den Mathematikunterricht von zwei anderen Praktikantinnen beobachtet. Trotz Frau H´s Anwesenheit herrschte sehr schnell totale Anarchie. Das war nicht das erste Mal, daß eine Mathematikstunde der beiden so endete, wie sie mir im Anschluß berichteten. Ich schließe daraus, daß es nicht die Anwesenheit der Lehrer war, die die SchülerInnen in unserem Unterricht ruhig gehalten hat.
Ich habe sehr gezielt bei Herrn W. beobachtet welche Strafmaßnahmen wann benutzt wurden, und wie sie gewirkt haben. Herr W schickt entweder störende SchülerInnen vor die Tür, oder er droht die Namen der Störer zu notieren, und dem, der dreimal gestört hat, eine Strafarbeit zu verpassen. Diese Drohung stieß er auch einmal aus während ich die Klasse allein unterrichtete(25.2.). Für mich kam sein Eingreifen überraschend früh, da ich selbst mich noch nicht gestört fühlte. Ich war allerdings auch schon mehr als ausgelastet, denn ich war damit beschäftigt, den Überblick zu behalten und gleichzeitig allein zu unterrichten. Der Auslöser für Herrn W´s Drohung war, daß einige Schüler ohne Handzeichen geantwortet hatten. Mir erschien dieses Fehlverhalten, keine so drakonischen Maßnahmen zu erfordern da man meiner Meinung nach, zwischen aktiven Stören und „sozialem Fehlverhalten“ differenzieren muß. Ich muß allerdings eingestehen, daß es beim „Reinrufen“ um ein generelles Problem geht, welches auf Dauer die Gleichbehandlung der SchülerInnen gefährdet. Trotzdem sollte man auf verschiedenes Fehlverhalten der Schüler auch unterschiedlich reagieren. Man könnte beispielsweise eine Namenliste aufhängen und entfernbare Striche für „Dazwischenrufen“ verteilen. Die Strafe könnte dann etwa angkündigtes Ignorieren von Meldungen sein (verbunden mit dem Verschwinden eines Strichs), oder die Verpflichtung für denjenigen, der am Ende der Woche am meisten Striche hat, etwas für die ganze Klasse zu besorgen. So würde den SchülerInnen evtl. besser bewußt gemacht werden, daß „Reinrufen“ die Chancen der anderen mindert, daß es sich also mehr um ein Vergehen gegen die Klasse als „gegen“ den Lehrer handelt.
Um Ruhe zu schaffen, sollte man auch versuchen, Bewußtsein dafür zu schaffen, daß es für alle einen Nachteil bedeutet, wenn einzelne laut sind. Bei einigen SchülerInnen, die vor die Tür geschickt werden, mag das noch zum Nachdenken über das eigene Verhalten führen. Wenn aber schwierige SchülerInnen jeden Tag vor die Tür geschickt werden, wird es für sie zum Normalzustand. Eine Alternative wäre evtl., die SchülerInnen selbst vor die Wahl zu stellen : „Dein Verhalten hindert dich selbst und andere am Lernen. Wenn du glaubst, das in den Griff bekommen zu können - bleib hier; ansonsten geh lieber mal 5 Minuten spazieren und komm wieder, wenn du dich wieder konzentrieren kannst.“. Allerdings gäbe das wieder Probleme mit der Aufsichtspflicht. Außerdem kann ich nicht entscheiden, ob man einem Lehrer zumuten kann, immer wieder die Ruhe zu bewahren und die SchülerInnen vor die Wahl zu tellen. Bei zu häufiger Benutzung wird sich wahrscheinlich auch der Wirkungsgrad senken, oder es wird bewußt von den SchülerInnen ausgenutzt werden. Zum häufigeren Gebrauch einsetzbar, halte ich die Methode des Umsetzens von SchülerInnen, die stören. Sie werden damit von der Person getrennt, mit der sie zusammen herumalbern oder sich unterhalten haben. Damit werden sie vorerst gezwungen, sich wieder auf das Unterrichtsgeschehen zu konzentrieren. Eine andere, sehr vielversprechende Methode, finde ich das „an die Tafel Holen“ von Störern. Diese werden damit relativ lange von dem abgelenkt, mit dem sie sich vorher beschäftigt haben. Deshalb werden sie wahrscheinlich auch nicht noch mal damit anfangen. Man sollte es aber nicht darauf anlegen, den/die SchülerIn vor der Klasse bloßzustellen. Vielmehr sollte es eine gewöhnliche Maßnahme für die SchülerInnen werden. Ihnen wird dabei direkt vor Augen geführt, welchem Zweck die Strafe dient: Sie bekommen die Möglichkeit, das eben Verpaßte nachzuholen. Zwar ist auch diese Methode nicht jede Stunde beliebig oft anwendbar, einmal etabliert und mit den anderen Möglichkeiten kombiniert bietet sie aber, meines Erachtens, eine sehr gute Möglichkeit, Ruhe in die Klasse zu bekommen, ohne Strafarbeiten verteilen zu müssen.
Politik
Ausgangsbedingungen und Vorüberlegungen
Im Politikunterricht wollten wir offene Unterrichtsformen benutzen. Während unserer Praktikumszeit sollte das Thema Naturkatastrophen behandelt werden. Das sollte in Form eines kleinen Projekts geschehen. Die SchülerInnen sollten in kleinen Gruppen (zwei bis drei) einen Text zu einem bestimmten Themenbereich aus verschiedenen Büchern heraussuchen, durcharbeiten und den anderen präsentieren. Hierfür gab es eine Bücherkiste aus der Bücherhalle, welche wir im voraus schon durchgearbeitet hatten. Die meisten Bücher waren etwa auf der Schwierigkeitsstufe von „Was ist Was“- Büchern. Die SchülerInnen hatten vorher bereits ein ähnliches Projekt mit dem Namen „Kinder der Welt“ durchgeführt. Dabei haben sie schon einmal Informationen aus einem Buch ziehen müssen, um sie der Klasse zu präsentieren. Diese beiden Fertigkeiten (selbständig mit Büchern arbeiten, freie Referate nur mit Stichwortzetteln halten) sollten auch bei unserem Projekt gezielt gelehrt werden. Inhaltlich sollten verschiedene Naturkatastrophen, ihre Erscheinungsformen und ihre Ursachen erklärt werden. Außerdem sollten die SchülerInnen die möglichen Gegenmaßnahmen kennenlernen.
Wir hatten den Verlauf des Projekts folgendermaßen geplant :
1) die SchülerInnen sollten sich in Gruppen von 1 - 3 SchülerInnen zusammenfinden
2) Jede Gruppe sollte sich Bücher aus der Kiste heraussuchen, und sich damit auf ein Thema festlegen (Erdbeben, Vulkane, Stürme, Sturmfluten/ Flutkatastrophen)
3) Jede/r SchülerIn sollte drei bis fünf Seiten in ihrem/seinem Heft mit dem Thema der Gruppe gestalten
4) die ganze Gruppe sollte für den Rest der Klasse ein Referat mit Hilfe eines selbst hergestellten Stichwortzettels halten um
a) zu lernen Referate frei zu halten und
b) den Rest der Klasse über ihr Thema zu informieren
Als Hilfe habe ich ein Arbeitsblatt erstellt, auf dem Leitfragen zu den verschiedenen Themenbereichen zu finden waren (Anlage A). Das sollte den SchülerInnen helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Im Normalfall hätten wir drei Wochen Politik mit jeweils 3 Stunden/Woche zur Verfügung gehabt (Freitag - eine Doppelstunde, Montag - eine Einzelstunde).
In der Praxis hatten wir sehr viel weniger Zeit. Da Herr W in der ersten Woche krank war, an einem Freitag nur die Hälfte der Klasse da war und ein Freitag ganz ausgefallen st, hatten wir praktisch nur drei Einzelstunden zur Verfügung.
Der Unterricht
In der ersten Stunde suchten sich die SchülerInnen ein Buch aus und bildeten Gruppen (fast alle entschieden sich für Gruppenarbeit). Einige suchten ziellos in den Büchern umher, andere versuchten schon in dieser Stunde erste Ergebnisse zu erarbeiten. Wir haben das Arbeitsblatt verteilt. Einige Schüler haben sich an den Leitfragen orientieren können und haben sie nacheinander abgehandelt. Viele waren aber mit dem Arbeitsblatt überfordert („soll ich das jetzt abschreiben, oder was?“). Wir hätten vielleicht zu jedem Thema ein Arbeitsblatt machen sollen, so daß jede/r nur die Leitfragen seines/ihres Themas vor sich hat. Vielleicht hätten wir auch das gesamte Arbeitsblatt im Klassenverband gemeinsam lesen und noch einmal gemeinsam den Arbeitsauftrag besprechen sollen, damit alle in der nächsten Stunde Bescheid wissen, was zu tun ist.
Die nächste Stunde fand eine Woche später statt. Es gab etwa 12 SchülerInnen die annehmbare Ergebnisse vorweisen konnten (also nur etwa die Hälfte der Klasse). Für die meisten anderen stellte die Aufgabe, Informationen aus einem Fließtext zu filtern, ein großes Problem dar. Außerdem hatten selbst am Ende dieser Stunde noch nicht alle verstanden, welcher Teil des Arbeitsblattes für sie wichtig war.
Herr W zog die Konsequenz, die Arbeitsweise sei zu schwierig und zu langwierig. Deswegen sollte das Projekt abgebrochen und noch ein wenig Stoff mit Hilfe von „Vor-Kopf-Unterricht“ vermittelt werden.
Die letzte Stunde des Projekts wurde dafür genutzt, noch in Stillarbeit die Mappen zu gestalten. In dieser Stunde half ich dem schwächsten Schüler der Klasse dabei, seinen dritten(!) Satz zu formulieren. Die Referate wurden aus Zeitgründen ganz gestrichen.
Auswertung
Ich denke, daß wahrscheinlich wenig Inhaltliches von diesem Thema hängenbleiben wird. Hätten die SchülerInnen alle 9 Stunden an dem Thema gearbeitet, wäre wahrscheinlich mehr davonin ihrem Gedächtnis geblieben. Ich bin aber der Meinung, daß der Inhalt, im Vergleich mit dem Erlernen des Verfahrens, beinahe unbedeutend ist. Die SchülerInnen können sich ständig alle Informationen über jedes Thema besorgen, wenn sie nur lernen, wie man an Informationen gelangt. Gerade das viele daran gescheitert sind, relativ frei Informationen zu einem Thema zusammenzustellen zeigt, daß sie gerade diese Fertigkeit erlernen müssen. Nur das Erlernen solcher Fertigkeiten ermöglicht es später allen SchülerInnen (auch denen, die nicht studieren), sich selbst weiterzubilden. Das ist für ihr Leben wesentlich wichtiger, als die Information welcher Vulkan der höchste und welcher Wirbelsturm der schlimmste war. An dieser These werde ich im folgenden auch alle Alternativmodelle messen, die es evtl. gegeben hätte.
Zum ersten wären da natürlich die Verbesserungen der Vorgehensweise, die ich bereits weiter oben angeführt habe (getrennte Arbeitsblätter; ausführlicheres Einführen in die Aufgabe). Damit hätte man den Unterschied bei den Ausgangsbedingungen zwischen schwachen und starken SchülerInnen ein wenig kompensieren können.
Wir haben dann noch folgende Alternativmodelle angedacht :
1. - Man hätte ein einfaches Arbeitsblatt mit einem Lückentext machen können. Dadurch wären aber sicher einige der starken SchülerInnen unterfordert gewesen. Außerdem hätte man mit dieser Maßnahme die SchülerInnen nicht näher an eine selbständige Arbeitsweise herangeführt. Für die einfache Vermittlung von Informationen wäre dieses Verfahren allerdings gut gewesen.
2. - Die andere Möglichkeit wäre gewesen, zunächst im Klassenverband die einzelnen
Themenbereiche (und die Aufgabe) vorzustellen, und daraus vier Gruppen entstehen zu lassen. Diese Gruppen hätten dann alle Bücher zu ihrem Thema zur Verfügung gestellt bekommen. Das hätte große Anforderungen an die Gruppen bedeutet, da sie hätten lernen müssen, sich in einer so großen Gruppe ( 5 -8 ) zu koordinieren. Das hätte sicher einige Zeit in Anspruch genommen (zu Lasten des Inhaltlichen). Es wäre wahrscheinlich auch für uns sehr viel anstrengender gewesen, aber die SchülerInnen hätten sicherlich daraus gelernt. Da es nur vier Gruppen gegeben hätte, wären wir zu dritt fast in der Lage gewesen, jede Gruppe permanent zu betreuen, und ihnen Tips zur Vorgehensweise zu geben. Wahrscheinlich hätten wir viele Probleme für sie gelöst (z.B. welche Untergruppen sich mit was beschäftigen), aber ich denke, sie hätten sich trotzdem erst einmal mit diesen Verfahrensfragen beschäftigt. So hätte man auch noch Einfluß auf den Inhalt der Referate nehmen können. Vielleicht hätte man auch mit einigen für das Referat üben können. Zum Erlernen von Fertigkeiten wäre diese Vorgehensweise also sinnvoller gewesen. Sie wäre aber, wegen des Zeitmangels, nur schwerlich umsetzbar gewesen.
Die zwölfte Klasse
Ich war erst nach Herrn W´s Genesung mit ihm in seinem Geschichts Leistungskurs. Der Kurs war wesentlich kleiner als die 5a ( ca. 15 SchülerInnen ).
Der entscheidendste Unterschied war wohl die Art und Weise, in der die SchülerInnen in die Unterrichtsgestaltung einbezogen werden konnten. Herr W hat beispielsweise viel häufiger mit Fragen gearbeitet als in der fünften Klasse. Die SchülerInnen waren viel eher in der Lage Antworten zu geben oder Diskussionsbeiträge zu machen, die auch den Rest der Klasse weiterbringen. Außerdem schien das Ziel eher zu sein, bestimmte Überlegungen durch bestimmte Fragen zu provozieren. Bei Jüngeren arbeitet der Lehrer eher mit konkreten Arbeitsanweisungen. Von der Klasse kommen aber auch viel mehr Beiträge, mit denen der Lehrkraft sich erst einmal inhaltlich auseinandersetzen muß. In der fünften Klasse muß der/die LehrerIn eher darüber nachdenken, welche Informationen auf welche Art und Weise an die Klasse weiterzugeben sind. Es sind viel größere pädagogische Kompetenzen gefragt. Das wird noch dadurch verstärkt, daß die SchülerInnen der zwölften Klasse schon viel mehr Selbstdisziplin haben als die der fünften Klasse. Darum ist es fast nicht nötig, die SchülerInnen zu ermahnen, ruhig zu sein und dem Unterrichtsgeschehen zu folgen. Wenn es nötig wurde, waren nie disziplinarische Maßnahmen nötig. Herr W ist nur einmal sehr laut geworden, als ein Schüler zu spät aus der Pause kam, und dann noch einen Scherz machte (der sich aber nicht auf seine Verspätung bezog). Ich halte es bei Menschen diesen Alters für unnötig, die eigene Autorität auf diese Art und Weise durchzusetzen. Die SchülerInnen sind für vernünftige Argumente offen, und es ist daher sehr leicht zu erklären, wo warum die Grenze ist. In einer Oberstufenklasse findet man fast keine „schwierigen“ SchülerInnen, mit denen ein anderer Umgang nötig wäre.
Ein anderer Aspekt der Einbeziehung der Schülerschaft bei der Unterrichtsgestaltung ist die Planung. Herr W hat beispielsweise die Schwerpunktsetzung für das nächste Halbjahr mit der Klasse diskutiert. Außerdem haben die SchülerInnen eine Diskussion um das Bewertungsschema begonnen (wie wichtig ist das anstehende Referat für die schriftliche Note?).
Die Unterrichtsatmosphäre unterscheidet sich natürlich auch deutlich zwischen der zwölften und der fünften Klasse. Insbesondere das Verhältnis zwischen LehrerIn und SchülerInnen. Es gab z.B. am Anfang der Stunde oft ein lockeres Gespräch, welches, anders als in der fünf, ein Gespräch zwischen gleichberechtigten Gesprächspartnern war. Diese Atmosphäre muß man sicherlich als LehrerIn erst einmal schaffen. Dann hat man aber eine Beziehung aufgebaut, die Strafe unnötig macht, da man sehr gut an die SchülerInnen herankommt, und diese daher viel mehr auf die Meinung des Lehrkörpers geben.
Die fachlichen Anforderungen an den Lehrer sind in einer Oberstufenklasse also höher, die pädagogischen Anforderungen sind dafür geringer. Das liegt sicherlich auch am Alter, ein nicht unwesentlicher Teil mag aber auch in der sozialen Zusammensetzung von Oberstufenklassen zu suchen sein. Es gibt heutzutage sehr wenige Untersuchungen zur sozialen Zusammensetzung von Oberstufen. Allerdings gibt es Zahlen zur sozialen Zusammensetzung von Universitäten, und das läßt sich ja auf die schulischen Vorläufer der Universitäten herunterbrechen. Nach diesen Untersuchungen schaffen nur 33% der Arbeiterkinder den Schritt zur Oberstufe (s.u.). Ich habe zwar nicht recherchiert; welche Berufe die Eltern der einzelnen SchülerInnen der zwölften Klasse hatten, meine Einschätzung ist aber, daß fast alle mindestens mittelständische Eltern hatten. Der einzige Schüler; bei dem ich das nicht denke, war im Begriff das Schuljahr zu wiederholen.
In der fünften Klasse einer integrierten Gesamtschule wird der soziale Hintergrund der SchülerInnen eher die reellen gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln (wobei die geographische Lage der Schule sicherlich auch eine entscheidende Rolle spielt). In den seltensten Fällen sind es die zukünftigen Studenten, die(aufgrund eigener (schulischer?) Probleme?) als „schwierig“ gelten. Ich denke daher, daß in einer Berufsschulklasse mehr pädagogische Kompetenzen vom Lehrkörper gefordert werden, als in einer Oberstufenklasse. Dies würde bedeuten, es ist nicht nur das Alter, das eine Oberstufenklasse angenehmer zu unterrichten macht.
Beobachtungsschwerpunkt
Zur Begründung
Ich habe mir das Thema „Hintergründe und Umgang mit schwierigen SchülerInnen“ gewählt. Meine Ausgangsthese war, daß der soziale Hintergrund von SchülerInnen ihr Verhalten in der Schule entscheidend bestimmt. Das würde bedeuten, daß bestimmte Verhaltensmuster erklärbar wären, und daß Methoden denkbar wären, aufgrund dieser Erkenntnis, mit den SchülerInnen umzugehen. Ein wichtiger Faktor ist meines Erachtens die Diskrepanz zwischen der Lebenswelt der Kinder und dem Schulalltag. Kinder aus Arbeiterfamilien haben mehr Schwierigkeiten im eher bürgerlich dominierten Schulalltag zurecht zu kommen als Kinder, die ähnliches Verhalten und ähnliche Normen bereits von zu Hause gewöhnt sind.
Da mich der sozialen Hintergrund von schwierigen SchülerInnen interessierte, habe ich das Verhalten des auffälligsten Schülers (S) der Klasse beobachtet und mich über seinen Hintergrund informiert. S ist aus Afghanistan nach Deutschland gezogen. Seine Eltern hatten dort gesellschaftlich angesehene Berufe. Hier leben sie in einer Hochhaussiedlung. Der Vater verteilt Zeitungen und die Mutter arbeitet als Raumpflegerin.
Verhalten
S selbst ist ein mittelmäßig guter Schüler. Er beteiligt sich fast immer am Unterricht. Dabei legt er eine gewisse Übereifrigkeit an den Tag. Er meldet sich, ohne tatsächlich eine Antwort zu wissen, und er ruft Antworten dazwischen, ohne an der Reihe zu sein. Außerdem leistet er oft Widerstand gegen Lehrerentscheidungen. Er hat zwar eine gewisse Autoritätshörigkeit, aber er legt es oft darauf an, daß die Lehrperson gezwungen ist, ihre Autorität auszuspielen.Bei unserer ersten Stunde forderte er uns auf, für Ruhe zu sorgen und fragte provokativ: „...oder könnt ihr das etwa nicht?“(s.o.). In der nächsten Stunde weigerte er sich kurz, sein Buch auszupacken. Es gelang uns eigentlich immer, ihn in seine Schranken zu weisen, ohne zu schreien oder Strafe anzudrohen. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch funktionieren würde, wenn ich ihn allein und für längere Zeit unterrichten müßte. Da er ständig testet, wo die Grenzen sind, ist es fraglich, ob ich ohne tatsächliches Drohpotential (also ohne mindestens einmal eine Strafe zu verteilen) auskommen würde. In der Mathematikstunde der anderen Praktikantinnen (s.o.) hat S zunächst mitgearbeitet. Als sich dann allerdings allgemeine Unruhe einstellte, war er sofort voll in seinem Element. Er weigerte sich sogar, sich auf seinen Platz zu setzen, da er nicht das Gefühl hatte , daß die Praktikantinnen (die auch noch Frauen waren - was bei seinem Hintergrund sicher eine Rolle spielt), irgend etwas gegen sein Verhalten unternehmen würden (könnten?). Erst Frau H´s energisches Eingreifen, konnte ihn dazu bringen, sich wieder hinzusetzen.
Das größte Problem von S war aber sein soziales Verhalten. Er hatte fast jeden Tag Ärger mit irgendjemandem, der oft in Handgreiflichkeiten endete. Das liegt an seiner Strategie der Konfliktlösung. Er ist den meisten in seinem Jahrgang körperlich überlegen und verfügt, in dieser Beziehung, über ein ausgeprägtes Selbstbewußtsein. Außerdem hat er wohl einen Freundeskreis, in dem eine Hierarchie nur über körperliche und rhetorische Gewalt hergestellt wird. S hatte Probleme damit, diesen Mechanismus nicht auf die Schule zu übertragen. Er ist unter einigen seiner MitschülerInnen deswegen auch schon recht unbeliebt (er hat z.B. die Klassensprecherwahl verloren). Ein anderer Teil der Klasse läßt sich allerdings auch von ihm beeindrucken, was ihn natürlich in seinem Verhalten bestärkt. Zu einem Zusammenstoß zwischen der Schulwelt und S´Welt kam es besonders stark, wenn sich in den Tut - Stunden (zwei Stunden pro Woche, in denen klasseninterne Problem besprochen werden) MitschülerInnen über Fehlverhalten von S beschwert haben. Während einer Tut -Stunde beschwerte sich beispielsweise CT, S habe ihm angedroht ihn in der Pause zu verprügeln. CT ist zwar in seiner persönlichen Entwicklung noch nicht so weit wie der größte Teil der Klasse, aber er ist relativ intelligent und kommt aus einem eher bürgerlichen Elternhaus. Daher war er auch besser damit vertraut, Probleme zu verbalisieren und auf einer abstrakteren Ebene darüber zu diskutieren. S war ohnehin im Unrecht, hatte es aber sehr schwer, seinen Standpunkt überhaupt deutlich zu machen. CT war ihm in jeder Phase des Gesprächs deutlich überlegen. Viele in der Klasse waren darüber belustigt, daß S seine dominante Rolle verloren hatte, und benahmen sich viel schadenfroher als bei ähnlichen Situationen in anderen Tut - Stunden, in denen sich andere rechtfertigen mußten.
Ursachen
Ich bin der Meinung, daß S´ Verhalten fast ausschließlich durch seine Sozialisation erklärbar ist. Er hat auch eine Schwester, die ebenfalls als extrem schwierige Schülerin gilt. Die Eltern der beiden haben einen bürgerlichen Hintergrund. Sie haben beide studiert und messen daher dem schulischen Erfolg ihrer Kinder einen höheren Stellenwert bei, als viele andere Familien aus S` Wohngegend oder aus seinem Freundeskreis. Das habe ich aus Rücksprachen mit Herrn W (der die Eltern persönlich kennt) und aus Englisch Hausaufgaben, bei denen S´ Vater geholfen hat, geschlußfolgert. Diese Unterstützung durch die Eltern schlägt sich deutlich in S´
Unterrichtsverhalten nieder. Er zeigt ein deutlich größeres Interesse an den Unterrichtsinhalten, als man es von Kindern mit seinem Sozialverhalten erwarten würde. Das führt dazu, daß S mitunter Leistungen bringt, die ihn für eine Oberstufenlaufbahn qualifizieren.
Auf der anderen Seite bemerkt man deutlich, welchen Einfluß sein Freundeskreis auf ihn hat. S hat einen großen Teil seines bewußten Lebens in Deutschland verbracht. Er ist viel flexibler als seine Eltern und wird sich diesen wahrscheinlich deswegen in der Zukunft immer mehr entziehen. Einen größeren Einfluß auf sein Leben, sein Verhaltensmuster und seine Einstellungen werden deswegen seine Freunde haben. Diese entstammen zur Zeit zum größten Teil sozial niedrigen Schichten und sind zum größten Teil ausländischer Abstammung. Wie bereits erwähnt, haben sie andere Methoden, mit Konflikten umzugehen. Für sie ist es wichtig, Stärke zu demonstrieren. Konflikte werden unmittelbar ausgetragen. Mit diesem Verhalten sind natürlich bestimmte Wertvorstellungen verbunden. In einer Wohngegend mit so hohem Konfliktpotential wie in einer Hochhaussiedlung, müssen sich Kinder ganz anders behaupten als in den eher mittelständischen Wohnbezirken in Eidelstedt. In der Schule werden natürlich eher „mittelständische Konfliktlösungsmodelle“ favorisiert. Dadurch wird S immer gezwungen sein, sich umzustellen, je nachdem, wo er sich gerade befindet.
Es gibt aber noch eine Menge andere Diskrepanzen zwischen den Wertvorstellungen von S´ Freundeskreis und den in der Schule vorherrschenden Normen. Das Leistungsdenken, das in der Schule gefordert wird, wird wahrscheinlich keine so herausragende Rolle unter S´ Freunden spielen. Das mag dazu führen, daß S die Schule immer stärker vernachlässigt, je nachdem, wie weit er sich von seinen Eltern entfernt. Dann würde er sich, während der Schulzeit, immer wenn seine Welt mit der schulischen in Konflikt gerät, in einer Opferrolle sehen, und seine Motivation würde nachlassen, während sein Widerstand gegen die Anpassung an die Schulnormen steigt.
Konsequenzen für den Umgang mit S
Wie ich bereits erläutert habe, halte ich es für sehr schwer, sich ohne Strafen gegen S durchzusetzen. Die Schwierigkeit liegt darin, daß S daran gewöhnt ist, seine eigene Position durch dominantes Verhalten gegenüber anderen zu stärken, und denen Respekt zu zollen, die Stärke zeigen. Dadurch gerät der Lehrer in einen Zwiespalt. Auf der einen Seite erwartet S Stärkedemonstrationen, auf der anderen Seite wird man später keinen Zugang zu ihm erlangen können, wenn man ihm nur autoritär andere Wertvorstellungen aufzwingt. Er wird dadurch nicht verstehen, welchen Zweck das hat, und warum er sich im Unrecht befindet. Man könnte dadurch Widerstand in der Zukunft provozieren, denn ohne Verständnis für die Ursachen des Ärgers den er hat, wird S möglicherweise den/die LehrerIn irgendwann nur als GegnerIn verstehen. Die schwierige Aufgabe des Lehrers besteht also darin, sein Vertrauen zu gewinnen (indem man ihm z.B. persönliches Interesse zeigt), um an einen Punkt zu gelangen, an dem man ihm zu einem bestimmten Verhalten bringen kann, ohne mit einer Strafe zu drohen. Er muß wissen, was an seinem Verhalten aus welchem Grund falsch war. Es dürfte aber schwierig werden, jedes mal wenn man ihn zur Ordnung rufen muß, eine ausführliche Begründung zu liefern. Daher halte ich es für sehr wichtig, häufig Gespräche in einigermaßen vertrauter Atmosphäre mit ihm zu führen. In diesen Gesprächen muß S verständlich gemacht werden, warum verschiedene Fehlverhalten von ihm bestraft wurden, daß es in seinem Interesse ist, sein Verhalten zu ändern, und woher seine Schwierigkeiten überhaupt kommen. Ich denke, es ist dabei sehr wichtig, auch aus seiner persönlichen Sicht zu argumentieren, da er sich nicht so stark mit der Schule identifiziert. Seine MitschülerInnen sind ihm wohl schon sehr wichtig. Die Maßnahme, die während meiner Praktikumszeit am meisten Eindruck bei ihm hinterlassen hat, war die Drohung, ihn nicht mit zur Klassenfahrt zu nehmen, da sein Sozialverhalten untragbar sei. Dies wurde ihm in einem Einzelgespräch von Herrn W und Frau H dargelegt.
Es ist also auch sehr wichtig, wie sich sein Verhältnis zur Klasse in der Zukunft entwickelt. Es liegt allerdings fast gänzlich außerhalb der Möglichkeiten des Lehrenden, die sozialen Kontakte innerhalb der Klasse zu organisieren.
Für entscheidend im täglichen Umgang mit S halte ich die Differenzierung seiner Vergehen. Zur Zeit ist es für ihn etwa genauso schlimm, sich während des Unterrichts mit seinem Nachbarn zu prügeln wie dazwischen zu rufen, ohne an der Reihe zu sein. Hier würde ich ein Verfahren vorschlagen, wie ich es weiter oben bereits angeführt habe (s.o.). Damit könnte man ihm vor Augen führen, welches Verhalten wirklich schlimm und welches nur störend ist. Bewußtes Stören muß anders behandelt werden als versehentliches reinrufen. Das Problem das hierbei entsteht ist folgendes : Es gibt sehr viele Situationen in denen S ermahnt werden muß. Es handelt sich dabei um kleinere Vergehen, die allein noch keine Strafe rechtfertigen würden. Erst seine Mißachtung der Ermahnung oder (öfter) andere, sich häufende Kleinigkeiten, führen dazu, daß die Toleranzgrenze der Lehrkraft überschritten wird. Dann ist es allerdings nicht mehr möglich, eine für S nachvollziehbare Trennung zwischen Disziplinproblemen und sozialem Fehlverhalten zu machen.
SchülerInnen wie S stellen den/die LehrerIn auch noch vor andere Probleme. Dadurch, daß diese SchülerInnen so auffällig sind, ist es schwierig, alle gleich zu behandeln. Zum einen reagiert man bei Problemfällen viel sensibler als bei anderen (S ist z.B. für etwas vor die Tür geschickt worden, daß bei anderen Schülern später ignoriert wurde) und zum anderen muß man darauf achten, daß auch die, die sich selbst nicht so auffällig melden, bei einer Meldung an die Reihe kommen. Letzteres hat mir persönlich Schwierigkeiten bereitet. Das mag aber daran liegen, daß ich S ohnehin schwerpunktmäßig beobachtet habe. Es lag aber auch daran,daß ich noch nicht immer einen ausreichend guten Überblick über die gesamte Klasse hatte.
Theoretische Erörterung des Zusammenhangs von sozialem Hintergrund und schulischem Verhalten (bzw. Erfolg)
Ich werde im Folgenden zunächst über die aktuelle Situation informieren, um meine Ausgangsthese vom kausalen Zusammenhang von sozialem Hintergrund und schulischen Schwierigkeiten zu verifizieren. Anschließend werde ich einige Vermutungen über die Ursachen anstellen. Dabei möchte ich einen besonderen Schwerpunkt auf die sprachliche Ebene der Sozialisation (Sozio-Lingistik)legen und den Forschungsstand darstellen. Am Ende werde ich eigene Schlußfolgerungen daraus ziehen.
Seit den sechziger Jahren gab es Erhebungen zur sozialen Zusammensetzung in höheren Schulen und Universitäten und Untersuchungen, mit denen das Zustandekommen dieser sozialen Zusammensetzung erforscht werden sollte. Leider ist die Erforschung dieses Bereichs seit etwa Mitte der achtziger Jahre stagniert. Trotz eines allgemeinen Anstiegs von Erhebungen insgesamt, wird der soziale Hintergrund von SchülerInnen weder vom statistischen Landes oder Bundesamt noch vom staatlichen Schulamt, und nicht einmal von den Gewerkschaften untersucht. Einzig die Studentenwerke führen Sozialerhebungen durch. Aus diesen Untersuchungen stammen die nachfolgenden Zahlen (aus einer Untersuchung von ´97i).
Teilt man die Gesellschaft in vier soziale Gruppen (niedrig, mittel, gehoben, hoch) so gehören in Deutschland 52% der 17 - 18jährigen der niedrigsten Schicht an. Von diesen Jugendlichen gelingt nur einem Drittel der Übergang in die Oberstufe. Von den Jugendlichen, die der Gruppe „hoch“ angehören, erreichen dagegen 84% die Oberstufe. Von den Kindern aus der untersten Sozialschicht, die die Oberstufe besuchen, schaffen nur 24% den Schritt zur Universität, während 86% der OberstufenschülerInnen mit einem hohen sozialen Hintergrund anschließend die Universität besuchen.
Oberstufe Universität
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nur 8% der Kinder aus der sozial niedrigsten Schicht schaffen den Zugang zu einer Hochschule, während 72% der Kinder aus der höchsten Schicht den Schritt zur Universität schaffen. 43 % der Studierenden entstammen Beamten- oder Selbständigenfamilien. Dagegen stammen nur 16% (HH - 12,9%ii ) aus Arbeiterfamilien, obwohl der Arbeiteranteil in der Bevölkerung bei 43% liegt.
Diese Daten zeigen eindeutig, daß der soziale Stand der Eltern starken Anteil an der schulischen Entwicklung des Kindes hat.
Über die kausalen Zusammenhänge gibt es praktisch keine aktuelle Literatur. Dieser Forschungszweig der Pädagogik (bzw. der Linguistik) scheint stark in den Hintergrund gedrängt worden zu sein. Darum kann ich nur auf alte Analysen zurückgreifen. Die meisten Werke zu diesem Thema stammen aus den sechziger und den siebziger Jahren. Damals waren in den USA die unteren Sozialschichten in den Highschools um 54% unterrepräsentiert, während die oberen Sozialschichten um 80% überrepräsentiert wareniii. Da sich die Situation nicht grundlegend verändert hat (s.o.), halte ich den Großteil der Literatur für noch brauchbar und werde den damaligen Forschungsstand (hauptsächlich auf Sprache bezogen) kurz umreißen, nachdem ich einige allgemeine Erörterungen zu dieser Problematik angeführt habe.
Die Ursachen für die ungleiche Chancenverteilung sind vielschichtig. Ein wichtiger Grund ist in der Motivation durch die Eltern zu suchen. Menschen, die einen Posten mit Entscheidungsgewalt innehaben, haben im allgemeinen eine höhere Schulbildung genossen.Darum haben sie auch eine andere Erwartungshaltung gegenüber den schulischen Erfolge ihrer Kinder. Eltern die selbst nur einen Hauptschulabschluß haben, werden dagegen von ihren Kindern auch nicht mehr verlangen. Ihre Vorstellungen von dem, was ihr Kind eines Tages erreichen sollte, werden an ihrem eigenen Leben gemessen. Um beispielsweise KassiererIn oder BauarbeiterIn zu werden, ist kein Abitur nötig. Die Mehrzahl dieser Berufe bieten auch keine nennenswerten Aufstiegschancen. Daher herrschen in den Familien der unteren Sozialschichten andere Normvorstellungen als das in der Schule geforderte Leistungsdenken vor. Verstärkt wird das noch durch die unausgesprochene Vorstellung von angeborener Intelligenz. Viele Eltern sind der Meinung, bestimmte Kinder hätten eben die Intelligenz zu studieren und andere nicht. Da sie selbst nicht in der Lage waren, das Abitur zu erreichen, liegt der Schluß nahe, ihre Kinder gehörten auch zu denen, die eben nicht intelligent genug sind. Diese Annahme ist wahrscheinlich den wenigsten bewußt, sondern ist vielmehr eine Art unterbewußte Prämisse. Diese führt dazu, daß sie schlechte schulische Leistungen ihrer Kinder eher tolerieren und als gegeben hinnehmen. Arbeiterkinder erfahren dadurch weniger Unterstützung durch das Elternhaus und bekommen weniger Ärger für schlechte Zensuren. Kinder aus bürgerlichen Verhältnissen unterliegen dagegen in der Regel einem sehr viel größeren Leistungsdruck durch das Elternhaus. Selbst wenn ihre Eltern nicht schimpfen, wenn sie schlechte Klausuren mit nach Hause bringen, so werden sie trotzdem Nachhilfeunterricht o.ä. bekommen.
Damit wären wir auch schon bei einem weiteren Grund für die unterschiedlichen Leistungen von „reichen“ und „armen“ SchülerInnen. Unser Schulsystem ist zwar offiziell kostenlos, real kommen aber immer mehr Kosten auf die Eltern zu. Etwa seit Mitte der achtziger Jahre wurde das Bildungssystem stetig abgebaut oder es wurde versäumt, es den aktuellen Begebenheiten (wie etwa steigende Schülerzahlen) anzupassen. Dadurch geriet beispielsweise die Lehrmittelfreiheit in Gefahr. Immer öfter müssen sich SchülerInnen selbst Bücher kaufen (vor allem an Oberstufen). Außerdem wurde in den vergangenen Jahren die Klassenobergrenze immer weiter ausgeschöpft, um den Mangel an Lehrpersonal zu kompensieren. Darunter leidet der Unterricht, da die Lehrpersonen weniger auf spezifische Probleme einzelner SchülerInnen eingehen können. Das bedeutet natürlich einen Nachteil für die gesamte Schülerschaft. Die Eltern aus höheren Sozialschichten werden aber weniger schnell die Schlußfolgerung ziehen, ihr Kind sei eben nicht intelligent genug. Außerdem sind sie viel eher in der Lage und gewillt, Nachhilfeunterricht zu bezahlen.
Die Schlußfolgerung hieraus muß sein, daß die meisten Kürzungen im Bildungssystem, die Chancengleichheit weiter unterminieren.
Auch die Hochschulbildung wird immer mehr zu einer finanziellen Belastung der Eltern. Bundesweit waren 1996 90% der StudentInnen auf finanzielle Unterstützung durch das Elternhaus angewiesen. 1997 wurden nur noch 18,6% der Studierenden durch Bafög gefördert (1994: 26,8%). In den neuen Bundesländern sank die Gefördertenquote von 1991 bis 1996 von 80,7 auf 31,6%. In den alten Bundesländern sank die Gefördertenquote von 1972 bis 1996 von 44,6% auf 14%iv. Die Ursache ist in der Verschärfung der Bafög-Kriterien zu suchen. Es ist offensichtlich, daß ein erschwerter Zugang zur Studienförderung hauptsächlich Eltern mit geringem Einkommen Probleme bereitet, da sich wohlhabende Eltern ohnehin leisten können, das Studium ihres Kindes vollständig selbst zu finanzieren. In einigen Bundesländern(Berlin, Niedersachsen) sind in den letzten Jahren zusätzlich noch offene oder verdeckte Studiengebühren eingeführt worden. Dieser Fakt ist zwar noch zu neu um sich in den Sozialerhebungen niederzuschlagen, er wird aber sicherlich in der Zukunft noch dazu beitragen, daß Kindern aus sozial niedrigen Schichten das Studium finanziell erschwert wird.
Auch die Leistungsbeurteilung durch den/die LehrerIn wird durch den sozialen Hintergrund der SchülerInnen geprägt. In einer Studie wurden 1996 13000 Hamburger Fünftklässler einem standardisiertem Leistungstest unterzogeni. Das Ergebnis der Studie war, daß die Entscheidung über den Besuch der weiterführenden Schulform maßgeblich von den Empfehlungen der LehrerInnen geprägt war. Kinder, deren Väter keinen Schulabschluß hatten, wurden zu 16% für eine gymnasiale Laufbahn vorgeschlagen. Kinder, deren Väter ein Abitur hatten, wurden dagegen zu 70% für eine gymnasiale Laufbahn vorgeschlagen. Über die Hälfte der Kinder mit Vater mit Abitur haben eine Gymnasialempfehlung erhalten, wenn sie im Test mindestens 65 Punkte hatten. Die Kinder mit Vätern mit Hauptschulabschluß erhielten in der Mehrheit der Fälle eine Gymnasialempfehlung wenn sie mindestens 82 Punkte erreicht hatten. Bei bildungsferneren Schichten wird im Allgemeinen die Lehrerempfehlung befolgt, während Akademikereltern sich eher darüber hinwegsetzen. Woher rührt diese Fehleinschätzung der Lehrer ? Sicherlich spielt es eine Rolle, daß sich Kinder aus bürgerlichen Verhältnissen besser dem Schulalltag anpassen. Wichtig ist aber auch die sprachliche Kompetenz. Kinder, die mit der Hochsprache aufwachsen, sind eher in der Lage, bestimmte Umstände in der der Schule angemessenen Form zu versprachlichen. Dadurch mag das Bild des Lehrenden verzerrt werden. Es handelt sich allerdings beim
Beherrschen der Hochsprache um eine Kompetenz, die bei einer höheren schulischen Ausbildung durchaus notwendig ist.
Sozio-linguistische Ansätze
Damit möchte ich zum sozio-linguistischen Erklärungsansatz kommen. Natürlich soll mit diesem Ansatz das Problem nicht auf ein sprachliches reduziert werden. Allerdings hat die Sprache einen größeren Einfluß auf das Problem, als man im allgemeinen annehmen würde. Zunächst muß man sich vor Augen führen, daß Sprache mehr als ein Werkzeug zur Kommunikation ist. Man macht nicht nur seine Gedanken durch Worte hörbar, sondern der Gedanke erfolgt im Wort. Worte sind abstrakte Symbole, die reale Gegenstände oder Zusammenhänge ausdrücken und sie damit für Kommunikation erschließen, aber sie primär überhaupt reflektierbar machen. Das bedeutet, man braucht Sprache sowohl zur Bewußtmachung und Selbstorientierung, als auch als Instrument für höhere kognitive Fähigkeiten wie Abstraktion und Generalisierung (beispielsweise lernten einjährige Kinder die Unterscheidung farbiger Kisten dreimal schneller, wenn sie den Namen der Farbe gelernt hatten). Dabei entspricht die „innere Sprache“ nicht der äußeren sondern hat einen prädikativeren Charakter. Sie ist auf die wesentlichen Elemente beschränkt.
Nach den russischen Sprachpsychologen Lurija und Wygowski (1955) kann sich ein Kind etwa ab dem fünften Lebensjahr völlig bewußt über die innere Sprache lenken. Vorher dient die Sprache als Orientierungsinstrument.v
Damit wäre der Einfluß der Sprache auf Denkprozesse geklärt. Wie erklärt sich aber das unterschiedliche Erlernen dieser Sprache? Die Stellung der Eltern im Produktionsprozess beeinflußt den Umgang mit dem Kind. Ein Arbeiter steht in einem vorstrukturierten Bearbeitungsprozess, bei dem in der Regel eher kollektivierte, standardisierte außersprachliche Signale zur Kommunikation genutzt werden. Er selbst hat an seinem Arbeitsplatz (an dem er den größten Teil seines Lebens verbringt) nur einen sehr geringen individuellen Spielraum, und steht in autoritär organisierten Rollenbeziehungen zu anderen. Daher werden in der Unterschicht eher Folgen als Absichten beachtet. Außerdem erfolgt das Erlernen von Dingen öfter über non-verbale Kanäle als bei Mittelschichtfamilien. Dem „hier und jetzt“ wird größere Bedeutung beigemessen als Intentionen und Entwicklungen. Umstände werden eher konkret als abstrakt erklärt (an Beispielen). Deswegen reagieren Unterschichtskinder impulsiver auf Probleme und Gefühle. Sie leben sie beispielsweise mittels expressiver Gesten aus.
Ein Kind aus der Mittelschicht lernt dagegen viel eher Probleme und Gefühle zu verbalisieren und damit zu abstrahieren. Es entwickelt dadurch eine gewisse Distanz zu diesen Gefühlen oder Problemen. Das liegt daran, daß das Mittelschichts(bzw. Oberschichts)kind mehr über verbale Kanäle lernt. Von ihm wird mehr Individualität gefordert und Intentionen werden stärker beachtet. Es befindet sich viel mehr im Mittelpunkt seiner Wahrnehmung als das Unterschichtskind.
Welchen Einfluß hat das aber auf das Sprachverhalten der Kinder? Die ersten Untersuchungen in diese Richtung wurden von Basil Bernstein in den sechziger Jahren angestelltvi. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die Einzelheiten der Unterschiede eingehen. Es gab bis Anfang der siebziger Jahre Untersuchungen in diese Richtung, deren Ergebnisse tendenziell ähnlich waren:
- die Mittelschichtkinder konstruierten komplexere Sätze
- die Mittelschichtkinder benutzten mehr verschiedene Worte
- die Mittelschichtkinder schrieben abstraktere und verallgemeinertere Aufsätze · der passive Wortschatz (Verständnis) war aber gleich
- wenn abstraktere Antworten gefordert waren, hatten die Unterschichtskinder größere Kodierungsprobleme (es dauerte länger)
- die Unterschichtskinder benutzten häufiger Dialekt
Die Mittelschichtkinder schnitten besser ab was Abstraktionsfähigkeit, Ich-Autonomie, Individuierung und Rollenflexibilität angeht. Trotz ihres Mangels an Abstraktions- und Differenzierfähigkeit waren die Unterschichtskinder aber eher in der Lage, ihre soziale Situation einzuordnen. Die sprachlichen Unterschiede waren in jedem Fall eindeutig. Die Schlußfolgerung daraus ist, daß die Mittelschichtskinder besser mit der Schulsprache vertraut sind. In den 3 verbreitetsten Lesebücher in den USA waren 1962 zu ¼ Worte enthalten, die im Wortschatz der Unterschichtskinder nicht auftauchten.
Es gibt drei vorherrschende Theorien um diese Unterschiede im Sprachgebrauch zu analysieren:
1) die Heriditätstheorie
2) die Defizittheorie
3) die Differenztheorie
Die Heriditätstheorie
Die Heriditätstheorie geht von einer genetischen Determination des Menschen aus. Das heißt, ihre Vertreter gehen davon aus, daß Intelligenz zum größten Teil auf Vererbung zurückzuführen ist. Das heißt, kognitive und verhaltensmäßige Unterschiede werden durch Vererbung erklärt. Einer der Vertreter dieser Theorie heißt K. Jensens (eine Zusammenfassung seiner Thesen findet sich in iii (Leider konnte ich kein eigenes Werk von ihm bekommen). In seinem Buch geht er davon aus, daß es grundsätzlich zwei Intelligenzstufen gibt. Die erste Intelligenzstufe ermöglicht ausschließlich assoziatives Lernen (also die in der Arbeiterklasse verbreitete Form) während die zweite Intelligenzstufe kognitives, begriffliches Lernen ermöglicht. Jensens geht davon aus, daß bestimmte Menschen auf Grund ihrer genetischen Anlagen nur Intelligenzstufe eins erreichen können. Daher geht er von einer Art „natürlicher Selektion“ aus. Er sieht den gesellschaftlichen Status Quo eines Menschen als optimal an (das Optimum, das mit dessen Genen erreichbar ist). Das bedeutet, den unteren Gesellschaftsschichten wird jedwede Begabung abgesprochen. Durch die Annahme der Konstanz menschlicher Anlagen gelangt er zu einer negativen Einschätzung von Fördermaßnahmen. Der Mensch wird als unveränderbar angesehen und somit ebenfalls die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dadurch als natürlich gelten.
Diese Theorie hatte schon Anfang der siebziger Jahre keine so große Bedeutung mehr, da Nachweise für Kompetenzdefekte fehlten und empirische Befunde eher das Gegenteil bewiesen.
In den letzten Jahren sind allerdings immer öfter ähnliche Theorien aufgekommen (vor allem in den USA). Beispielsweise kamen in den USA Gerüchte über ein „kriminelles Gen“ auf. Damit hätte man eine Möglichkeit, die überdurchschnittlich Hohe Zahl von Farbigen in US amerikanischen Gefängnissen zu erklären, ohne gesellschaftliche Probleme in Betracht ziehen zu müssen. Allerdings konnten solche Theorien, wegen ihres unseriösen Charakters, keine große Bedeutung erlangen.
Es gibt aber auch immer wieder Ansätze, die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen auf dessen Erbgut zurückzuführen.vii Zwar werden die Erbanlagen nicht mehr so absolut gesetzt wie noch vor dreißig Jahren, aber dennoch behauptet Zimmer in seinem Artikel vom Mai ´98 (vgl. Endnote vii), die Intelligenz sei zur Hälfte auf die Gene eines Menschen zurückzuführen. Intelligenztests wurden in den letzten Jahren immer weiter zurück gedrängt, da es nur möglich war, Wissen nicht aber Intelligenz abzufragen. Zimmer führt aber an, es gäbe eine denkerische Basisfähigkeit. Nur so könne erklärt werden, daß Menschen, die bei einem Teil eines Intelligenztestes gut abgeschnitten haben, nur selten bei den anderen versagen Er relativiert zwar seine Aussagen, stellt aber gleichzeitig alle Kritiker dieser Theorie, als ideologisch verbohrt hin. Zimmer:“ Die Größe des Wortschatzes, den einer hat, ist weitgehend erblich; trotzdem muß natürlich jedes Wort gelernt werden. Jede Anlage braucht eine Umwelt.“ Um seine Thesen zu untermauern, führt er an, die „Experten“ seien sich einig, und die These gewisser Forscher (Ulric Neisser, 1996), der IQ hänge primär vom Genmaterial ab, sei unwidersprochen geblieben.
Die Defizittheorie (oder Sprachbarierenthese)
Einer der deutschen Vertreter der Defizittheorie war beispielsweise Ulrich Oevermannviii. Die grundlegende Annahme dieser Theorie ist, daß die Ursachen der Unterschiede zwischen Kindern aus niedrigen und Kindern aus hohen Schichten, in Umwelteinflüssen während des Aufwachsens zu suchen sind. Der Reizmangel in ihrer sozio-kulturellen Umgebung führe zu einer suboptimalen (also defizitären) Entwicklung. Diese Defizite seien beispielsweise mangelnde Leistungsmotivation und Aufstiegsorientierung, mangelnde Rollenflexibilität unnatürlich ein mangelhaftes Beherrschen der Hochsprache (wobei letzteres sowohl Ursache als auch Wirkung ist). Die pädagogische Schlußfolgerung aus dieser Überlegung muß ein Kompensationsunterricht für die Unterschicht sein, um die sprachlichen Defizite auszugleichen und sie auf das Kompetenzlevel der mittleren und oberen Gesellschaftsschichten anzuheben.
Die Kritiker dieser Theorie werfen ihren Vertretern vor, die Standards der bürgerlichen Mittelschicht als Gradmesser zu benutzen (beispielsweise setzte Jahoda - ein Vertreter der Defizittheorie - in einer Wortschatzuntersuchung 1964 den Wortschatz der Mittelschicht als 100%, um die Defizite der Unterschichtskinder aufzuzeigen). Außerdem wird ihnen vorgeworfen, die Konflikte und Widersprüche der gesellschaftlichen Grundstruktur als oberflächliche, ausbesserbare Dysfunktionalitäten zu betrachten, ohne die gesellschaftliche Grundstruktur selbst zu hinterfragenix. Der Mensch würde zwar als veränderbar betrachtet,das System aber nicht. Außerdem sei „Mangelhaftgkeit“ relativ. Das Werte- und Normensystem der dominanten Subkultur (der Mittelschicht) wird höher bewertet als das der Unterschicht (konkret: Leistungsmotivation, Aufstiegsstreben und Individualismus werden höher bewertet als Spontaneität, Solidarität und kollektives Denken und Handeln).
Die Theorie die dieser Kritiker dagegen setzen ist
Die Differenztheorie.
Die Ausgangsüberlegung dieser Theorie ist dieselbe wie die der Defizittheorie : Die Ursachen der Unterschiede werden in den verschiedenen Umwelteinflüssen der verschiedenen sozialen Schichten gesucht. Im Unterschied zur Defizittheorie wird die Sprache der Unterschicht aber als parallel existierende Klassensprache betrachtet, die funktional gleichwertig ist. „Die Unterschicht hat - sozio-ökonomisch bedingt - andere Verhaltensformen entwickelt, die ihren Bedürfnissen und Erfahrungen funktional sind“iii. Die Untersuchungen der Vertreter dieser Theorie sind eher deskriptiv als normativ. Die Testsituationen werden möglichst wenig formal gestaltet, da die Mittelschichtskinder besser mit formalen Testsituationen umgehen können. Bei Untersuchungen des „Ghetto-Englisch“ fand Labov (1960) sowohl strukturierte Regelmäßigkeit, als auch äquivalente Versprachlichungsmöglichkeiten. Eva Neuland versuchte 1974 möglichst schichtunabhängige Intelligenz- und Kreativitätstests zu konzipieren (keine schichtspezifischen Vorlagen etc.). Bei deren Ergebnissen waren keine signifikanten Unterschiede zwischen Unterschichts- und Mittelschichtskindern festzustellen. Die pädagogischen Konsequenzen aus dieser Theorie unterscheiden sich grundlegend von denen der Defizittheorie, da von gesellschaftlichen Grundwidersprüchen ausgegangen wird, die allein durch Schule nicht ausgeräumt werden können. Sie schlagen vor, die ausschließliche Mittelschichtsorientierung des Schulsystems aufzuweichen. Das bedeutet zum einen, die Hochsprache als einzig richtige abzulösen und den Unterricht mehr auf die Lebenserfahrung der SchülerInnen auszurichten (beispielsweise durch kollektive Problemlösungsverbalisierung o.ä.). Die Anhänger der Differenztheorie gehen davon aus, daß die Anerkennung der Unterschichtssprache zu einem steigenden Selbstbewußtsein der Kinder führen würde, da sie sich dann nicht mehr unangemessen oder als „Defizitwesen“ fühlen würden. Ihre Sprache (und die ihrer Familie und Freunde) als falsch darzustellen, wird als Angriff auf seine soziale Identität gewertet. Die Syntax, der Wortschatz und die Ausdrucksweise eines Kindes werden als Kristallisationsform der Anschauung und des Lebens der gesamten Klasse betrachtet. Darum soll den Kindern die soziale Bedingtheit der Sprache bewußt gemacht werden. Sie sollen eher zu Kritikfähigkeit erzogen werden, zu kritischem Lernen und zum Erkennen von Manipulationsversuchen. Die Schule soll eher funktional auf das tatsächliche Leben des Kindes abgestimmt sein, als eine größere soziale Mobilität zu ermöglichen, da dieses Ziel ohnehin als - gesellschaftlich bedingt - nicht erreichbar angesehen wird.
Schlußfolgerung
Ich persönlich bin der Meinung, daß die Differenztheorie am ehesten geeignet ist, um die realen Verhältnisse zu beschreiben. Ich halte die sprachlichen Differenzen nicht für so entscheidend, daß ein Ausräumen dieser Unterschiede automatisch zu Chancengleichheit aller sozialer Schichten führen würde, wie das die Defizittheorie vermittelt. Viel entscheidender sind die gesellschaftlich bedingten Wertvorstellungen. Diese sind aber nur durch die sozio- ökonomische Verhältnisse zu erklären. Die einzige Alternativerklärung wäre die der genetischen Determination. Die Gene sind jedoch bis zum heutigen Tage nur zu unbedeutend kleinen Teilen entschlüsselt. Ich gestehe ein, daß im Erbgut bestimmte Informationen gespeichert sind, die bestimmte Fähigkeiten begünstigen oder erschweren mögen. Eine genaue Aufschlüsselung der Bedeutung ist allerdings bislang ausgeschlossen. Es gibt kein „Forschungsobjekt“, das außerhalb der Welt existiert und von dieser nicht beeinflußt wurde.
Das heißt, man kann unmöglich genau herausfinden, welche Verhaltensmuster und Fähigkeiten angeboren sind und welche nachträglich angeeignet wurden. Auf der anderen Seite ist es nicht besonders schwierig, mit empirischen soziologischen Untersuchungen, die sozio-ökonomische Bedingtheit gewisser Verhaltensmuster, der Entwicklung bestimmter Fähigkeiten und den Einfluß auf die Schulbildung nachzuweisen. Letztendlich sollte man sich mindestens vor Augen führen, welche Konsequenzen das Akzeptieren der These von Erblichkeit der Intelligenz hätte. Eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit wird als natürlich und im Menschen angelegt interpretiert. Das Menschenbild, das hier aufgebaut wird, kann die Unterschiede der Wertvorstellungen verschiedener Klassen genauso wenig erklären, wie es die emeinsamkeiten derselben innerhalb einer Klasse begründen kann. Mit einer soziologischen Analyse, welche die Stellung im Produktionsprozeß berücksichtigt, ist das hingegen relativ leicht möglich. Daher halte ich es nicht für natürlich, daß niedrige soziale Schichten an Hochschulen dermaßen unterrepräsentiert sind. Die Konsequenz hieraus muß die Forderung nach einer Veränderung des Schulsystems sein. Die Vertreter der Differenztheorie schlagen hierbei allerdings eine Reform des Unterrichts vor, die meines Erachtens in diesem System schwerlich realisierbar ist. Die Dominanz der Werte der Mittelschicht ist kein Zufall,sondern vielmehr das natürliche Ergebnis einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Daher halte ich es für unwahrscheinlich, daß die Dominanz ihrer Sprache und ihrer Werte in der Zukunft gebrochen werden wird. Es liegt eher am einzelnen Lehrenden, Veränderungen zu Gunsten der Unterschicht in seiner Unterrichtsgestaltung vorzunehmen. Aber in welche Richtung sollten diese Veränderungen gehen? Akzeptiert der/die Lehrende die Unterschichtssprache bedingungslos, werden die SchülerInnen in der Oberstufe oder an der Hochschule vor unüberwindbaren Hindernissen stehen, da dort die Hochsprache auf unabsehbare Zeit weiter dominieren wird. Es ist nicht einmal sicher, daß die Unterschichtskinder ein größeres Selbstbewußtsein entwickeln, da andere Lehrende sie weiter für ihre Sprache kritisieren werden. Das legt die Schlußfolgerung nahe, daß höhere soziale Mobilität ohnehin unerreichbar bleibt und es daher notwendig ist, die Kinder mit Wissen auszustatten, das für ihr späteres Leben relevanter ist, als das was zur Zeit vermittelt wird. Praktisch würde das bedeuten, daß man früher als in der Oberstufe damit beginnen müßte, die SchülerInnen über die Strukturen unserer Gesellschaftsordnung aufzuklären. Das beinhaltet eben auch eine Aufklärung über den Ursprung der Sprachunterschiede. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, den SchülerInnen Klassenbewußtsein ab-zu-erziehen. Sie sollten vielmehr über ihre soziale Stellung und deren Ursachen aufgeklärt werden. Das würde ihnen in ihrem späteren Leben viel eher die Möglichkeiten zum kritischen Hinterfragen von dem geben, mit dem sie in ihrem Leben konfrontiert sind. Ich denke, mehr ist für eine/n einzelne/n LehrerIn kaum möglich, und eine weitergehende Reform der Lehrpläne o.ä. ist kaum zu erwarten, da es kaum im Interesse derjenigen ist, die die Lehrpläne erstellen. Auf der anderen Seite ist größtmögliche Bildung das beste Instrument, um seine eigene Lage zu verstehen und zu verändern. Ich denke daher, daß man auch alles versuchen sollte, um die Kinder „universitätsfähig“ zu machen. Tatsächlich sind die Chancen hierfür aber extrem beschränkt.Möglicherweise wäre Sprachkompensationsunterricht keine falsche Maßnahme, wenn man den Kindern erklärt, daß die Hochsprache nötig ist, ohne ihnen das Gefühl zu geben, ihre eigene Klassensprache sei minderwertig. Schwieriger finde ich die Entscheidung inwiefern man die Wertvorstellungen der Kinder bearbeiten sollte. Hier ist eine Zweigleisigkeit nur schwer möglich. Anders als bei den sprachlichen Differenzen stehen die Werte, die für eine Hochschulausbildung und die Werte die für das (wahrscheinlichere) Leben in der Unterschicht nötig sind, zueinander im Widerspruch. Entwickeln die SchülerInnen nicht ein Mindestmaß an Leistungsdenken, werden sie es wohl kaum bis zur Universität schaffen. Ersetzt aber dieses Leistungsdenken das in der Familie erlernte Kollektivdenken und Solidaritätsgefühl, werden die Kinder in ihrem späteren Leben soziale Schwierigkeiten bekommen (wenn sie zu den 92% gehören, die es nicht schaffen). Außerdem sind es einzig diese Werte, mit denen, vor allem in Industrieberufen (aber auch im Dienstleistungssektor), Verbesserungen der Lebensqualität erreichbar sind. Nur durch gemeinsame Kämpfe können Lohnerhöhungen erreicht werden, und Menschen mit geringem Einkommen sind viel eher darauf angewiesen einander zu helfen als Menschen aus der Oberschicht. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist ebenfalls in der Aufklärung der Kinder über ihre soziale Stellung zu suchen, wobei das eine weit größere Schwierigkeit darstellt, als die konsequente Verfolgung durchziehen des Lehrplans. Wie soll man den Kindern auf der einen Seite verständlich machen, daß sie zusammenhalten müssen, wenn man gleichzeitig Vorsagen bestraft? Wie soll man ihnen klarmachen, daß sie nicht in Konkurrenz zueinander stehen, wenn man ihnen gleichzeitig Noten gibt und sie in Gute und Schlechte einteilt? Das heutige Schulsystem ist alles andere als geeignet, um auf die Bedürfnisse der Unterschicht einzugehen. Die Struktur selbst macht es dem Lehrenden fast unmöglich, den Unterschichtskindern eine ihrer Zukunft angemessene Ausbildung zukommen zu lassen. Allein der Versuch würde den Lehrkörper viel mehr Zeit kosten als er hat. Die derzeitige Tendenz geht in die Richtung der Verschärfung dieser Problematik. Wird die Klassenobergrenze weiter ausgeschöpft, wird es immer schwieriger werden, den SchülerInnen, noch zusätzlich zum Pflichtstoff, ein grundsätzliches Verständnis ihrer Situation zu vermitteln. Hinzu kommt eine Tendenz zur
Standardisierung des Unterrichts (Zentralabitur, Vergleichsarbeiten...), die dem/der LehrerIn immer weniger Spielraum läßt. Darum halte ich es für nötig, für eine Veränderung der Rahmenlehrpläne einzutreten und auch gegen Kürzungen des Bildungsetats vorzugehen, selbst wenn ich den Perspektiven eines solchen Vorgehens eher pessimistisch gegenüber stehe. Außerdem halte ich es für die Pflicht jedes Lehrenden, die Spielräume die noch vorhanden sind, bestmöglich im oben angeführten Sinne zu nutzen.
Quellen
[...]
i siehe Klaus Schnitzer u.a., “Das soziale Bild der Studentenschaft der Bundesrepublik Deutschland - 15. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks“, Bonn 1998, s.84 - Anlage B
ii vgl. Dagmar Höfer, „Zur sozialen Lage der Studierenden an Hamburger Hochschulen im Jahre 1997“, Hamburg, Studentenwerk Hamburg, 1998
iii Vgl. Eva Neuland, “Sprachbarrieren oder Klassensprache“, Frankfurt a. M. 1975
iv siehe Bernhard Liebscher, „Die Entwicklung des Bafög“, deutsches Studentenwerk, Bonn 1998 - Anlage C
v siehe Denis Lawton, „soziale Klasse, Sprache und Erziehung“, Ullstein, Frankfurt a.M., 1983 , S.63 - 95
vi vgl.z.B. Basil Bernstein, „Familienerziehung, Sozialschicht und Schulerfolg“, Weinheim, Beltz, 1978
vii vgl. „Der Streit um Gene und Intelligenz ist entschieden“, Zimmer, D. E., Die Zeit, 1998, 17
viii vgl. z.B. Oeverman, „Sprache und soziale Herkunft - ein Beitrag zur Analyse schichtenspezifischer Sozialisationsprozesse und ihrer Bedeutung für den Schulerfolg“, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1973
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist ein Bericht über Erfahrungen aus einem Schulpraktikum, das an einer Julius-Leber Gesamtschule absolviert wurde. Der Bericht umfasst Erfahrungen im Englisch- und Politikunterricht einer 5. Klasse sowie Beobachtungen in einem Geschichte-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 12.
Welche Unterrichtserfahrungen werden im Detail beschrieben?
Der Bericht beschreibt detailliert die Erfahrungen im Englischunterricht, einschließlich der Ausgangsbedingungen, Vorüberlegungen, der ersten Englischstunde und einer Auswertung. Im Politikunterricht wird ein Projekt zum Thema Naturkatastrophen vorgestellt, einschließlich des geplanten Unterrichtsverlaufs und einer Auswertung.
Was war der Beobachtungsschwerpunkt des Praktikums?
Der Beobachtungsschwerpunkt lag auf dem sozialen Hintergrund von SchülerInnen und dem Umgang mit "schwierigen" SchülerInnen. Insbesondere wurde das Verhalten eines auffälligen Schülers der 5. Klasse beobachtet.
Welche theoretischen Ansätze werden zur Erklärung des Zusammenhangs von sozialem Hintergrund und schulischem Verhalten diskutiert?
Der Bericht erörtert soziolinguistische Ansätze, die Heriditätstheorie, die Defizittheorie und die Differenztheorie, um den Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und schulischem Verhalten bzw. Erfolg zu erklären.
Wie wird die Situation in der 12. Klasse beschrieben?
Der Bericht beschreibt die Unterschiede in der Unterrichtsgestaltung zwischen der 5. und der 12. Klasse, insbesondere die Art und Weise, wie die SchülerInnen in den Unterricht einbezogen werden, die Unterrichtsatmosphäre und das Verhältnis zwischen LehrerIn und SchülerInnen. Es wird auch auf die soziale Zusammensetzung von Oberstufenklassen eingegangen.
Welche Ursachen für das Verhalten des beobachteten Schülers (S) werden genannt?
Das Verhalten von S wird hauptsächlich durch seine Sozialisation erklärt. Es wird auf den Einfluss seines Freundeskreises, die unterschiedlichen Wertvorstellungen und die Diskrepanz zwischen seiner Lebenswelt und dem Schulalltag eingegangen.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Umgang mit S?
Es wird betont, wie wichtig es ist, S' Vertrauen zu gewinnen und ihm die Gründe für sein Fehlverhalten verständlich zu machen. Eine Differenzierung seiner Vergehen und häufige Gespräche in vertrauter Atmosphäre werden als wichtige Maßnahmen genannt.
Welche Schlussfolgerungen werden im theoretischen Teil gezogen?
Die Differenztheorie wird als am besten geeignet zur Beschreibung der realen Verhältnisse angesehen. Es wird betont, dass die gesellschaftlich bedingten Wertvorstellungen entscheidender sind als sprachliche Differenzen. Es wird eine Veränderung des Schulsystems gefordert, um den Bedürfnissen der Unterschicht besser gerecht zu werden.
Welche Quellen werden im Bericht verwendet?
Der Bericht verweist auf verschiedene Studien und Werke aus den Bereichen Soziologie, Linguistik und Pädagogik, darunter Studien zur sozialen Zusammensetzung von Studentenschaften und Untersuchungen zu Sprachbarrieren und Klassensprache.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Deichmann (Autor:in), 1999, Sozialer Hintergrund der Bildungselite - Ursachen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95826