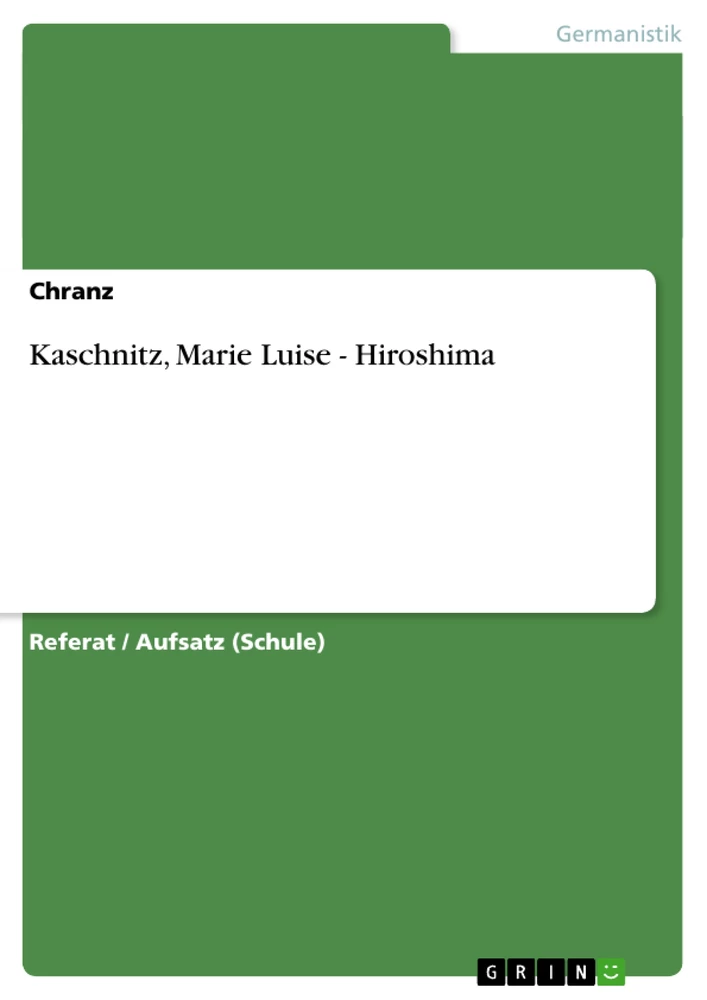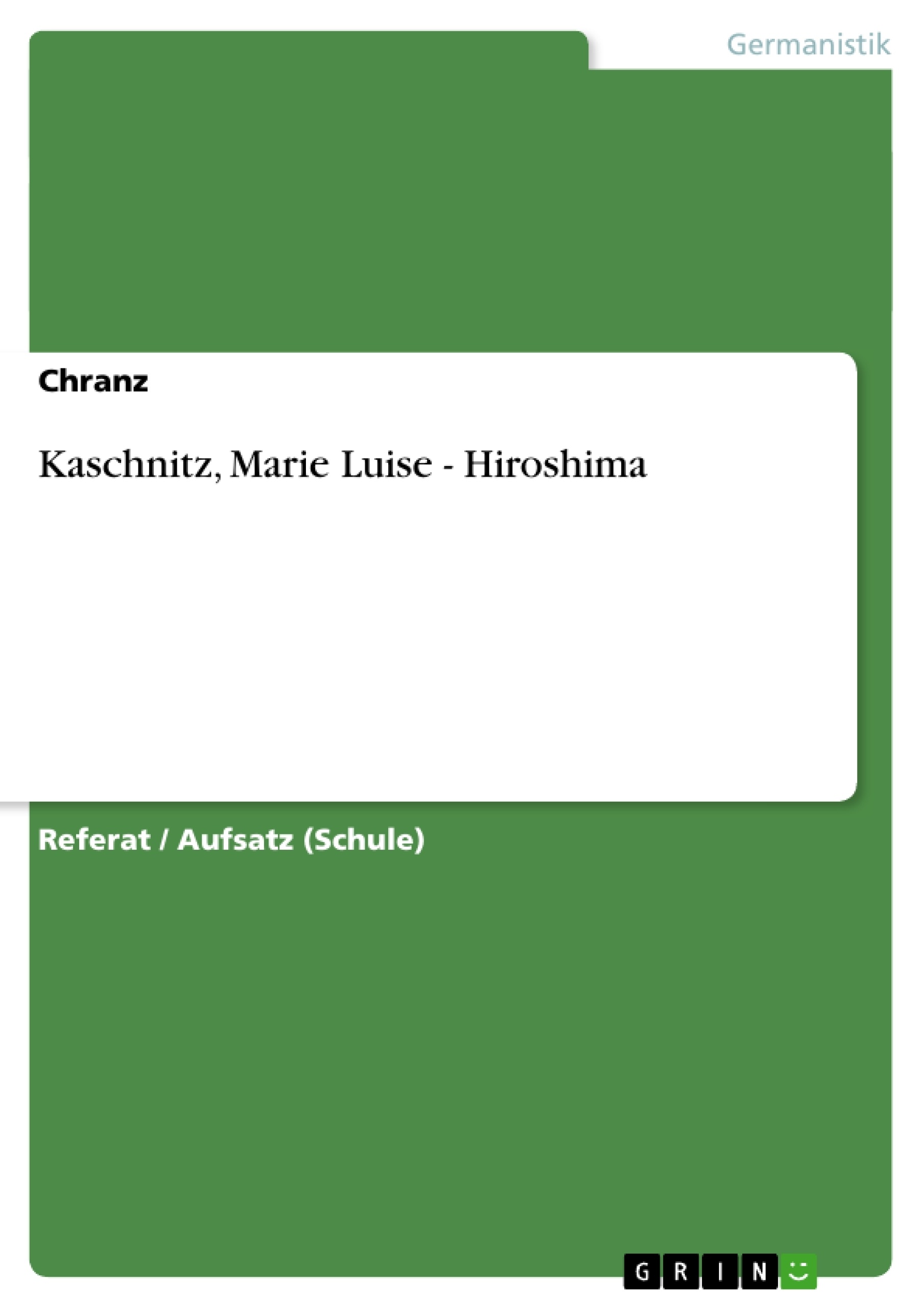Was geschah wirklich mit dem Piloten von Hiroshima? Marie Luise Kaschnitz entwirft in ihrem erschütternden Gedicht „Hiroshima“ ein vielschichtiges Bild der Schuld und der Verdrängung, das den Leser unweigerlich in seinen Bann zieht. Fernab von heroischen Erzählungen und simpler Schwarz-Weiß-Malerei konfrontiert uns die Autorin mit der komplexen Psyche eines Mannes, der zum Werkzeug einer unvorstellbaren Zerstörung wurde. War er ein von Schuld gepeinigter Sünder, der im Kloster Buße suchte, oder führte er ein unauffälliges Familienleben im Vorort, gezeichnet vom Schatten der Vergangenheit? Kaschnitz' Verse sind ein Echo auf die Schrecken des Krieges, ein Mahnmal gegen das Vergessen und eine eindringliche Auseinandersetzung mit der Frage nach individueller Verantwortung in Zeiten kollektiven Versagens. Die Analyse des Gedichts enthüllt die subtilen stilistischen Mittel, mit denen Kaschnitz arbeitet: Wiederholungen, Metaphern und der Bruch mit traditionellen Formen verstärken die beklemmende Atmosphäre und unterstreichen die Ambivalenz der dargestellten Figur. Der vermeintlich idyllische Familienvater wird durch das „Auge der Welt“, den hinter der Hecke lauernden Fotografen, entlarvt, und das Lachen wirkt plötzlich verzerrt, bedrohlich. Ist dies die Geschichte eines Mannes, der mit seiner Tat leben kann, oder nur eine Fassade, hinter der sich die unauslöschliche Erinnerung an Hiroshima verbirgt? Die Interpretation des Gedichts eröffnet einen tiefen Einblick in Kaschnitz' kritische Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgesellschaft und ihren Mechanismen der Verdrängung, ein Plädoyer für Humanität und eine Aufforderung, die Vergangenheit nicht ruhen zu lassen, um eine Wiederholung derartiger Gräueltaten zu verhindern. "Hiroshima" ist mehr als nur ein Gedicht; es ist ein Spiegel, der uns unsere eigene Fähigkeit zur Verblendung und zur Verdrängung vor Augen führt und uns zwingt, uns der unbequemen Wahrheit zu stellen. Ein literarisches Kleinod, das lange nachhallt und zum Nachdenken anregt, besonders relevant in einer Zeit, in der Frieden und Menschlichkeit mehr denn je auf dem Spiel stehen.
Marie Luise Kaschnitz (1901-1974)
Gedichtinterpretation - ,,Hiroshima"(1957)
Das Gedicht ,,Hiroshima", welches 1957 von Marie Luise Kaschnitz veröffentlicht wurde, handelt von dem Piloten, der am 6.8.1945 die Atombombe auf die Stadt Hiroshima in Japan warf. Es war der erste Einsatz einer Atombombe, wobei schätzungsweise zwischen 70000 und 200000 Menschen umkamen und 80 Prozent des Stadtgebietes vernichtet wurden. Marie Luise Kaschnitz ist eine 1901 in Karlsruhe geborene Offizierstochter mit dem Geburtsnamen Marie Luise von Holzing Beerstett. Sie entstammt dem elsässischen Adel und arbeitete zunächst im Buchhandel in Weimar und München. 1924 begann sie als Sekretärin am Archäologischen Institut in Rom zu arbeiten und heiratete ein Jahr später Guido von Kaschnitz-Weinberg. 1926 veröffentlichte sie erste Gedichte und Texte in Zeitungen später dann ganze Gedichtbände und Erzählungen. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1958 lebte sie als freie Schriftstellerin in Frankfurt. Sie ist vor allem als Lyrikerin in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen und für ihre Humanität in ihren Werken bekannt, weshalb sie auch im Jahre 1955 den Büchner-Preis erhielt. Sie starb 1974 in Rom und ist in Bollschweil begraben.
Nach dem ersten Lesen des Gedichtes erscheint es mir sehr fremd und eigenartig. Ich erhoffe mir von einer gründlichen Interpretation mehr Klarheit über ,,Hiroshima".
Das Gedicht ist in zwei Strophen untergliedert, die sich in Aufbau und Form deutlich unterscheiden.
Der Inhalt der ersten Strophe, die aus acht Zeilen besteht, trifft einige Aussagen über den Piloten, der die Atombombe auf Hiroshima abwarf. Es wird beschrieben, dass er ins Kloster ging und dort die Glocken läutete, sich selbst aufhing sowie wahnsinnig war und nachts Gespenster abwehrte, die ,,Auferstandene aus Staub" waren. Der Inhalt dieser Strophe stellt nichts anderes als die Nemesis-Legende dar, welche besagt, dass die Männer, der für den
Atombombenangriff zuständigen Einheit, von Schuldgefühlen geplagt worden wären, weshalb einer in ein Kloster mit Schweigepflicht eintrat, ein anderer irre geworden wäre und unter ihnen schlimme Krankheiten verbreitet waren.
Die 15-versige zweite Strophe hingegen wirkt wie eine Antithese zur Ersten. Sie beginnt mit der Aussage: ,,Nichts von alledem ist wahr." An dieser Stelle tritt das lyrische Ich aktiv auf, indem es sagt, dass es den Piloten vor einiger Zeit in einem Vorort gesehen hat. Er wird als lieber Familienvater mit einer jungen Frau und zwei Kindern beschrieben, sowie wie die Familie miteinander im Garten spielt. Zwei Textstellen sind jedoch besonders auffällig in dieser Strophe. Die erste Stelle sind die Zeilen 12 bis 13. Der Ich-Erzähler berichtet, dass die jungen Hecken und Rosenbüsche noch nicht groß genug wären, um sich hinter ihnen zu verstecken. Die andere Stelle sind die letzten drei Verse, welche aussagen, dass das Gesicht des Piloten vom Lachen ,,verzerrt" ist, da der Photograph hinter der Hecke steht. Der Photograph steht als Symbol für die gesamte Menschheit, wie die letzte Zeile zeigt. (,,[...] der Photograph hinter der Hecke stand, das Auge der Welt.") Diese beiden Textstellen werfen in meinen Augen ein negatives Licht auf die ansonsten, durch das heile Familienleben dargestellte, freundliche Strophe. Diese Stimmung wird durch die Wörter ,,verstecken" und ,,verzerrt" erzeugt, von welchen für mich eine gewisse Negativität ausgeht. Das Gedicht ist ein Prosagedicht, besitzt also keinen Reim und hat auch ansonsten keine geschlossene Form. Es wirkt auf mich auch noch ,,offener" durch die unterschiedlichen Längen und den gegensätzlichen Inhalte der beiden Strophen. Während der Pilot in der ersten Strophe als ,,Bösewicht" dargestellt wird und für seine Fehler büßen muss, ist er in der zweiten Strophe der liebe Ehemann und Vater einer glücklichen Familie in einer scheinbar heilen Welt. Dieser Kontrast, der hier von Marie Luise Kaschnitz verwendet wird ist nur ein künstlerisches Mittel, dass sie in ihrem Gedicht ,,Hiroshima" verwendet. Weiterhin nutzt sie die Wirkung der stilistischen Mittel Wiederholung sowie Metapher. Die Wiederholung ist in der ersten Strophe angewandt. Hier wird der erste Vers in der dritten und in der fünften Zeile wiederholt. Dieser Vers verkörpert in meinen Augen eine Anklage an den Piloten, denn es heißt nicht: der die Bombe auf Hiroshima warf, sondern: ,,Der den Tod auf Hiroshima warf [...]". Und das Wort Tod strahlt für mich ein ungeheuer hohes Maß an Spannung und Negativem aus. Dieser Vers prägt die erste Strophe ganz erheblich, wodurch die Strophe sehr gespannt und durchaus traurig wirkt. Schuld daran ist auch, dass diese große Last einem Einzigen angehangen wird, nämlich dem, der die Bombe abgeworfen hat. Weiterhin verwendet die Autorin einige Metapher, wie zum Beispiel: ,,Die Hecken waren noch jung [...]". Das ist zwar eine Personifizierung, diese Tatsache scheint für mich jedoch hintergründig zu sein. Jung bedeutet halt nicht alt. Marie Luise Kaschnitz will in meinen
Augen damit ausdrücken, dass, auch wenn zwölf Jahre (Zeit zwischen Bombenabwurf und Erscheinung des Gedichtes) eine lange Zeit sind und Hecken in dieser Zeit sehr groß werden können, die Wunden immer noch tief sind und noch lang kein Gras über die Sache gewachsen ist. Auch der Photograph ist eine Metapher und steht für die Gesamtheit der Menschen, die den Piloten beobachten. Dieser Metapher wird jedoch in der letzten Zeile von der Autorin selbst ,,entschlüsselt".
Auf mich wirkt das Gedicht ,,Hiroshima" von Marie Luise Kaschnitz so, als dass sie die Nemesis-Legende mit diesem Werk in Frage stellen möchte, bzw. die Leser zum Nachdenken über diesen Sachverhalt anregen möchte. Das würde also bedeuten, dass diese Legende nur ein Gerücht sei, dass, wahrscheinlich von den Amerikanern, verbreitet wurde, um zu zeigen, dass sie die schrecklichen Folgen des Bombenabwurfs erschreckt habe und sie sozusagen ihre gerechte Strafe (Nemesis ist die griechische Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit) bereits bekommen haben. In Wirklichkeit hingegen sei dass nur eine Lüge und die verantwortlichen Männer führen ein gutes Leben und sind wohlmöglich noch stolz auf ihre Leistung. So steht der, ,,[...] der den Tod auf Hiroshima warf [...]" stellvertretend für alle, die für dieses schreckliche Ereignis verantwortlich sind, und für einen großen Teil der Amerikaner, die in ihrem Patriotismus diese Menschen als Helden feierten. Ich glaube auch, dass die Autorin die Leser dazu aufruft nicht zu vergessen, was da schreckliches passiert ist und zu versuchen, eine Wiederholung dieses Unglücks zu vermeiden, jedenfalls kann ich das aus diesem Gedicht für mich entnehmen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Gedichtinterpretation ,,Hiroshima" von Marie Luise Kaschnitz?
Die Gedichtinterpretation beschäftigt sich mit dem Gedicht ,,Hiroshima" von Marie Luise Kaschnitz (1957), das den Piloten thematisiert, der 1945 die Atombombe auf Hiroshima abwarf. Die Interpretation analysiert die zwei Strophen des Gedichts und ihre gegensätzlichen Darstellungen des Piloten.
Was wird in der ersten Strophe des Gedichts dargestellt?
Die erste Strophe beschreibt den Piloten als von Schuldgefühlen geplagt, der ins Kloster geht, sich erhängt, wahnsinnig wird und Gespenster abwehrt. Dies wird als Darstellung der Nemesis-Legende interpretiert, wonach die an dem Atombombenangriff beteiligten Personen unter Schuld leiden.
Wie unterscheidet sich die zweite Strophe von der ersten?
Die zweite Strophe präsentiert eine Antithese zur ersten, indem sie behauptet, dass nichts von dem in der ersten Strophe Geschilderten wahr sei. Das lyrische Ich beschreibt den Piloten als liebevollen Familienvater in einem Vorort.
Welche stilistischen Mittel werden in dem Gedicht verwendet?
Das Gedicht ist ein Prosagedicht ohne Reim oder geschlossene Form. Es verwendet den Kontrast zwischen den beiden Strophen, die Wiederholung des Verses ,,Der den Tod auf Hiroshima warf [...]" in der ersten Strophe sowie Metaphern wie ,,Die Hecken waren noch jung [...]" und den Photographen als Symbol für die Menschheit.
Welche Bedeutung hat der Photograph hinter der Hecke?
Der Photograph wird als Metapher für die Gesamtheit der Menschen interpretiert, die den Piloten beobachten und somit Zeugen der Ereignisse sind. Die Autorin entschlüsselt diese Metapher selbst in der letzten Zeile des Gedichtes.
Welche Botschaft vermittelt Marie Luise Kaschnitz mit dem Gedicht?
Die Interpretation legt nahe, dass Kaschnitz mit dem Gedicht die Nemesis-Legende in Frage stellen und die Leser zum Nachdenken über die Verantwortlichkeit und die Folgen des Atombombenabwurfs anregen möchte. Es wird vermutet, dass die Autorin davor warnt, die Schrecken der Vergangenheit zu vergessen und eine Wiederholung zu verhindern.
Welche Rolle spielt das Wort "verzerrt" im Bezug auf das Gesicht des Piloten?
Die Interpretation vermutet, dass die Beschreibung des verzerrten Gesichts des Piloten ein negatives Licht auf die Darstellung der heilen Familie wirft und eine innere Spannung oder Schuld des Piloten andeutet.
- Arbeit zitieren
- Chranz (Autor:in), 1999, Kaschnitz, Marie Luise - Hiroshima, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95738