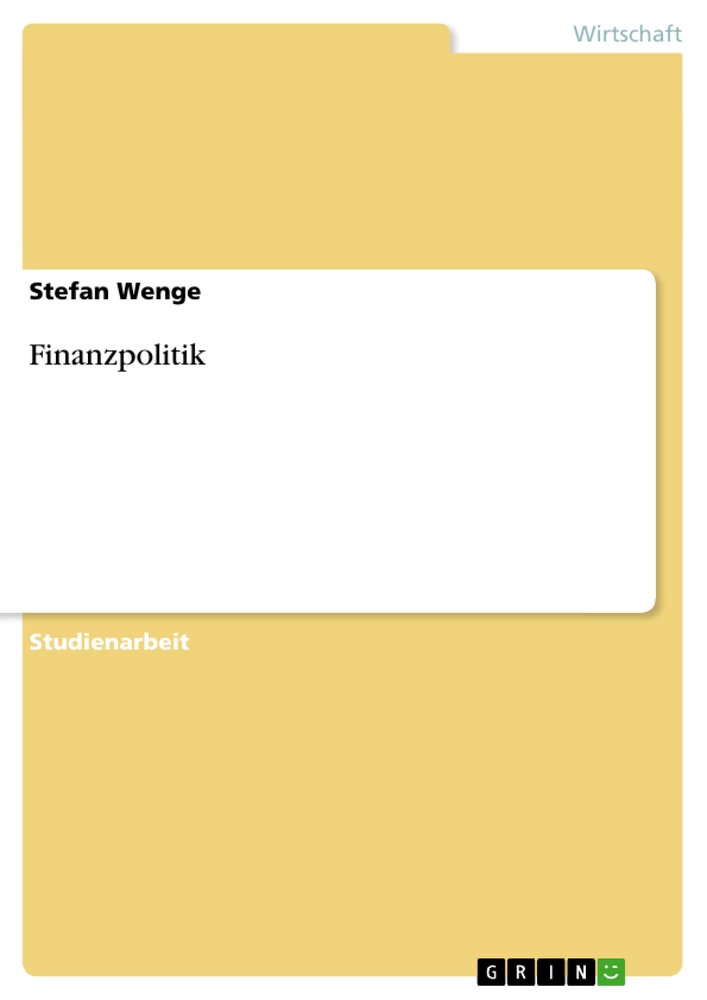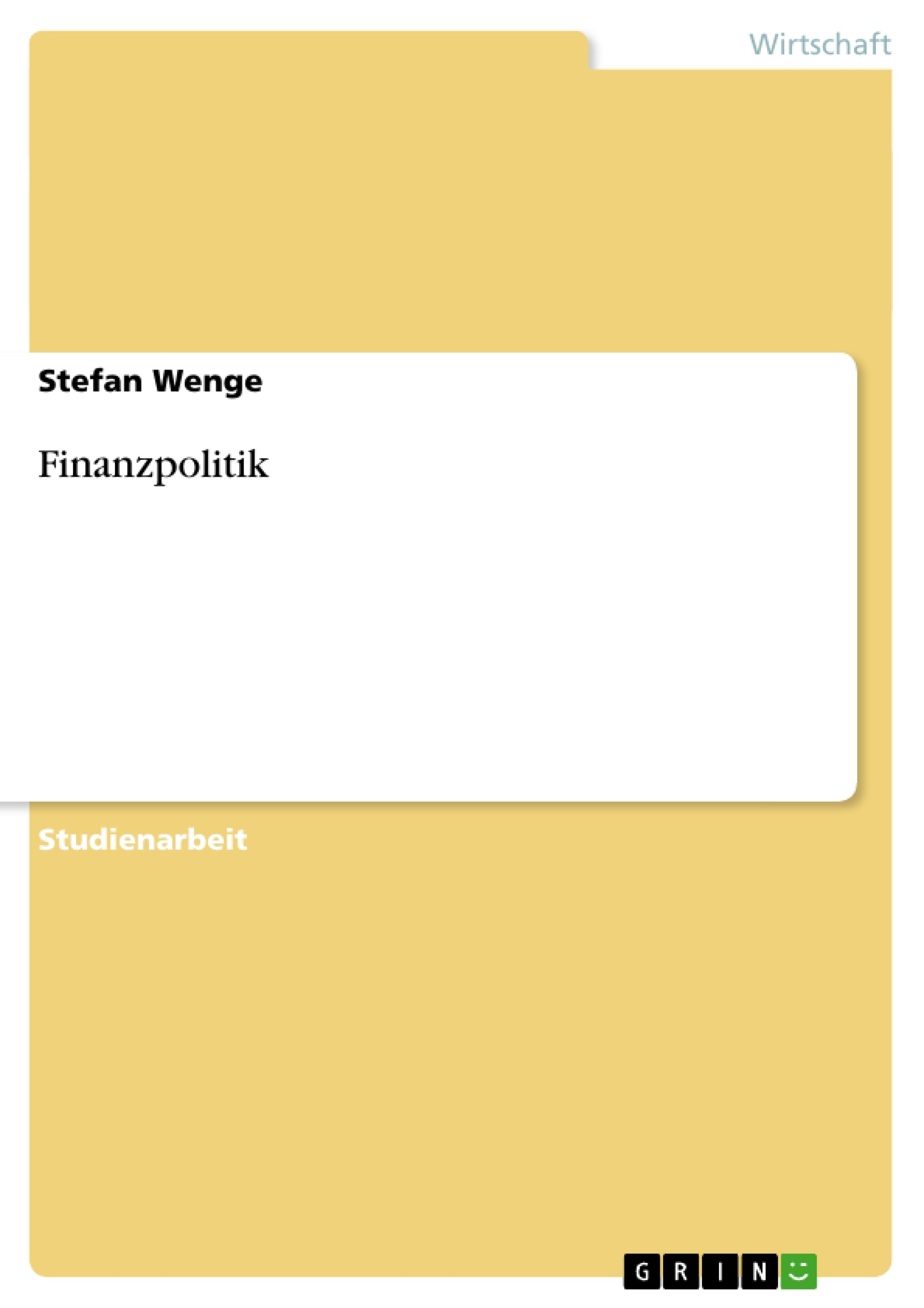Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
1 Begriff/Abgrenzung
2 Ziele der Finanzpolitik
2.1 Allokationsziel
2.2 Distributionsziel
2.3 Stabilisierungsziel
2.4 Nachhaltigkeitsziel
3 Finanzpolitische Instrumente
4 Die öffentlichen Haushalte in ausgewählten EU-Ländern von 1980 bis 1995
4.1 Situation
4.2 Ausgaben
4.3 Einnahmen
4.4 Fazit
5 Ausblick: Finanzpolitische Fragestellungen im Hinblick auf die EWWU
II Literaturverzeichnis
I Einleitung
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll ein grundlegender Überblick über die öffentliche Finanzpolitik vermittelt werden. Dabei wird sowohl auf die finanzpolitischen Ziele und Instrumente, als auch auf öffentliche Haushalte ausgewählter europäischer Länder im Vergleich mit der BRD eingegangen.
Im ersten Kapitel wird einführend der Begriff Finanzpolitik definiert und in die Einordnung in den Bereich der Wirtschaftswissenschaften erläutert. Eine Abgrenzung der Finanz- und Fiskalpolitik scheint unumgänglich, da irrtümlicherweise diese beiden Begriffe häufig gleichgesetzt werden. Die theoretischen einführenden Erläuterungen schließen ab mit den Trägern der Finanzpolitik.
Das zweite Kapitel setzt sich mit den vier finanzpolitischen Zielen auseinander. Auf das Stabilisierungsziel wird aufgrund der herausragenden Bedeutung ausführlicher eingegangen.
Gegenstand des dritten Kapitels ist eine Erläuterung der Struktur der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen in Anlehnung an die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
Das vierte Kapitel stellt einen europäischen finanzpolitischen Bezug auf. Gegenstand der Ausführungen dieses Kapitels ist die Entwicklung der öffentlichen Haushalte in Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien von 1980 bis 1995 anhand empirischer Daten.
Das letzte Kapitel gibt einen Ausblick auf finanzpolitische Maßnahmen und Vorbereitungen, die getroffen werden müssen, um eine erfolgreiche europagerechte Finanzpolitik in Hinblick auf die EWWU ermöglichen zu können.
1 Begriff / Abgrenzung
Unterschieden wird zwischen der betrieblichen Finanzpolitik (= die Summe aller Maßnahmen der Finanzierung einer Unternehmung zur Befriedigung des Kapitalbedarfs) und der öffentlichen Finanzpolitik, ein Instrument der Wirtschaftspolitik (vgl. Gabler, Stichwort: Finanzpolitik). Gegenstand der folgenden Ausführungen ist die öffentliche Finanzpolitik.
Die Finanzwissenschaft ist Teil der Wirtschaftswissenschaften und läßt sich unterteilen in die Finanztheorie, die Finanzsoziologie und die Finanzpolitik. ,,Finanzpolitik ist die Gesamtheit staatlicher Maßnahmen zur Gestaltung der öffentlichen Finanzwirtschaft. Ihre Gestaltung richtet sich nach den jeweiligen politischen Zielsetzungen und der geltenden
Finanzverfassung." (Rittershofer, 1994, S. 208)
,,Die Finanzpolitik verfolgt das Ziel, Struktur und Höhe des Sozialprodukts einer Volkswirtschaft mit Hilfe öffentlicher Einnahmen und öffentlicher Ausgaben zu beeinflussen; sie dient aber auch anderen Politikbereichen, sofern dort öffentliche Mittel eingesetzt werden." (Gabler, Stichwort: Finanzpolitik) Unter Finanzpolitik versteht man also ganz allgemein den Einsatz der öffentlichen Finanzen zur besseren Erreichung wirtschaftlicher Ziele.
,,Grundsätzlich muß zwischen Finanz- und Fiskalpolitik unterschieden werden. Zur Fiskalpolitik sind alle staatlichen Maßnahmen zu rechnen, deren Ziel es ist, den Staatshaushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Die Maßnahmen, die unter Finanzpolitik verstanden werden, dienen anderen Zielen als dem Haushaltsausgleich und stehen möglicherweise in Konflikt mit der fiskalischen Zielsetzung." (Altmann, 1995, S. 260) Jedoch sehen viele Autoren die Fiskalpolitik als Teil der Finanzpolitik, was deutlich macht, welche Zielkonflikte und Probleme finanzpolitischer Steuerung entstehen können. Die in der deutschen Literatur anzutreffende Gleichsetzung von Finanz- und Fiskalpolitik ist offensichtlich auf eine undifferenzierte Übersetzung des englischen Begriffs ,,fiscal policy", welche im Sinne von ,,Finanzpolitik" verwendet wird, zurückzuführen.
In der Bundesrepublik Deutschland sind der Bund, die Länder und die Gemeinden Träger der Finanzpolitik. Jeder Entscheidungsebene obliegen bestimmte Aufgaben, dem Bund u.a. die Verteidigung und die soziale Sicherung, den Ländern die Bildungspolitik, den Gemeinden der Aufbau der örtlichen Infrastruktur. Es kommt zur Mischfinanzierung, sobald eine Aufgabe mehrere Ebenen betrifft. ,,Auf jeder staatlichen Ebene sind die Entscheidungsprozesse durch die Gewaltenteilung nach Legislative, Exekutive und Judikative sowie durch den Einfluß von Parteien und Verbänden vielfältig strukturiert. Hinzu kommt der Einfluß supranationaler Institutionen; hinzuweisen ist auf das zunehmende Gewicht der Europäischen Union und der NATO bei nationalen finanzpolitischen Entscheidungen."(Gabler, Stichwort: Finanzpolitik)
2 Ziele der Finanzpolitik
2.1 Das Allokationsziel
Unter Allokationsziel versteht man die optimale, sinnvolle Verbindung der Produktionsfaktoren. Bei der Verfolgung des Allokationsziels übernimmt die öffentliche Hand die Produktion, wenn aus systematischen Gründen die Märkte versagen bzw. Marktunvollkommenheiten vorliegen. Die finanzpolitischen Entscheidungsträger nehmen Einfluß auf die Struktur der Produktion, wobei natürlich auch die Verteilung der Produktionsfaktoren verändert wird.
,,Marktunvollkommenheiten liegen beispielsweise dann vor, (1) wenn sogenannte externe Effekte (Kosten oder Erträge) auftreten, die in die privatwirtschaftlichen Entscheidungskalküle keinen Eingang finden, (2) wenn die Durchsetzung des für die Marktwirtschaft typischen Abschlußprinzips nicht oder nur zu exzessiven Kosten möglich ist, (3) die Unternehmerinitiative allein nicht ausreicht oder die (4) Konsumentenpräferenzen gestört sind." (Petersen, 1993, S. 36).
Der entscheidende Grund für das Marktversagen liegt darin, daß die Nutzen der öffentlichen Güter nicht auf einen bestimmten Konsumenten beschränkt sind, der diese Güter erwirbt, wie das bei privaten Gütern der Fall ist, sondern allen anderen gleichermaßen zugute kommt. Um die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt zu erhöhen, muß eine Reallokation der Ressourcen durchgeführt werden.
2.2 Das Distributionsziel
Unter dem Distributionsziel versteht man die Korrektur der Einkommensverteilung durch Einsatz der öffentlichen Finanzen. Neben schwer erfaßbaren Gerechtigkeitsüberlegungen steht dahinter auch der Gedanke, daß eine allzu ungleiche Einkommensverteilung zu sozialen Unruhen führt, die letztlich auch die Effizienz einer Marktwirtschaft beeinträchtigen. Die Verteilung des Einkommens auf die Produktionsfaktoren nach deren ,,Funktion" im Produktionsprozeß wird üblicherweise als funktionelle Verteilung bezeichnet. Als personelle Verteilung bezeichnet man die Verteilung der Einkommen auf Personen bzw. Personengruppen. Dabei bleibt unberücksichtigt, welche Funktion sie im Produktionsprozeß ausüben bzw. aus welchen ,,Quellen" ihre Einkommen fließen.
,,Die sich aus dem Marktprozeß ergebene Verteilung heißt primäre Verteilung. Sie ist nur eine vorläufige Verteilung, denn sie wird durch vielfältige Aktivitäten des Staates verändert. Die Einkommen werden durch Erhebung von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen etc. vermindert, aber auch durch Einkommensübertragungen (Renten, Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung, Kindergeld, Mietbeihilfen, Subventionen usw.) erhöht. Diese sich nach der staatlichen Umverteilung ergebende Einkommensverteilung nennt man üblicherweise sekundäre Verteilung." (Ahrns, 1994, S. 166)
2.3 Das Stabilisierungsziel
Der Stellenwert unter den Hauptzielen und die Teilziele Seit der Weltwirtschaftskrise ist das Stabilisierungsziel zunehmend in den Vordergrund der Finanzpolitik getreten. Es hatte sich gezeigt, daß die Selbstheilungskräfte des Marktes eben nicht ausreichten, um eine nachhaltige Wirtschaftskrise zu überwinden. Mittlerweile wird das Stabilisierungsziel als das wesentliche Ziel angesehen. Aus diesem Grund erscheint eine ausführlichere Behandlung des Stabilisierungsziels als gerechtfertigt.
Das Stabilisierungsziel erstreckt sich auf das sogenannte magische Viereck, nämlich: hoher Beschäftigungsstand, Preisniveaustabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Diese vier Teilziele nennt auch das deutsche Stabilitätsgesetz, das 1967 initiiert wurde. (vgl. Petersen, 1993, S. 37)
Hoher Beschäftigungsstand
Die Forderung nach Vollbeschäftigung ist spätestens seit der Weltwirtschaftskrise ein unverzichtbares wirtschaftspolitisches Ziel. Die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit ist jedoch unvermeidbar, folglich kann das Arbeitskräftepotential nicht zu 100% ausgelastet werden. Aus diesem Grund spricht das StabG nicht von Vollbeschäftigung, sondern von einem hohen Beschäftigungsstand. Arbeitslosigkeit bedeutet gesamtwirtschaftlich den Verzicht auf Produktionsmöglichkeiten und eine bessere Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sowie auf Einkommen. Soziale Nachteile der Arbeitslosigkeit sind der Verstoß gegen gesellschaftliche Grundziele wie Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Wohlstand. Durch Arbeitslosigkeit werden soziale Chancen der Betroffenen vermindert. Die Anpassung an den Strukturwandel wird durch hohen Beschäftigungsstand erleichtert. ,,Das StabG verpflichtet die staatliche Wirtschaftspolitik, gegen konjunkturelle und strukturelle Arbeitslosigkeit vorzugehen, wohingegen saisonale und friktionale Arbeitslosigkeit - zumindest in einem gewissen zeitlichen Umfang - zu akzeptieren sei." (Ahrns, 1994, S. 91)
Die steigende Arbeitslosigkeit gerade in den letzten Jahren in der Bundesrepublik verleiht dem Teilziel hoher Beschäftigungsstand eine besondere Bedeutung.
Quelle: Bundesarbeitsministerium
Preisniveaustabilität
Preisniveaustabilität ist nicht dasselbe wie Preisstabilität. Preisstabilität bedeutet mikroökonomisch, daß ein einzelner Preis konstant ist, und makroökonomisch, daß sich alle betrachteten Preise nicht verändern. Preisniveaustabilität heißt, daß der (gewichtete) Durchschnitt aller Preise stabil bleibt. In einer marktwirtschaftlichen Ordnung sollen die Güterpreise nicht stabil sein, sondern sich bei Veränderungen von Angebot und Nachfrage als Ausgleichsmechanismus der veränderten Marktsituation entsprechend anpassen. Preissteigerungen und Preissenkungen sollen sich aber kompensieren. Preisniveaustabilität im strengen Sinn ist also gleichbedeutend mit einer Inflationsrate von Null, auch wenn im politischen Raum ein bis zwei Prozent Inflation oft noch als ,,Stabilität" toleriert werden. Inflation ist also gleichbedeutend mit anhaltenden Preissteigerungen auf breiter Front. Zwischen 1949 und 1953 gab es in der Bundesrepublik negative Inflationsraten, in diesem
Falle spricht man von Deflation. (vgl. Altmann, 1995, S. 128 f.)
,,Das Phänomen ,,Inflation" ist dabei im wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: zu starke Ausdehnung der Geldmenge (Geldmengen-Inflation), zu hohe Nachfrage im Vergleich zum Angebot (Nachfragesog-Inflation), Steigerungen der Produktionskosten (Kostendruck-Inflation), eine die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft übersteigende Ausdehnung der Einkommensansprüche (Anspruchs-Inflation), oligopolistische Marktstrukturen und das damit verbundene Investitionsverhalten der nationalen und multinationalen Konzerne." (Ahrns, 1994, S. 91)
Außenwirtschaftliches Gleichgewicht
,,Für ein Land mit hoher außenwirtschaftlicher Verflechtung (sogenannte offene
Volkswirtschaft) besteht die Notwendigkeit möglichst ausgeglichener
Außenwirtschaftsbeziehungen, um die Vorteile internationaler Arbeitsteilung auf längere Sicht nutzbar machen zu können. Zugleich sollen diese Beziehungen derart sein, daß von ihnen keine negativen Einflüsse auf die binnenwirtschaftlichen Ziele ausgehen." (Ahrns, 1994, S. 91)
Statistisch festgehalten werden die Außenwirtschaftsbeziehungen in der Zahlungsbilanz. Sie ist eine wertmäßige Gegenüberstellung aller außenwirtschaftlichen Beziehungen eines Landes für einen bestimmten Zeitraum. Errechnet wird sie in Deutschland von der Bundesbank und setzt sich zusammen aus folgenden Teilbilanzen: Handelsbilanz, Dienstleistungsbilanz, Übertragungsbilanz, Kapitalbilanz, Gold- und Devisenbilanz, Rest- und Ausgleichsposten. Die Handelsbilanz, auch Waren- oder Warenhandelsbilanz genannt, erfaßt Importe und Exporte von Sachgütern, die Dienstleistungsbilanz Exporte und Importe von Dienstleistungen. In der Übertragungsbilanz, auch Schenkungs- oder Transferbilanz genannt, werden alle Leistungen ohne direkt zurechenbare Gegenleistungen erfaßt, zum Beispiel Beiträge zu internationalen Organisationen und Institutionen. Die Kapitalbilanz, auch Kapitalverkehrsbilanz genannt, erfaßt alle Forderungen und Verbindlichkeiten der privaten Wirtschaft und des Staates (außer der Notenbank) gegenüber dem Ausland. Die Gold- und Devisenbilanz, die auch als Auslandsposition der Bundesbank bezeichnet wird, erfaßt die Veränderung der Aktiva und Passiva der Notenbank. (vgl. Altmann, 1995, S. 176 ff.) Außenwirtschaftliches Gleichgewicht bedeutet demnach Zahlungsbilanzgleichgewicht und liegt vor, wenn die Gold- und Devisenbilanz für einen längeren Zeitraum ausgeglichen ist. Das Ziel außenwirtschaftlichen Gleichgewichts ist jedoch kein Selbstzweck, sondern hat instrumentalen Charakter im Hinblick auf die Verfolgung binnenwirtschaftlicher Ziele wie Preisniveaustabilität und hoher Beschäftigungsstand.
Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum
Wirtschaftswachstum ist die Bezeichnung für die langfristige Entwicklung einer Volkswirtschaft. Maßstab zur Messung des Wirtschaftswachstums ist die reale Zunahme des Bruttosozialprodukts. Bei einer Beurteilung der Zuwachsrate des wirtschaftlichen Wachstums müssen dessen Qualität und das Ausgangsniveau mit beachtet werden. Beispielsweise besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Wachstum, das der Verbesserung der Lebensqualität dient und dem Wachstum, welches aufgrund ungezügelter Produktion von Rüstungsgütern zustande kommt. (vgl. Rittershofer, 1994, S. 616) Ohne zugleich wachstumspolitische Instrumente mit festzulegen, ist in der Bundesrepublik das Wachstumsziel durch gesetzliche Formulierungen zum Beispiel im StabG und im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) institutionalisiert worden.
,,Stetiges Wachstum bedeutet nicht periodisch konstantes Wachstum, da konjunkturelle Schwankungen nicht vollständig vermeidbar sind, sondern in der Regel positive Wachstumsraten. Stetiges Wachstum kann deshalb nur am Wachstumstrend orientiert sein und ist langfristig auch ein von Schwankungen weitgehend befreites Wachstum. Angemessenes Wachstum dagegen ist analytisch nicht exakt festlegbar, es ist eine Leerformel (im Sinne von unbestimmter Rechtsbegriff) und wird meist in den Zielprojektionen der Bundesregierung gemäß der aktuellen Wirtschaftslage konkretisiert." (Ahrns, 1994, S. 125) Demnach strebt man optimales Wachstum an, nicht maximales Wachstum. Gründe für das Wachstumsziel sind u.a. die Sicherung und Erhöhung der Wohlfahrt, die (zumindest partielle) Verwirklichung des gesellschaftspolitischen Freiheitsziels, die Entschärfung bestehender Verteilungskonflikte, der Vollzug des ökonomischen Strukturwandels in Wachstumsphasen mit geringeren wirtschaftlichen und sozialen Kosten, die Verkürzung der Arbeitszeit und die Ermöglichung von zusätzlichen gesellschaftlichen Ansprüchen.
Die folgende Abbildung stellt abschließend wesentliche Argumente für und gegen Wachstum gegenüber.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3 Argumente für und gegen Wachstum
Quelle: Altmann, Jörn: Wirtschaftspolitik, 6. Auflage, 1995, S. 47
2.4 Das Nachhaltigkeitsziel
Die makroökonomische Literatur zeigt, daß gerade in Kreislaufmodellen im wesentlichen monetäre Ströme erfaßt werden, die zwischen privaten Haushalten, Unternehmen, Staat und Ausland fließen. Die vielfältigen Verflechtungen zwischen dem Wirtschaftssystem und der Natur bleiben dabei fast unbeachtet. Desto deutlicher wird die Aktualität des Nachhaltigkeitsziels. Die wesentliche Lebensvoraussetzung für die Menschheit ist eben eine intakte Natur und gesunde Umwelt. Man darf die Natur nicht ausschließlich als Ressourcenlieferant für die Menschheit betrachten, sonst steht die Natur nicht unbegrenzt zur Verfügung. Sowohl die erschöpfbaren Ressourcen (z.B. Erdöl) als auch die regenerierbaren Ressourcen (z.B. die pflanzliche Produktion) geraten bei Überbeanspruchung der natürlichen Assimilationsfähigkeit in Gefahr. Unter Berücksichtigung der Interessen der zukünftigen Generationen ist es daher notwendig, die Tragfähigkeit einer Region, eines Staates bzw. der Erde zu bestimmen. (vgl. Petersen, 1993, S.37)
,,Nachhaltiges Wirtschaften heißt konkret, den Ressourceneinsatz in der Wirtschaft (z.B. über steigende Ressourcenpreise) durch technischen Fortschritt zu reduzieren, regenerierbare Ressourcen nur soweit auszubeuten, daß ihre Regenerationsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird und erschöpfbare Ressourcen lediglich in einem Ausmaß abzubauen, in dem nicht- erschöpfbare Substitute geschaffen werden können (Daly)." (Petersen, 1993, S. 38) Nach dieser Definition bringt nachhaltiges Wirtschaften gleichzeitig einen materiellen Wohlfahrtsverlust mit sich, der möglichst gering ausfallen wird, je schneller der technische Fortschritt auf ressourcen- und umweltschonende Produktion eingestellt wird. Die zunehmende Wichtigkeit der Umweltpolitik, aber auch das umweltpolitische Instrumentarium machen die Verknüpfung zwischen der Finanz- und Umweltpolitik deutlich. Beispielsweise umweltpolitische Instrumente wie Emissionssteuern und Subventionen stehen in engem Zusammenhang mit den finanzpolitischen Instrumenten öffentliche Einnahmen und öffentliche Ausgaben. Aus diesen Gründen scheint es als gerechtfertigt, das Nachhaltigkeitsziel dem MUSGRAVEschen Zielkatalog, der aus den drei oben genannten Hauptzielen besteht, hinzuzufügen. Zu beachten ist außerdem, daß man sich u.a. angesichts der Europäischen Union und der Weltwirtschaft nicht nur auf nationale Umweltprobleme beschränkt, sondern ebenfalls grenzüberschreitende und globale Umweltprobleme behandelt.
3 Finanzpolitische Instrumente
Die öffentlichen Ausgaben
Ausgaben sind Geldzahlungen des Staates, mit denen die Erfüllung öffentlicher Aufgaben angestrebt wird. Sie lassen sich unterteilen in Ausgaben für Güter und Dienste und in Transferzahlungen.
Bei den Ausgaben für Güter und Dienste erstreckt sich die Nachfrage der öffentlichen Hand auf einen Teil des Sozialprodukts. Zusätzliche Ausgaben dieser Art schlagen sich in Gehältern, Löhnen, Gewinnen, Zinsen usw. nieder. Diese Einkommen werden entweder über staatliche Käufe zu Einkommen in der privaten Sphäre, oder direkt vom Staat über Personalausgaben oder Faktorentgelte bezogen. Keine Einkommensvermehrung aus produktiver Tätigkeit bewirken demgegenüber die Transferzahlungen. Durch die Ausgabe wird demnach das Sozialprodukt nicht berührt, Geldmittel werden lediglich umverteilt. Die Transferzahlungen setzen sich zusammen aus den sozialen Leistungen, den Subventionen und den Staatsschuldzinsen. (vgl. Petersen, 1993, S. 41 f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: Gliederung der staatlichen Gesamtausgaben in Anlehnung an die VGR (Stand: 1991)
Quelle: Petersen, Hans-Georg: Finanzwissenschaft I, 3. Auflage, 1993, S. 42
Die öffentlichen Einnahmen
Die öffentlichen Einnahmen gewährleisten die Finanzierung der öffentlichen Ausgaben. Direkte Steuern (im wesentlichen Lohn-, Einkommens- und Vermögenssteuern) und indirekte Steuern (insbesondere Mehrwert- und Verbrauchsteuern) zusammen sind die Steuern im engeren Sinne. Bei indirekten Steuern besteht zwischen Steuerzahler und Finanzamt nur indirekt über den Verkäufer der Ware eine Beziehung, dagegen werden direkte Steuern unmittelbar vom Steuerpflichtigen an das Finanzamt abgeführt. Steuern im weiteren Sinne setzen sich zusammen aus den Beiträgen (im wesentlichen Sozialbeiträge) und den Steuern im engeren Sinne. Die Erwerbseinkünfte, die Zinseinkünfte und die Steuern im weiteren Sinne ergeben die laufenden Einnahmen. Die Kredite (außerordentliche Einnahmen / Netto- Neuverschuldung) und die laufenden Einnahmen sind die gesamten öffentlichen Einnahmen. (vgl. Petersen, 1993, S. 42 f.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.4: Gliederung der öffentlichen Einnahmen in Anlehnung an die VGR (Stand: 1991)
Quelle: Petersen, Hans-Georg: Finanzwissenschaft I, 3. Auflage, 1993, S. 43
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.1: Die Entwicklung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben in der BRD von 1985 bis 1998 in Mrd. DM
(1) Schätzung.
(2) Ohne Bundesbankgewinn.
"Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des DIW."
4 Die öffentlichen Haushalte in ausgewählten EU-Ländern von 1980 bis 1995
4.1 Die Situation
Gegenstand der Ausführungen in diesem Kapitel sind die öffentlichen Haushalte von 1980 bis 1995 in den EU-Ländern Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
In den meisten Ländern der Europäischen Union gelang es in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre durch eine verstärkte Ausgabendisziplin, durch Erhöhungen der indirekten Steuern, durch bessere Abschöpfung der Steuerpotentiale und durch Anhebungen der Sozialbeiträge, die öffentlichen Haushalte merklich zu konsolidieren. Die weltweite wirtschaftliche Abschwächung bewirkte jedoch in fast allen EU-Ländern eine rapide Verschlechterung der Situation der öffentlichen Haushalte. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich, ebenso die Einkommensübertragungen an private Haushalte. Trotz einer in den meisten Ländern steigenden Steuer- und Abgabenquote hielt der Einnahmenzuwachs mit der Ausgabensteigerung nicht Schritt. Neben diesen Umständen bewirkte auch das Streben einiger EU-Länder, die Konvergenzkriterien für den Eintritt in die Europäische Währungsunion zu erfüllen, ein verlangsamtes Vorankommen der Konsolidierung. (Dänemark und Großbritannien gehören zunächst nicht der EWU an, obwohl sie EU-Länder sind.)
4.2 Die Ausgaben
Die gewichtigsten Größen unter den Staatsausgaben sind die Sozialleistungen und der Staatsverbrauch, bei dem die Entgelte für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes dominieren. Der für Deutschland ausgewiesene hohe Wert der Sozialleistungen enthält auch die sogenannten sozialen Sachleistungen (größtenteils Krankenhausleistungen), die von den Gebietskörperschaften bereitgestellt, aber von der Sozialversicherung übernommen und aus Beiträgen finanziert werden. In Großbritannien wird das Gesundheitswesen von den Gebietskörperschaften getragen. Die entsprechenden Leistungen werden unmittelbar im Staatsverbrauch verbucht. Die Sozialbeiträge sind in Großbritannien und in Dänemark sehr niedrig, weil die Leistungen größtenteils über die allgemeinen Steuereinnahmen finanziert werden.
Die Sozialleistungen wiesen in allen vier EU-Ländern von 1980 bis 1995 einen Anstieg um drei bis sechs Prozentpunkte auf (vgl. Tab.2), jedoch haben Sozialleistungen und -beiträge in diesen Ländern ein unterschiedliches Gewicht. Während die Sozialleistungen in Dänemark und Frankreich in Relation zum BIP gut ein Fünftel, in Deutschland sogar gut ein Viertel ausmachten, war es in Großbritannien nur knapp ein Siebtel. Noch stärker sind die Unterschiede bei den Sozialbeiträgen (vgl. Tab.4). Der Anteil der Sozialbeiträge in Dänemark am BIP betrug 1995 nur 2,9 %, in Großbritannien 6,3 %, in Deutschland 19,3 % und in Frankreich 21,0 %.
Der Dynamik der Ausgabenentwicklung im sozialen Bereich wollte man in den letzten Jahren begegnen. So wurde beispielsweise in Deutschland und Frankreich bei der Rentenversicherung das Rentenalter angehoben, und die Anspruchsgrundlagen wurden enger gefaßt. In Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurden über Reformen des Gesundheitswesens Leistungen eingeschränkt und die Eigenbeteiligung der Patienten erhöht. Auch die Leistungen wegen Arbeitslosigkeit wurden zurückgefahren. In Deutschland wurde die Arbeitslosenunterstützung gesenkt, in Dänemark wurde beispielsweise die Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld verkürzt und die Bedingungen für die Aufnahme einer Arbeit strikter gesetzt. Andererseits strebte man in Dänemark eine Entlastung des Arbeitsmarktes an, indem beispielsweise Erziehungs- und Fortbildungsurlaube eingeführt wurden.
Konsolidierungsbemühungen im Hinblick auf den Staatsverbrauch waren von größerer Wirkung. Gründe hierfür waren u.a. die Entwicklung der Löhne und Gehälter sowie der Beschäftigung im öffentlichen Dienst, außerdem die sinkenden Verteidigungsausgaben aufgrund der weltweiten Entspannung mit der Öffnung Osteuropas. Der 1995 erreichte relativ niedrige Anteil des Staatsverbrauches (12,2 % des BIP) in der Bundesrepublik Deutschland wurde vor allem durch unterdurchschnittliche Lohnsteigerungen erreicht. In Dänemark, Frankreich und Großbritannien blieb statt dessen der Anteil des Staatsverbrauches weitgehend unverändert, obwohl auch in diesen Ländern die staatlichen Tariflöhne unterdurchschnittlich angehoben wurden. Grund für die Stagnation des Staatsverbrauchanteils war in Großbritannien ein eminenter Anstieg der übrigen Ausgaben, hauptsächlich im staatlichen Gesundheitswesen, vor allem in England. Der massive Abbau der Beschäftigung im öffentlichen Dienst konnte keine wesentliche Verringerung des Staatsverbrauchanteils bewirken. In Dänemark und Frankreich hat der Staat durch eine Ausweitung der öffentlichen Beschäftigung zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes beigetragen.
In Dänemark hat die Zinslast ein beachtliches Gewicht an den staatlichen Ausgaben erreicht, die Zinsausgaben beliefen sich 1995 auf 7,3 % des BIP. Deutschland, Frankreich (je 3,8 %) und Großbritannien (3,7 %) waren im europäischen Vergleich am niedrigsten. Der durch die Zinslast gebundene Teil der Steuereinnahmen belief sich 1995 in Dänemark auf nur 14,5 %, da der Steueranteil mit 50,2 % des BIP relativ hoch war. In Deutschland und Frankreich waren die Zins-Steuer-Quoten trotz niedrigen Zinsausgabenanteils am BIP etwas höher. Sie beliefen sich in Deutschland auf 15,8 % und in Frankreich auf 16,0 %. In Großbritannien betrug die Zins-Steuer-Quote im gleichen Jahr nur 13,3 %. Aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche 1992/93 nahm die Zinsausgabenquote in Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu. In Deutschland wurde diese Entwicklung noch verstärkt durch die einigungsbedingten Lasten. In Dänemark dagegen, wo die Konsolidierung der Staatshaushalte schneller vorankam, verringerte sich die Quote.
Im Jahre 1995 war in allen vier betrachteten Ländern die Ersparnisquote ohne Zinsausgaben positiv, die Ersparnisquote mit Zinsausgaben negativ. Dies zeigt das starke Gewicht der Zinsausgaben bzgl. der Verschuldung.
Viele Staaten haben bereits vor geraumer Zeit begonnen, im öffentlichen Sektor Aktivposten zu veräußern und den Erlös zur Entschuldung zu verwenden, um kurzfristig die Zinslast zu verringern. Hemmender Faktor ist dabei z.B. die zeitaufwendige technische Abwicklung der Privatisierung. Der Blick auf den Nettoschuldenstand (= Staatsschuld abzgl. Forderungen und Vermögenswerte) zeigt darüber hinaus, daß der Spielraum für eine derartige Entschuldung vielfach begrenzt ist (vgl. Tab.3). Da in den meisten EU-Ländern öffentliche Investitionen den Sparzwängen zum Opfer fielen, wiesen 1995 die staatlichen Investitionsquoten in den hier betrachteten Ländern niedrigere Werte auf als in den achtziger Jahren. Zwar lassen sich hier Einsparungen einfach umsetzen, weil weniger vertragliche Leistungsverpflichtungen bestehen, dennoch ist eine solche Entwicklung bedenklich. Mit der längerfristigen Vernachlässigung von Investitionen wird Wachstumspotential aufs Spiel gesetzt, dessen Ausnutzung erforderlich ist, um die wirtschaftliche Schwäche überwinden zu können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab 2 : Staatsausgaben (1) in den EU-Ländern 1980 bis 1995 in vH des Bruttoinlandsproduktes
(1) Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen.
Quellen: OECD, Economic Outlook; Berechnungen des DIW.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab 3 : Verschuldungssituation des Staates (1) in den EU-Ländern 1980 bis 1995 in vH des Bruttoinlandsproduktes
(1) Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen.
Quellen: OECD, Economic Outlook; Berechnungen des DIW.
4.3 Die Einnahmen
Die Absicht, die gesamtwirtschaftliche Steuer- und Abgabenlast nicht mehr steigen zu lassen, verstärkte in vielen EU-Ländern den Zwang zur Ausgabendisziplin. In vielen Ländern bestand vor allem das Anliegen, die Sozialbeiträge und die Steuerlast auf Unternehmensgewinne zu verringern. Deshalb begann man in Großbritannien, Frankreich und Deutschland (hier zunächst für gewerbliche Einkommen) bereits Anfang der neunziger Jahre, die Tarife bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftssteuer zu senken. Allerdings wurden in Deutschland und Dänemark die Tarifentlastungen über die Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen teilweise neutralisiert.
Darüber hinaus wurden in Frankreich und Großbritannien die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung herabgesetzt. In Großbritannien sollte dadurch die Einstellung von Arbeitnehmern mit Niedriglöhnen gefördert werden.
Die prekäre Lage der öffentlichen Haushalte führte trotz Ankündigungen von Steuersenkungen kaum zu einer Verringerung der Steuer- und Abgabenquote, sondern vielmehr zu einer Steuerbelastungsumschichtung. In Dänemark beispielsweise wurde die Einkommensteuer erhöht. Durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze in Deutschland, Frankreich und Großbritannien kam es zu einer Umschichtung der Steuerlast hin zu den indirekten Steuern. Weitere Beispiele für diese Umschichtung sind die Anhebung der Mineralölsteuer (Deutschland, Frankreich, Dänemark) sowie die Anhebung der Alkohol- und Tabaksteuer (Frankreich). In Dänemark wurden außerdem die Steuern auf den Energieverbrauch erhöht. 1995 betrug die Abgabenlast (Sozialbeiträge und Steuern) in Dänemark 53,1 % vom BIP, in Großbritannien nur 34,1 %, in Deutschland 43,4 % und in Frankreich 44,8 %.
Weitere Erhöhungen der Steuern und Sozialbeiträge zur Steigerung der Einnahmen sind aus Sicht der meisten EU-Länder nicht mehr lange fortzusetzen. Die Belastung mit direkten Steuern ist unter Berücksichtigung niedriger Tarife in Konkurrenzländern wie z.B. die USA problematisch. Weniger problematisch wäre eine noch stärkere Belastung des privaten Konsums etwa in Form einer Mehrwertsteuererhöhung, durchgeführt wurde diese in Deutschland am 01.04.1998. Diese Maßnahme ist aber unter Berücksichtigung der damit einhergehenden inflationsbeschleunigenden Wirkungen mit Vorsicht zu beachten. Außerdem besteht bei einer Erhöhung der Sozialabgaben die Gefahr der Lohnkostensteigerung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab 4 : Staatseinnahmen (1) in den EU-Ländern 1980 bis 1995 in vH des Bruttoinlandsproduktes
(1) Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen.
Quellen: OECD, Economic Outlook; Berechnungen des DIW.
4.4 Fazit
Eine strikte Ausgabendisziplin ist auf mittlere Sicht wichtige Voraussetzung für die Erreichung einer Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in den EU-Ländern. Dabei kommt es nicht nur auf die geeignete Dosierung von finanzpolitischen Maßnahmen an, sondern auch auf den richtigen Zeitpunkt der Durchführung dieser. Die Bemühungen der meisten EU-Länder hatten allerdings bis Mitte der neunziger Jahre nur begrenzten Erfolg, die Finanzpolitik verstärkte ihren restriktiven Kurs.
Eine Finanzpolitik, die ihren Konsolidierungskurs verfolgt, ohne ausreichend wachstumspolitische Ziele zu beachten und dabei auf die zinssenkenden Effekte einer geringeren staatlichen Kreditaufnahme setzt, ist mit der Gefahr destabilisierender Wirkungen verbunden.
Außerdem bedarf es einer besseren Abstimmung der Finanz- und Geldpolitik, indem die Geldpolitik die Konsolidierungsbemühungen des Staates unterstützt und Realzinssenkungen herbeiführt, die die Zinslasten der öffentlichen Haushalte senken und die private Investitionstätigkeit stimulieren. (vgl. DIW, Wochenbericht 40/96)
5 Ausblick: Finanzpolitische Fragestellungen im Hinblick auf die EWWU
Als erstes stellt sich die Frage, welche der finanzpolitischen Maßnahmen auf europäischer Ebene koordiniert werden und welche besser in nationaler Autonomie verbleiben sollten. Es ist nicht einfach, immer mehr Aufgaben an europäische Institutionen zu übertragen, ohne dabei die Prinzipien der bürgernahen, unbürokratischen und flexiblen Aufgabenerfüllung zu verletzen. Ein Kompetenzwildwuchs sollte nicht nur durch die in europäischen Verträgen verankerte Vorsorge gegen Zentralisierungstendenzen (insbesondere das Subsidiaritätsprinzip) verhindert werden, sondern auch durch weitere Hürden. Als grundlegende Vorsorge gilt trotzdem das Subsidiaritätsprinzip, welches besagt, daß die Europäische Union in Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig werden darf, ,,sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden" (Art. 3b, EG-Vertrag).
Zweitens muß ein stabilitätsgerechter, makroökonomischer policy mix in der Euro-Zone bestimmt werden, d.h. eine gleichzeitige Anwendung verschiedener wirtschaftspolitischer Instrumente auf europäischer Ebene. Die Eckpfeiler des künftigen europäischen policy mix sind die neue europäische Geldverfassung und der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt. Das oberste Ziel der Europäischen Zentralbank ist das der Preisstabilität, die Hauptaufgabe der makroökonomisch orientierten Finanzpolitik liegt in der Verstetigung, d.h. ein gleichmäßiges und beständiges Wirtschaftswachstum wird angestrebt. Konjunkturelle Schwankungen sollen demnach durch einen möglichst ausgeglichenen Haushalt begrenzt werden.
Drittens ist es notwendig, eine langfristige Vereinbarung über den Finanzrahmen und die Verteilung der Finanzlasten in der EU zu treffen. Die Haushaltspolitik auf EU-Ebene muß sich jeweils der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten anpassen. Europäische Finanzdisziplin kann nur bei fairer Verteilung der Vorteile und Lasten auf Dauer gesichert werden. Ein gemeinsames Interesse an sparsamste Mittelverwendung gilt es zu verfolgen.
(vgl. Bundesministerium der Finanzen, 1998)
II Quellenverzeichnis
Ahrns, Hans-Jürgen: Wirtschaftspolitik, 5. Auflage, Oldenbourg Verlag 1994, 65.023/6* Altmann, Jörn: Wirtschaftspolitik, 6. Auflage, UTB für Wissenschaft 1995, 65.023/253* Bohnet, Armin: Vorlesung Finanzwissenschaft, Universität Gießen, 1997 Bundesministerium der Finanzen: Finanzpolitische Anstrengungen tragen Früchte, 1998
Dickertmann, Dietrich: Grundlagen und Grundbegriffe der Volks- und Finanzwirtschaft, Weyers Verlag 1986, 65.023/118*
DIW Berlin, Wochenbericht 40/96
Feess: Umweltökonomie und Umweltpolitik, Vahlen Verlag 1995, 65.023/239*
Feess / Tibitanzl: Wirtschaftspolitik, Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften Band 12, Vahlen Verlag 1996, 65.023/249*
Gabler: Wirtschaftslexikon, Stichwort: Finanzpolitik
Gemper, Bodo B.: Wirtschaftspolitik, Ordnungspolitische Grundlagen, Physica-Verlag 1994, 65.023/177*
Hedtkamp, Günter: Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 2. Auflage, Hermann Luchtenhand Verlag 1977, 65.075/78*
Molitor, Bruno: Wirtschaftspolitik, 4. Auflage, Oldenbourg Verlag 1992, 65.023/219*
Musgrave: Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, 2. Auflage, UTB 1978, 65.023/178*
Peters, Hans Rudolf: Wirtschaftspolitik, 2. Auflage, Oldenbourg Verlag 1995, 65.023/254*
Petersen, Hans-Georg: Finanzwissenschaft I, 3. Auflage, Kohlhammer Verlag 1993, 65.023/241*
Rittershofer, Werner: Das Lexikon für Wirtschaft, Arbeit, Umwelt und Europa, 7. Auflage, Bund-Verlag 1994, 65.032/21*
Wagner, Helmut: Europäische Wirtschaftspolitik: Perspektiven einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), Springer Verlag 1995
Wittmann, Walter: Einführung in die Finanzwissenschaft, Teil 4: Finanzpolitik, 2. Auflage, Gustav Fischer Verlag 1977, 65.023/181*
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Hausarbeit über öffentliche Finanzpolitik?
Diese Hausarbeit gibt einen grundlegenden Überblick über die öffentliche Finanzpolitik. Sie behandelt finanzpolitische Ziele und Instrumente sowie die öffentlichen Haushalte ausgewählter europäischer Länder im Vergleich zur BRD.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist wie folgt gegliedert: Einleitung (Begriff/Abgrenzung, Ziele der Finanzpolitik, finanzpolitische Instrumente, öffentliche Haushalte in ausgewählten EU-Ländern, Ausblick), Literaturverzeichnis. Die Arbeit definiert den Begriff Finanzpolitik, erläutert ihre Ziele (Allokation, Distribution, Stabilisierung, Nachhaltigkeit), beschreibt finanzpolitische Instrumente und analysiert die öffentlichen Haushalte Dänemarks, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens von 1980 bis 1995. Abschließend wird ein Ausblick auf finanzpolitische Fragestellungen im Hinblick auf die EWWU gegeben.
Welche finanzpolitischen Ziele werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt vier finanzpolitische Ziele: Allokationsziel (optimale Verbindung der Produktionsfaktoren), Distributionsziel (Korrektur der Einkommensverteilung), Stabilisierungsziel (hoher Beschäftigungsstand, Preisniveaustabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum) und Nachhaltigkeitsziel (Berücksichtigung der Interessen zukünftiger Generationen und Schutz der Umwelt).
Welche finanzpolitischen Instrumente werden erläutert?
Die Hausarbeit erläutert die Struktur der öffentlichen Ausgaben (Ausgaben für Güter und Dienste, Transferzahlungen) und Einnahmen (direkte und indirekte Steuern, Beiträge, Kredite) in Anlehnung an die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR).
Welche Länder werden im Hinblick auf ihre öffentlichen Haushalte verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht die Entwicklung der öffentlichen Haushalte in Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien von 1980 bis 1995 anhand empirischer Daten.
Welche finanzpolitischen Fragestellungen werden im Hinblick auf die EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) betrachtet?
Die Hausarbeit gibt einen Ausblick auf finanzpolitische Maßnahmen und Vorbereitungen, die getroffen werden müssen, um eine erfolgreiche europagerechte Finanzpolitik in Hinblick auf die EWWU zu ermöglichen. Dazu gehören die Koordination finanzpolitischer Maßnahmen auf europäischer Ebene, die Bestimmung eines stabilitätsgerechten makroökonomischen Policy Mix in der Euro-Zone und eine langfristige Vereinbarung über den Finanzrahmen und die Verteilung der Finanzlasten in der EU.
Was wird unter dem Begriff "Finanzpolitik" verstanden und wie grenzt er sich von "Fiskalpolitik" ab?
Finanzpolitik ist die Gesamtheit staatlicher Maßnahmen zur Gestaltung der öffentlichen Finanzwirtschaft, ausgerichtet an politischen Zielsetzungen und der geltenden Finanzverfassung. Sie beeinflusst Struktur und Höhe des Sozialprodukts durch öffentliche Einnahmen und Ausgaben. Fiskalpolitik wird oft als Teil der Finanzpolitik betrachtet, wobei sich die Fiskalpolitik auf den Ausgleich des Staatshaushalts konzentriert, während die Finanzpolitik weitere wirtschaftliche Ziele verfolgt.
Welche Rolle spielen die Sozialleistungen in den öffentlichen Haushalten der untersuchten EU-Länder?
Sozialleistungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Staatsausgaben in den untersuchten EU-Ländern (Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien). Der Anteil der Sozialleistungen am BIP variiert jedoch stark zwischen den Ländern. In den letzten Jahren wurden Reformen im Sozialbereich durchgeführt, um die Ausgabenentwicklung zu begrenzen, z.B. durch Anhebung des Rentenalters, Einschränkung der Leistungen im Gesundheitswesen und Kürzung der Arbeitslosenunterstützung.
Wie hat sich die Verschuldungssituation in den untersuchten EU-Ländern entwickelt?
Viele Staaten haben versucht, im öffentlichen Sektor Aktivposten zu veräußern, um die Zinslast zu verringern. Allerdings ist der Spielraum für eine derartige Entschuldung oft begrenzt. Die staatlichen Investitionsquoten waren in den betrachteten Ländern im Jahr 1995 niedriger als in den achtziger Jahren, was langfristig das Wachstumspotenzial gefährden könnte.
Wie haben sich die Staatseinnahmen in den untersuchten EU-Ländern entwickelt?
Um die Sozialbeiträge und die Steuerlast auf Unternehmensgewinne zu verringern, wurden in einigen Ländern die Tarife bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftssteuer gesenkt. Gleichzeitig kam es jedoch zu einer Umschichtung der Steuerlast hin zu indirekten Steuern, z.B. durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze und der Mineralölsteuer.
- Arbeit zitieren
- Stefan Wenge (Autor:in), 1999, Finanzpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95421