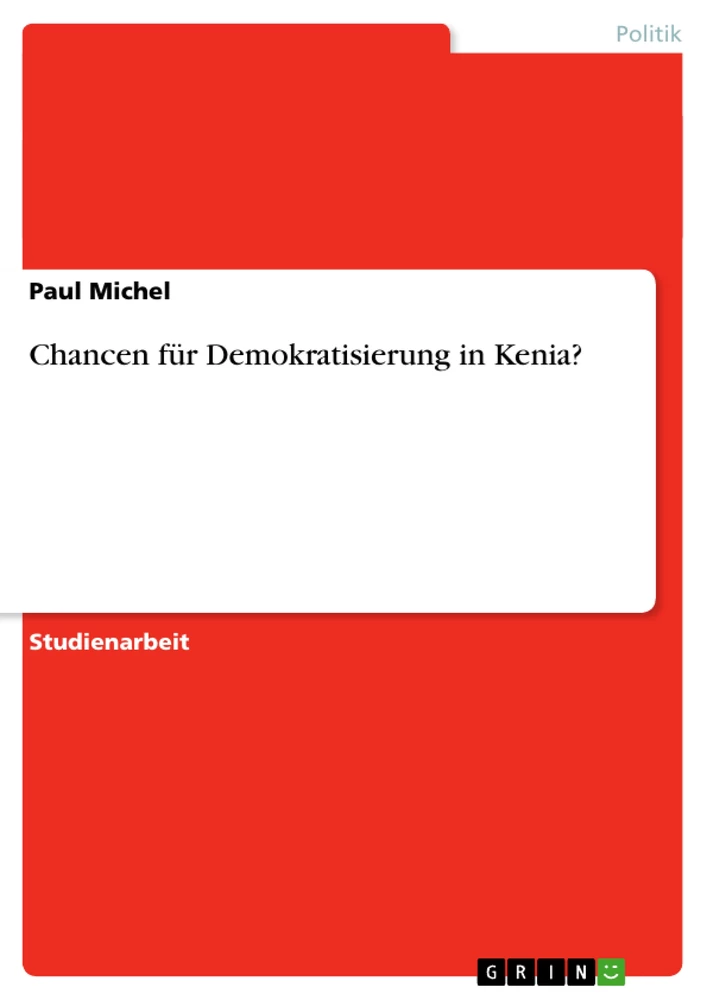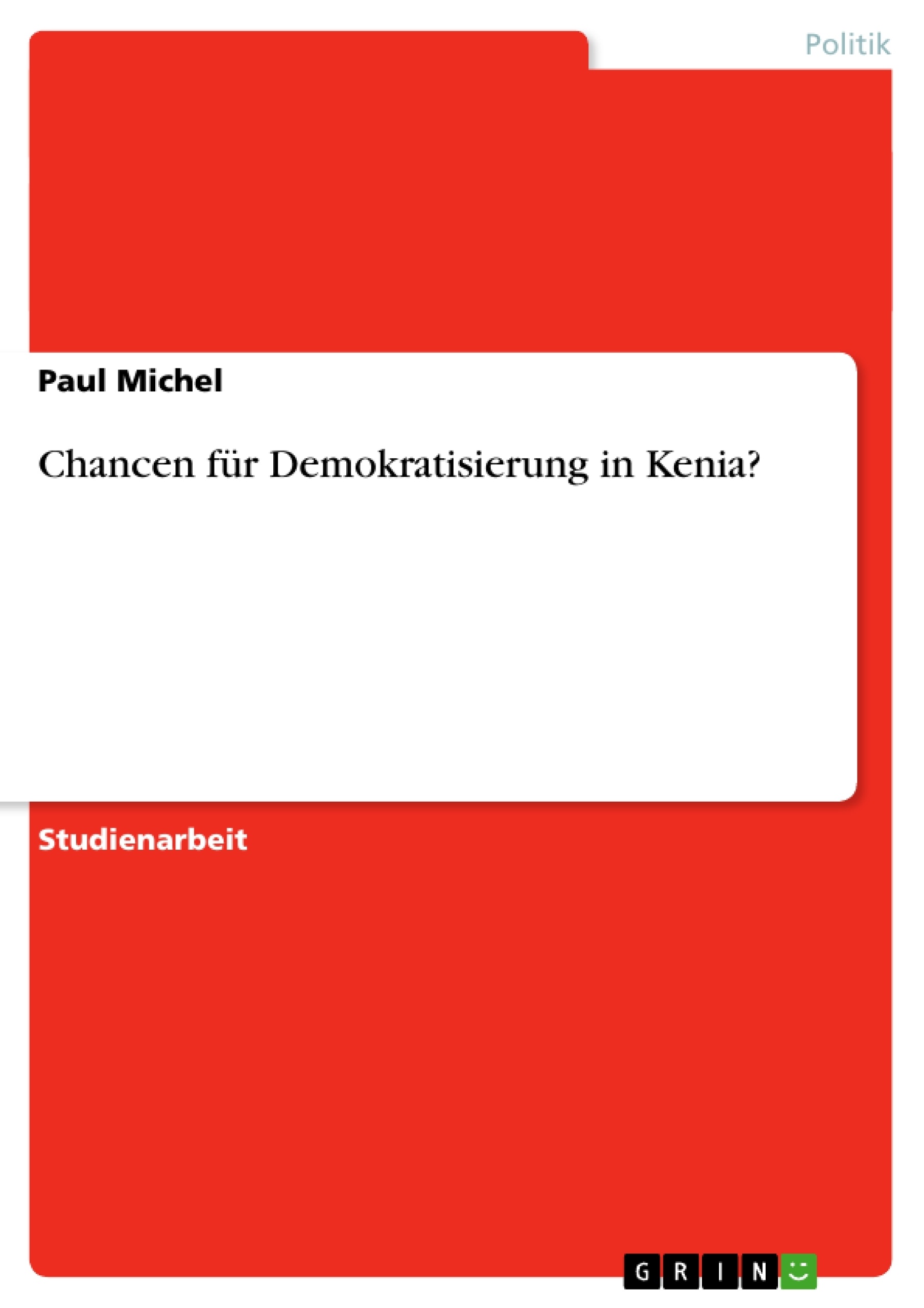Inhalt:
A) Einleitung
B)
I. Skizze der politischen Entwicklung seit der Unabhängigkeit
II. Skizze der wirtschaftlichen Entwicklung
III. Demokratisierung in Kenia?
1) Phase 1: 1963 bis 1978
2) Phase 2: 1979 bis 1991
3) Phase 3: 1991 bis zur Gegenwart
C) Fazit
D) Literaturverzeichnis
A) Einleitung
"Wind of change" - dieser Ausdruck symbolisiert für viele die politische Transformation von den autoritären Systemen des ehemaligen Ostblocks in Demokratien.
Weitgehend unbekannt ist heute, daßdieses politische Symbol schon 1960 vom britischen Premierminister Macmillan benutzt wurde, um die nahende Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien in Afrika zu kommentieren.1 Fast alle Staaten in Afrika nahmen zu diesem Zeitpunkt "demokratische" Verfassungsmodelle an, die am Vorbild ihrer ehemaligen Kolonialmächte ausgerichtet waren. In nur wenigen Fällen blieb der verfassungsmäßige Rahmen in der Folgezeit zumindest in seinen Grundzügen gewahrt. In Afrika ist Kenia ein Beispiel für ein solches Land: Hier wurde das politsche System Großbrittanniens übernommen und in der neuen kenianischen Verfassung niedergeschrieben. Aber eine demokratische Verfassung erzeugt nicht automatisch eine Demokratie.
In dieser Arbeit soll analysiert werden, ob Kenia als "demokratisch" klassifiziert werden kann. Nach einleitenden Skizzen der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungslinien soll die postkoloniale Geschichte Kenias in 3 Phasen daraufhin untersucht werden, inwieweit man in jeder Phase vom Land als "Demokratie" sprechen kann. Grundlagen meiner Analyse werden dabei die Kriterien des Politikwissenschaftlers Robert A. Dahl sein.2
Dabei werde ich aufzeigen, daßKenia keinesfalls die kontinuierlichen Demokratisierung erfahren hat, die sich westliche Idealisten vielleicht erhofft hatten.
Als Grundlage meiner Arbeit dienen neuere Schriften der Keniaexperten Stefan Mair, David Throup und Bethwell A. Ogot.
B)
I. Skizze der politischen Entwicklung seit der Unabhängigkeit
Kenia wurde am 12. Dezember 1963 unabhängig. Der damalige Präsident Jomo Kenyatta kann als patriarchaler Herrscher bezeichnet werden, der sein administrativhegemoniales Regime auf die Unterstützung von starken ethnisch-regionalen Gruppen aufbaute. Seine Partei, die Kenya African National Union (KANU), setzte sich unter Kenyatta vor allem aus Führungspersönlichkeiten von den stärkeren ethnisch-regionalen Gruppen der Kikuyu und Luo zusammen.
Durch competitive bargaining 3, bei dem Ressourcen an die verschiedenen ethnisch- regionalen Gruppen verteilt wurden, moderaten Einsatz von Zwangsmitteln und eine starke Bürokratie gelang es Kenyatta, ein stabiles politisches System zu installieren. Kenya konnte zu seiner Amtszeit als typischer neo-patrimonialer Staat4 bezeichnet werden, in dem Klientelbeziehungen eine äußerst wichtige Rolle spielten.5
Nach Kenyattas Tod im August 1978 wurde Daniel arap Moi Präsident. Er kommt aus einer kleinen ethnisch-regionalen Gruppe, der Tugen-Untergruppe der Kalenjin. Moi schien zunächst den Herrschaftsstil seines Vorgängers fortzuführen, stellte sich aber in den 80er Jahren als eine autoritärere und weniger flexible Führungsperson heraus. Er behielt das System des competitive bargaining nicht bei, sondern lenkte Mittel, die bisher in besonderem Maße den Kikuyu zugute gekommen waren, um. Er spielte die "ethnische Karte", indem er die Kalenjin der Rift Valley und seine Verbündeten unter den Abaluhya der Western Province und Gruppen der Coast Province bevorzugte.6
Trotz der faktischen (und 1982 legal verankerten) Einparteienherrschaft hatte Kenia unter Kenyatta den Ruf, eines der offensten politischen Systeme in Afrika zu sein. Die Berichterstattung der Presse war verhältnismäßig wenig eingeschränkt; Kirchen, Gewerkschaften und Sozialverbände genossen eine relativ große Bewegungsfreiheit. Im Verlauf der Präsidentschaft Mois wurde die Unabhängigkeit der Judikative eingeschränkt, Wahlen verstärkt manipuliert und die Bürgerrechte faktisch verringert. Im November 1991 sah sich Moi gezwungen, dem Druck der Weltbank und den Geberländern nachzugeben. Er erlaubte die Bildung von Oppositionsparteien und versprach freie Wahlen. Die ersten fanden am 29. Dezember 1992 statt. KANU blieb Regierungspartei und wurde auch bei den zweiten freien Wahlen im Dezember 1997 bestätigt. Daniel arap Moi wurde in seinem Amt als Präsident bis 2002 wiedergewählt.
II. Skizze der wirtschaftlichen Entwicklung
Kenia war lange Zeit das afrikanische Paradebeispiel für ein Land mit kapitalistischem Entwicklungsweg. Die Politik Kenyattas konzentrierte sich dabei eher auf Wirtschaftswachstum als auf Verteilungsgerechtigkeit. Kenyatta sah die dringende Notwendigkeit, Wirtschaftshilfe von westlichen Ländern zu erhalten.7 Diese Strategie ging auf: Das Land erlebte Ende der 70er Jahre eine wirtschaftliche Blüte, die vor allem auf einer effizienten Verwaltung, marktorientierter kleinbäuerlicher Landwirtschaft und Auslandsinvestitionen beruhte. Entwicklungshilfe und Selbsthilfeprojekte verbesserten überdies die physische und soziale Infrastruktur Kenias.8
In den 80er Jahren litt die exportorientierte Landwirtschaft am Verfall der Rohstoffpreise und an zwei Dürreperioden. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes stagnierte mit dem Anstieg der Energiepreise und der weltwirtschaftlichen Rezession.
Seit 1978 ging die Wachstumsrate, bedingt durch höhere Ausgaben für Importe und sinkende Exportgewinne, mehr und mehr zurück.9
Innenpolitische Probleme wie der rapide Bevölkerungswachstum, Landmangel, wachsende Inflation, Arbeitslosigkeit sowie die Stagnation im industriellen Sektor trugen zur Krise von Kenias Wirtschaft in den 80er Jahren bei.
Zu diesen Faktoren kam die offene Begünstigung ethnisch-regionaler Klientel durch die Regierung Moi und eine wachsende Korruption.
Die Geberländer beschlossen bei einem Treffen im November 1991 unter Vorsitz der Weltbank in Paris die Aussetzung der schnellabfließenden Mittel an Kenia. Sie klagten die Deregulierung der Wirtschaft und den Abbau des Haushaltsdefizits ein. Im Zuge der neuen Weltbankpolitik der good governance forderten sie außerdem Demokratisierung, politische Liberalisierung und ein Vorgehen gegen die Korruption im Lande.
Dieser von vielen politischen Beobachtern als hart bewertete Schritt lag nicht nur in der Enttäuschung der Geberländer hinsichtlich der Tendenz der wirtschaftlichen Entwicklung begründet. Kenias strategisch-militärische Bedeutung für den Westen hatte nach Ende des Ost-West Konfliktes stark abgenommen. Außerdem darf die internationale Lobbyarbeit der kenianischen Opposition gegen die Regierung Moi nicht unterschätzt werden.10
Mair und Throup betonen, daßdie von Moi unwillig veranlaßte Abkehr vom Einparteienregime vor allem durch den äußeren Druck der internationalen Gebergemeinschaft erzwungen wurde.11
III. Demokratisierung in Kenia?
Der politische Wandel in Kenia kann in 3 Phasen eingeteilt werden:
Phase 1: Die Politik unter Kenyatta von 1963 bis 1978.
Phase 2: Die Politik unter Moi von 1979 bis 1991.
Phase 3: Die Politik seit den Mehrparteienwahlen Ende 1991 bis zur Gegenwart.
Ob die politischen Verhältnisse in Kenia in den 3 Phasen als demokratisch bezeichnet werden können bzw. sich Demokratisierungsprozesse angedeutet haben, werde ich anhand der Kriterien von Robert A. Dahl untersuchen.12 Nach Dahl gibt es sieben Institutionen, die idealtypisch eine Demokratie13 konstituieren: Gewählte Vertreter der Bevölkerung konkurrieren in freien und fairen Wahlen. Dabei mußdie Möglichkeit des aktiven und passiven Wahlrechts für alle Erwachsenen gegeben sein. Weiterhin sollen Versammlungs- und Organisationsfreiheit sowie die Rede- und Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt sein. Es mußsichergestellt werden, daßInformationsvielfalt vorhanden ist, so daßes die Möglichkeit zu "alternativer" Informationsbeschaffung gibt.
Ich möchte diese 7 Institutionen in Anlehnung an Mair in 3 zentrale Elemente bündeln:
1. Element: Wettbewerb zwischen Einzelpersonen oder Gruppen bei freien, gleichen und unmanipulierten Wahlen in regelmäßigen Intervallen
2. Element: ein hohes Niveau an Partizipation bei politischen Entscheidungen und Wahlen
3. Element: ein Grad von bürgerlichen und politischen Freiheiten, Meinungs-, Presse- und Organisationsfreiheit, der die Integrität des politischen Wettbewerbs sichert.
Im folgenden werden die 3 Phasen anhand der 3 zentralen Elemente der Demokratiedefinition von Dahl untersucht.
1) Phase 1: 1963 bis 1978
Schon im Februar 1957 waren unter der britischen Kolonialregierung afrikanische Parlamentarier ins Parlament gewählt worden. Landesweit agierende Parteien gründeten sich ab 1960. Kleinere ethnisch-regionale Gruppen formten sich dabei zur KADU (Kenyan African Democratic Union), weil sie eine Vormacht der zwei größten Gruppen, der Kikuyu und Luo, in der KANU fürchteten. Kenyatta, dem founding father des kenyanischen Nationalismus, gelang es noch vor der Unabhängigkeit, eine große Koalition der beiden Parteien ins Leben zu rufen. Bei den Wahlen im Mai 1963 wurde KADU deutlich besiegt. Viele Oppositionspolitiker liefen danach zur Regierungspartei über; KADU löste sich schließlich im Dezember 1964 auf. In den nächsten 28 Jahren wurden in Kenia keine Mehrparteienwahlen mehr abgehalten; Kenia wurde de facto zum Einparteienstaat.14
Eine neue Oppositionspartei, die Kenya People's Union (KPU), welche 1966 von Oginga Odinga, dem früheren Vizepräsidenten, aus KANU -Dissidenten gebildet wurde, konnte durch eine Verfassungsänderung in ihrer Präsenz im Parlament verkleinert werden. Parteimitglieder wurden systematisch schikaniert, die Partei wurde nach Ausschreitungen von Luo-Jugendlichen 1969 verboten.
Obwohl sich die autoritären Züge des Kenyatta-Regimes in der Behandlung der KPU deutlich gezeigt haben, kann der Einparteienstaat unter Kenyatta als relativ offen bezeichent werden. Regimekritische Meinungen konnten sich innerhalb der KANU artikulieren. Alle wahlberechtigten Kenianer15 konnten ab 1969 an der primary der KANU teilnehmen und sich zur Wahl stellen. Mit den Parlamentswahlen 1969 zogen kritische backbencher s in die Nationalversammlung ein, die in den folgenden zwei Legislaturperioden als starke innerparteiliche Opposition - wenn auch innerhalb bestimmter Grenzen - fungierten. Auf dem Höhepunkt ihres Einflusses gelang es 1975 der backbench -Opposition, einen Untersuchungsausschußeinzusetzen, der im Abschlußbericht feststellte, daßKANU-Prominente höchsten Ranges an der Ermordung eines radikalen backbenchers beteiligt gewesen seien.16
In den folgenden 2 Jahren brach die Regierung die Koalition der backbenchers, indem sie einige Parlamentarier in die eigenen Reihen zog, zum Schweigen brachte oder sie einsperren ließ.17
Ein anderer Aspekt, der die relative Offenheit des politischen Systems in der ersten Phase kennzeichnet, war die Tatsache, wie viele der einflußreichen Kabinettmitglieder bei den Wahlen 1969 und 1974 nicht wiedergewählt wurden.18
Obwohl die Wahlbeteiligung von 71,6% im Jahre 1963 und auf 46,7% bei den Wahlen 1969 sank, mußdie Möglichkeit der Partizipation betont werden.
"General elections every five years provided the population with a sense of participation and the right to choose members of parliament and endowed the regime with a considerable degree of political legitimacy and popular support."19
Untersucht man die Bürger- und Menschenrechtssituation in Kenia in der ersten Phase, ist die Bilanz im Verhältnis zu anderen afrikanischen Staaten gut. KANU war zwar die einzig legale politische Organisation, wurde aber von einer erstarkenden Zivilgesellschaft beobachtet und kritisiert. Herausragende Organisiationen wie die Law Society of Kenya, die Kenya's Farmers Association, die Kenya Coffee Planters' Co-operative sowie der National Christian Council of Kenya und einige prominente Kirchenväter übten offen Kritik an der Regierung. Auch die Presse konnte relativ ungehindert über politische Geschehnisse berichten.
Man kann in Anlehnung an Dahl das kenianische System in der ersten Phase als relativ demokratisch charakterisieren. Hinsichtlich Verfassung, Partizipation, Bürgerrechten und Frequenz der Wahlen war die Bilanz Kenias im afrikanischen Kontext in dieser Zeit hervorragend. Einschränkend mußaber auf das Verbot von oppositionellen Parteien und die Verhaftungen (und Ermordungen) von kritischen Politikern hingewiesen werden.
Zudem gab es immer wieder vereinzelte Manipulationen von Wahlergebnissen. Das Prädikat "relativ demokratisch" erhält Kenia daher im Vergleich zu autokratischen afrikanischen Systemen der Zeit und im Vergleich zur politischen Situation Kenias ab 1979.
2) Phase 2: 1979 - 1991
Am 22. August 1978, dem Tag von Kenyattas Tod, wurde Daniel arap Moi verfassungsgemäßals Acting President vereidigt. Mois innerparteilichen Opponenten war es weder durch politisches Taktieren noch durch Attentatsversuche gelungen, seinen Amtsantritt zu verhindern und einen Kikuyu als Nachfolger Kenyattas einzusetzen.20 Moi wurde am 4. Oktober zum Präsidenten der KANU gewählt, und am 14. Oktober als zweiter Präsident Kenias vereidigt.
Dem Präsidenten gelang in der Folgezeit der Ausbau seiner Macht in einer Gesellschaft, in der die Kikuyu-Elite das politische, administrative und ökonomische Leben dominierte. Moi nutzte den Umstand, daßes innerhalb der Kikuyu-Gruppe verschiedene Fraktionen gab, die sich feindlich gegenüberstanden. Er verbündete sich mit der Kikuyu-Fraktion um Charles Njonjo und Mwai Kibaki, der 1978 Vizepräsident wurde.
Ab 1979 wurden die Wahlen in Kenia immer teurer21 und gewaltsamer.
Wahlmanipulationen nahmen drastisch zu. Troup schreibt, daßbesonders in der Rift Valley Wahlen manipuliert wurden, bei denen im normalen Verfahren Opponenten Mois in seiner ethnisch-regionalen Gruppe, den Kalenjin, zu Sitzen im Regionalparlament gekommen wären.22 Aus allen Regionen gab es während der 2. Phase meiner Untersuchung Berichte von Wahlmanipulationen: Wähler und Wahlhelfer wurden von besonders ambitionierten Kandidaten mit hohen Summen bestochen; regionale und örtliche Verwaltungen verhielten sich parteiisch und behinderten unliebsame Bewerber für Parlamentssitze.23
1988 erreichten die Wahlmanipulationen ihren historischen Höhepunkt. Schon 1986 war das sogenannte queuing für die KANU-primaries im Parteiprogramm festgelegt worden. Nach diesem Modus mußten sich die Unterstützer eines Kandidaten hinter einem Bild desselben in einer Reihe aufstellen. Durch die Länge der Reihen sollte über die Nomination entschieden werden. Dieses System wurde durch Gruppen der Zivilgesellschaft, allen voran der Law Society of Kenia, heftig kritisiert. Wie sollte Verwaltungs- und Militärpersonal seine politische Meinung kundtun dürfen, wenn es durch das queuing mit einem bestimmten Aspiranten identifiziert werden würde? Außerdem kritisierte die Law Society die sogenannte 70 Prozent-Regelung, nach der diejenigen, die bei der Nomination durch queuing 70% der Wähler oder mehr hinter sich sammeln konnten, als "gewählt ohne Gegenkandidaten" ausgerufen wurden.24
KANU bezeichnete die Kritiker des queuing als vom Ausland bezahlte Subversive, die nicht die Vorherrschaft der Partei anerkennen wollten.25 Diese Äußerungen waren symptomatisch für den neuen autoritären Stil der Regierung, der als paranoid style in der Politik Kenias jener Phase bezeichnet werden kann.
An der Einparteienherrschaft gab es nichts zu rütteln. Der Registrar of Societies 26 behinderte alle Versuche, neue Parteien anzumelden. Als Oginga Odinga 1982 versuchte, mit anderen die Kenya Socialist Party registrieren zu lassen, wurde die Verfassung geändert und Kenia de jure zu einem Einparteienstaat.27
Durch Umstrukturierungen konnte Moi die Rolle der Partei im Staat stärken. Ethnische Organisationen, die formal gemeinnützig und unpolitisch, tatsächlich aber potentielle Rivalen der KANU waren, wurden schon 1980 auf einer Konferenz der KANU -Spitze, der dritten Leaders Conference, verboten.28 Am fehlenden Widerspruch in der KANU zeigte sich, wie straff Moi die Partei schon zu diesem Zeitpunkt führen konnte. Moi selbst beschrieb die Funktion der Partei im Dezember 1982 in einer Rede an die Bevölkerung Kenias:
"KANU is required - through all its elected leaders and appointed officials - to educate the people about the policies and challenges to safeguard constitutional rights and and uphold the rule of law, to establish standards of conduct and impose any necessary discipline in the cause of national integrity."29
Die Rede enthielt neben diesen pädagogischen Absichtserklärungen die Umrisse eines Konzeptes für eine revitalisierte, starke Partei. Kritiker sahen in ihr eher amateurhafte Rationalisierungsversuche von Mois politischem Monolitismus.
Wie man sieht, war die Bilanz der Regierung Moi in Bezug auf die ersten zwei Elemente meines Analyserasters sehr schlecht. Im Einparteienstaat wurden Wahlen zwar weiterhin regelmäßig, aber nicht fair abgehalten; durch das queuing, die 70-Prozent-Regelung und die zentrale Parteisteuerung wurden die realen Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung in starkem Maße beschnitten.
Wie sah es nun mit den bürgerlichen und politischen Freiheiten aus? Konnten Zivilgesellschaft und Medien sich für die Integrität des politischen Wettbewerbs einsetzen?
Zunächst schien es, als würde Moi in diesem Bereich eine liberalere Gangart als sein Vorgänger einschlagen: Direkt nach seinem Amtsantritt entließMoi alle politischen Gefangenen in Kenia.30 Der Applaus, der ihm dafür insbesondere aus akademischen Kreisen zuteil wurde, verstummte jedoch schnell wieder. Im September des darauffolgenden Jahres ließdie Regierung die Universität von Nairobi wegen oppositioneller Umtriebe von Studierenden schließen und Wortführer verhaften. Auch 1980 gab es schwere Unruhen und Straßenschlachten im Umfeld der Universität, in deren Folge 12 Dozenten die Pässe entzogen wurden. Der Präsident erklärte, für Kon- spirateure und Demagogen sei in Kenia kein Platz. 1982 wurden mehrere Angestellte der Universität verhaftet und von der Regierung beschuldigt, "subversive" Inhalte zu unterrichten und politische Unruhe zu schüren. Eine Reihe von Dozierenden floh ins Exil oder verließdie Universität, um Hausarrest oder einem drohenden Gefängnisaufenthalt zu entgehen.31 Der im August 1982 mißglückte Versuch eines coup d'etat durch jüngere Mitglieder der Kenya Air Force gegen Moi wirkte sich nicht nur auf die Autonomie der Universitäten aus: Viele der Studierenden, die den Staatstreich auf den Straßen Nairobis gefeiert hatten, wurden wegen Aufruhr und Landesverrat zu zum Teil mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Universität wurde für 14 Monate geschlossen.
1988, zwei Jahre nach Einführung des queuing, wurde eine Verfassungsänderung beschlossen, die von Seiten der Zivilgesellschaft stark kritisiert wurde. Die Constitutional Amendment Bill sah vor, die Immunität von hohen Richtern aufzuheben. Außerdem sollte die Polizei Beschuldigte, die eines schweren Verbrechens bezichtigt wurden, für 14 Tage festnehmen können.32 Es gelang der Regierung Moi, die drei für eine Verfassungsänderung nötigen Lesungen an einem Tag, innerhalb von 3 Stunden abzuhalten und die Constitutional Bill zu verabschieden.
Obwohl die Organisationsfreiheit für regimekritische Gruppen in den 80er Jahren stark eingeschränkt wurde, konnten sich kleinere Gruppen informelle Freiräume schaffen. Diese Freiräume konnten z.B. in Bars, bei Fußballspielen, bei religiösen Treffen, auf Marktplätzen, Beerdigungen oder in den matatu taxis 33 existieren. Die zivilgesellschaftliche Opposition erstarkte. Am 7.7. 1990 wagten zwei oppositionelle Politiker, Charles Rubia und Kenneth Matiba, öffentlich zu verlangen, daßdie Regierung die Verfassungsänderung von 1982 zurücknähme34, das Parlament auflöse und Mehr- parteienwahlen abhalte. Nach ihrer Verhaftung rebellierten Kenianer in Nairobi und mehreren Provinzhauptstädten35, was auch in der internationalen Presse dokumentiert wurde. Kirchen riefen zu großen gemeinsamen Gebeten auf.
Im Dezember 1990 schaffte Moi auf öffentlichen Druck hin das queuing ab.36 Aber es sollte noch ein weiteres Jahr dauern, bis Moi dem internationalen und internem Druck nachgeben und Mehrparteienwahlen ankündigen würde.
Wie ich gezeigt habe, wurden bürgerliche und politische Freiheiten unter Moi stark eingeschränkt. Oppositionelle Politiker wurden in großem Stil gekauft, unliebsame Kritiker immer wieder verhaftet.
Die politische Autonomie der Universitäten wurde effektiv abgeschafft, die Unabhängigkeit der Judikative für 2 Jahre stark eingeschränkt. Neben den erwähnten politischen wurden auch kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten unter Moi stark beschnitten.37
In Anlehnung an Dahl mußdas kenianische System der zweiten Phase als wenig demokratisch charakterisiert werden. Von der politischen Offenheit der Kenyatta-Ära war nichts mehr zu spüren. Was Verfassung, Partizipation und Bürgerrechte anging, wurde die politische Atmosphäre Kenias in den 80er Jahren nicht demokratischer, sondern autoritärer.
Trotz aller Repression konnte sich zum Ende der zweiten Phase eine Zivilgesellschaft herausbilden, die in den 90er Jahren eine große Rolle für die Demokratisierung des Landes spielen sollte. Die Zivilgesellschaft in Kenia war aber gegenüber der Regierungspartei nicht stark genug, um das politische System Kenias mit eigenen Kräften umgestalten zu können. Dazu bedurfte es eines äußeren Anstoßes, der das ökonomische Fundament der Moi-Regierung ins Wanken brachte.
3) Phase 3: 1991 bis zur Gegenwart
Angeregt durch die Bürgerbewegungen in Osteuropa bildete sich im Mai 1991 eine breite Koalition von oppositionellen Gruppen in Kenia, die sich FORD (Forum for the Restoration of Democracy) nannte. Dieses Bündnis konnte ihr Anliegen auch Kenias internationaler Gebergemeinschaft vermitteln, die im November 1991 die sofortige Einstellung der Zahlung von 350 Millionen US-Dollar schnellabfließender Mittel an Erfahrungen mit Zaire und Kenia." In: Rolf Hanisch (Hrsg.): Demokratieexport in die Länder des Südens?, Deutsches Übersee-Institut, Hamburg 1996, S. 319. Kenia beschloß.38 Die Wirtschaftshilfe wurde an politische Konditionen geknüpft: Das Regime sollte Reformen durchführen, die Bildung von Oppositionsparteien zulassen und freie Wahlen ankündigen. Moi informierte eine Delegiertenkonferenz der KANU, daßder Regierung keine andere Wahl bleibe, als die Verfassung zu ändern und ein Mehrparteienesystem zuzulassen.
Schnell bildeten sich Oppositionsparteien. Unzufriedene Mitglieder des Kikuyu- Establishments um Mwai Kibaki gründeten die Democratic Party of Kenia (DP). Ethnische und persönliche Rivalitäten innerhalb von FORD führten zur Spaltung dieses Bündnisses: Kenneth Matiba, der der prominenteste Vertreter des Kikuyu-Flügels bei FORD gewesen war, gründete FORD-Asili 39. Rubia gründete die Partei Kenya National Congress, während Odingas Flügel von FORD die Partei FORD-Kenya gründete.
Moi warnte die Politiker, daßeine Parteienbildung entlang ethnischer Linien inter- ethnische Konflikte schüren könnte. Diese Warnung Mois kann als explizite Drohung aufgefaßt werden, denn es waren KANU -Aktivisten der Rift Valley, die eine Aktion der "ethnischen Säuberung" ankündigten, um Oppositionelle aus der Region zu vertreiben. Sie sagten, sie wollten die Rift Valley zur oppositionsfreien Zone machen. Im April und Mai 1992 brachen gewaltsame Konflikte aus, besonders in Distrikten, die an die Gebiete der Kalenjin grenzten.40 Bei den Auseinandersetzungen gab es bis an die 1000 Tote und zehntausende von Vertriebenen.41
In den ersten freien Wahlen nach fast 30 Jahren zeigte sich, daßsich das Wahlverhalten der Kenianer stark an der jeweiligen ethnischen Zugehörigkeit orientierte: KANU triumphierte in der Rift Valley, besonders im Gebiet der Kalenjin; FORD-Kenya wurde am meisten von Luos und radikalen Intellektuellen unterstützt. Matibas FORD-Asili gewann breite Unterstützung unter ärmeren Kikuyus, während die DP vor allem wohlhabende Kikuyus hinter sich sammeln konnte.
Die siegreiche KANU aber war die Partei, die die größte Attraktivität für Wählende in ganz Kenia hatte: Die KANU-Abgeordneten für das neue Parlament kamen aus 21 ethnischen Gruppen. Sie gewannen die absolute Mehrheit von 100 Sitzen im Parlament.42 Moi wurde als Präsident bestätigt. Die landesweite Unterstützung für Daniel arap Moi und KANU war von der Opposition unterschätzt worden. Ein noch größerer Fehler aber war die Fragmentierung der Opposition, deren 3 wichtigste Präsidentschaftskandidaten zusammen 3,3 Millionen Stimmen erhielten. Moi wurde mit nur 1,9 Millionen Stimmen wiedergewählt.43
Bei den Wahlmanipulationen gingen die Verantwortlichen diesmal weitaus geschickter vor, so daßes weniger krude Manipulationen gab. KANU-Provinzbeamte wählten die Taktik, bei der Wahlregistrierung KANU-Unterstützer mit Bussen aus provinziellen Hochburgen der Partei in umkämpfte Wahlkreise wie Nairobi und Mombasa zu fahren, um dort den Stimmanteil für KANU zu erhöhen. Nach Stefan Mair litten die Wahlen an vier weiteren Defiziten, die es schwer machen, diese als positiv im Hinblick auf Partizipationsmöglichkeiten zu klassifizieren:
"Erstens wurden in 18 Wahlkreisen Gegenkandidaten der Regierungspartei daran gehindert, ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Zweitens wurde etwa 2 Millionen Jugendlichen die Registrierung als Wähler verweigert. Drittens war den durch die tribal clashes unmittelbar vor der Wahl Vertriebenen die Wahlteilnahme faktisch unmöglich. Und viertens wurde der Islamic Party of Kenya die Registrierung als Partei verwehrt."44
Ein wichtiger Vorteil der Regierungspartei gegenüber ihren Konkurrentinnen bestand darin, daßsie über beträchtliche Finanzmittel und direkten Einflußauf die elektronischen Medien verfügte, die in erster Linie Wahlkampfinstrumente Mois waren. Die Regierung benutzte den Staatshaushalt, um die eigene Kampagne zu finanzieren und Oppositionelle zu bestechen.45
Die Wahlen können insgesamt also nicht als frei und fair bezeichnet werden. Nur aus Gründen politischer Opportunität vergaben internationale Wahlbeobachtergruppen das Gütesiegel "frei und fair" (mit Einschränkungen), da eine Annullierung der Wahlen den Auftakt eines Bürgerkrieges hätte bedeuten können.46
Die internationalen Geber Kenias nahmen nach dem Wahlsieg Mois die Entwicklungshilfezahlungen wieder auf. Die Stellung Mois gegenüber den Gebern verbesserte sich im übrigen durch den Umstand, daßjene Kenias logistische Unterstützung für die UN-Intervention in Somalia benötigten.
Bei den letzten Parlaments- und Präsidialwahlen im Dezember 1997 konnten sich Moi und KANU erneut gegen die wiederum gespaltene Opposition durchsetzen. Daniel arap Moi errang sogar 40,4 % der Stimmen, womit er fast 4 Prozentpunkte gewann. Kibaki errang 30,9 % der Stimmen, Raila Odinga, Sohn des verstorbenen Oginga Odinga, hatte mit 10,8 % das drittbeste Ergebnis.
Bei den Parlamentswahlen verlor KANU gegenüber 1992 an Prozentpunkten, wodurch auch die relative Stärke der Fraktion im Parlament abnahm. Sie behielt aber knapp ihre absolute Mehrheit (113 von 220 Sitzen). Kibakis Partei DP konnte sich an zweiter Stelle mit 41 Sitzen etablieren.47 Die Social Democratic Party (SDP) und Safina ("Die Arche") können als demokratische Hoffnungsträger der Zukunft bezeichnet werden, da sie sich anders als die großen Parteien nicht etnisch-regional, sondern programmatisch definieren.48
Die Durchführung der Wahlen mußals chaotisch bezeichnet werden, was aber nicht KANU, sondern der kenianischen Wahlkommission angelastet werden muß. Die Wahlen können angesichts erneuter Manipulationen nicht frei und fair genannt werden, wurden aber dennoch in ihrer Tendenz von Wahlbeobachtern und Opposition als Ausdruck des Wählerwillens anerkannt.49
Die Ausgangsbedingungen der Opposition wurden durch Verfassungsreformen im November letzten Jahres verbessert. Das wog aber nicht den Vorteil auf, den Regierungskandidaten aus der einseitigen Berichterstattung von Rundfunk und Fernsehen ziehen konnten.
Die Wahlbeteiligung war mit 68% der registrierten Wahlberechtigten sehr hoch. Es ging damit ein noch höherer Prozentsatz der Bevölkerung zur Wahl als 1992.
Bilanziert man nun die Entwicklung Kenias der 90er Jahre in Bezug auf die ersten beiden Elemente meines Analyserasters, kommt man zu folgendem Ergebnis: Mehrparteienwahlen haben sich trotz Mois kontinuierlicher Äußerungen zugunsten eines Einparteienstaates fest in Kenia etabliert. Die dauerhafte Einrichtung eines Mehrparteiensystem ist jedoch noch nicht gleichbedeutend mit einem "Sieg der Demokratie". Die Wahlen 1997 zeichneten sich gegenüber 1992 durch ein geringeres Maßan Manipulation und hohe Partizipation aus.
Die Zivilgesellschaft in Kenia ist weitaus stärker als in den benachbarten Ländern Tansania oder Uganda. Es gibt eine Vielzahl freiwilliger Vereinigungen: Das Spektrum von Interessensverbänden umfaßt Clubs, Gewerkschaften, Kirchen, Genossenschaften, Selbsthilfegruppen sowie Wohlfahrts- und Entwicklungsorganisationen. Einige der freiwilligen Vereinigungen klagen nicht nur Demokratie ein, sondern thematisieren auch soziale und ökologische Probleme.50 Besonderer Grund zur Hoffnung in diesem Bereich besteht im Hinblick auf einen Zusammenschlußvon NROs unter der Bezeichnung Citizens Coalition for Constitutional Change (4Cs). Die Coalition arbeitet auf eine Verfassungsreform hin. In ihr soll das Verhältniswahlrecht eingeführt werden, die Judikative gestärkt und die präsidiale Machtfülle beschnitten werden.51
Wenn man ausschließlich das 2. Element der Partizipation betrachtet, steht das Land im afrikanischen Vergleich gut da.
Im Vergleich zu westlichen Demokratien schneidet Kenia vor allem im dritten Element meines Analyserasters noch immer schlecht ab. Die Regierung nutzt das bestehende umfangreiche legale Instrumentarium, um politische Freiheiten faktisch einzuschränken:
In den 90er Jahren gab es immer wieder Berichte von Verhaftungen und Mißhandlungen kritischer Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Angehöriger der Oppositionsparteien.
Außerdem dominiert die KANU noch immer die Verbreitung von Informationen: Offizielle Ansichten der Regierung werden in den Medien bevorzugt präsentiert. Alternative Informationsquellen stehen hingegen nicht allen Bevölkerungsteilen zur Verfügung.
Das kenianische politische System nach den Dahlschen Kriterien als Demokratie zu bezeichen, fällt ansonsten noch immer schwer. Dazu ist die Staatsklasse Kenias, die neben dem Präsidenten und den Parteifunktionären der KANU auch die Spitzen von Verwaltung und Armee umfaßt, zu einflußreich. Ihr oberstes Ziel ist die Auf- rechterhaltung der Macht und die Sicherung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Privilegien.
Zu einer Demokratie gehören nach den Dahlschen Kriterien aber auch die Einhaltung der Menschen- und Bürgerrechte, die auch in den 90er Jahren in Kenia stark eingeschränkt sind.
Mit Spannung kann in der nächsten Zeit das Ergebnis der Arbeit der nationalen Verfassungskommission erwartet werden. Der neue Verfassungsentwurf soll auf den Prinzipien Rechtsstaatlichkeit und Mehrparteiendemokratie beruhen. Ebenso spannend dürfte die Frage sein, wer zum Nachfolger von Präsident Moi gewählt wird, dessen Amtszeit im Jahre 2002 ausläuft.
Wenn man die Entwicklung Kenias "hin zu mehr Demokratie" untersucht, stößt man auf einen wichtigen Aspekt, der in Dahls Kriterien nicht vorkommt. Das wichtigste strukturelle Defizit des kenianischen Demokratisierungsprozesses ist die soziale Aufgliederung entlang ethnischer Linien. Ethnisch definierte Klientelbeziehungen ließen eine politische Kultur entstehen, in der die Konkurrenz zwischen Volksgruppen die Machtstrategien bestimmt. Hofmeier spricht von einer Obsession bezüglich Fragen der ethnischen Zugehörigkeit in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.52 Auch die letzten Wahlen." In: Herder-Korrespondenz. 51. Jhg., Januar 1997, S. 44. Wahlen standen unter dem starken Einflußethnisch-regionalem Wahlverhaltens. Obwohl das Land wohl nicht am Rande eines Bürgerkrieges steht, mahnt der nur 6 Jahre zurückligende Höhepunkt der tribal clashes, daßein funktionierendes demokratisches System in Kenia mittelfristig dem Anliegen der ethnisch-regionalen Gruppen Rechnung tragen muß. Langfristig ist zu hoffen, daßdas Phänomen dieser "politisierten Ethnizität" mit sozialen Verbesserungen und politischen Maßnahmen eingedämmt werden kann.
C. Fazit
Hinsichtlich der Klassifizierung jeder der drei untersuchten Phasen der kenianischen Geschichte kann man bei keiner "ohne Kopfschmerzen" von einer Demokratie sprechen.
In der ersten Phase, im Zeitraum von 1963 bis 1978, zeigte sich Kenia als offenes politisches System. Obwohl das Land schon zum Ende der 60er Jahre de facto ein Einparteienstaat war, galt es als viel demokratischer als viele seiner afrikanischen Nachbarstaaten hinsichtlich der Frequenz von Wahlen, Rechtstaatlichkeit und Partizipation.
In der zweiten Phase wurde der Stil der Politik unter Kenias zweitem Präsidenten Daniel arap Moi weitaus autoritärer. Wahlen wurden im großen Stil manipuliert, unliebsame Oppositionelle verhaftet, die Unabhängigkeit der Judikative aufgehoben und politische Freiheiten rigoros eingeschränkt. Formal galt noch immer die kenianische Verfassung, deren demokratische Wirkung aber durch amendments und Nichtbeachtung zugunsten der Macht der Regierungspartei unterhöhlt wurde. Dennoch konnte sich in den 80er Jahren eine in Ostafrika herausragende Zivilgesellschaft bilden, die intern und über internationale Verbindungen schließlich großen Druck auf die Staatsklasse ausüben konnte.
Seit 1992 besteht Anlaßzur Hoffnung. Die Bevölkerung hatte in 2 Wahlen die Auswahl unter einer Reihe von unterschiedlichen Parteien. Obwohl aus beiden Wahlen Mois Staatspartei KANU als Siegerin hervorging, wird sie in naher Zukunft durch Druck der Zivilgesellschaft gezwungen sein, das System weiter zu demokratisieren. Die Menschenrechtssituation hat sich tendenziell verbessert, Wahlmanipulationen haben abgenommen. Mißt man Kenias politisches System aber an westlichen Standards, so kann Kenia noch immer nicht als Demokratie im Dahlschen Sinne bezeichnet werden.
Es bleibt abzuwarten, wie weit sich die Politik in Kenia weiter an ethnischen Linien entlang orientieren wird. Diese politisierte Ethnizität stellt gegenwärtig die größte Gefahr für Stabilität und eine weitere Demokratisierung Kenias dar.
D. Literaturverzeichnis
Bates, Robert H.: Beyond the miracle of the market. The political economy of agrarian development in Kenya. Cambridge University Press, Cambridge 1989.
Berg-Schlosser, Dirk und Rainer Siegler: Politische Stabilität und Entwicklung. Eine vergleichende Analyse der Bestimmungsfaktoren und Interaktions muster in Kenia, Tansania und Uganda. Forschungsberichte des BMZ Band 88. Weltforum, München 1988.
Berg-Schlosser, Dirk: "Demokratie und Entwicklung in Afrika"In: Wilfried von Bredow und Thomas Jäger: Demokratie und Entwicklung. Theorie und Praxis der Demokratisierung in der Dritten Welt. 1997. S. 77- 95.
Chazan, Naomi et al.: Politics and society in contemporary Africa. Macmillan, London 1988.
Dahl, Robert A: Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven 1971.
Haugerud, Angelique: The culture of politics in modern Kenya. Cambridge University Press, 1995.
Hofmeier, Rolf: "Soziokulturelle Länderanalyse. Kenya". Afrika Spectrum 28/2 (1993), S. 279-290.
Kapur/Lewis/Webb (ed.): The World Bank: its first half century.Volume II: Perspectives. The Brookings Institute, Washington 1997.
"Kenya. Close Shave." In: Africa Confidential, 39/1, January 1998, S. 4-5.
Mair, Stefan: "Fördert Demokratisierung die sozioökonomische Entwicklung?". Afrika Spectrum 31 (1996)1, S. 37-56.
Mair, Stefan: Politischer Wandel in Ostafrika. Stiftung Wissenschaft und Politik, Eberhausen 1996.
Mair, Stefan: "Wahlen in Kenia - ein Zwischenhalt auf dem Weg zur Demokratie." In: SWP - aktuell. No. 18/Januar 1998.
Medard, Jean-Francois: "The Historical Trajectories of the Ivorian and Kenyan States", in: James Maner (Hg.): Rethinking Third World Politics. Longman, London and New York 1991.
Neubert, Dieter: Entwicklungspolitische Hoffnungen und gesellschaftliche Wirklichkeit. Campus Verlag, Frankfurt/Main 1997.
Neubert, Dieter: "Westliche politische Ideen und ihre Verwirklichung in Afrika. Demokratisierung und Menschenrechte in Kenia und Ruanda." In: Peripherie Nr. 61, 16.Jhg., März 1996, S. 43-64.
Nyong'o, Peter Anyang': Popular struggles for democracy in Africa. Zed Books, London 1987.
Ogot, B.A.: "The Politics of Populism". In: Ogot, B.A. und W.R. Ochieng': Decolonization & Independence in Kenya 1940-93. James Currey Ltd., London 1995, S. 187-213.
Peters, Ralph-Michael: Demokratisierung in der Sackgasse. Kenia - ein Jahr vor den Wahlen." In: Herder-Korrespondenz. 51. Jhg., Januar 1997, S. 39-44.
Sandbrook, Richard: The Politics of Africa's Economic Stagnation. Cambridge University Press, 1985.
Sandbrook, Richard: The Politics of Africa's Economic Recovery. Cambridge University Press, 1993.
Schmidt, Manfred G.. Demokratietheorien. Leske + Budrich, Opladen 1995.
Schmidt, Siegmar: "Widerstand gegen Demokratie- und Menschenrechtsinventionen: Afrika - Erfahrungen mit Zaire und Kenia." In: Rolf Hanisch (Hrsg.): Demokratieexport in die Länder des Südens? Deutsches Übersee-Institut, Hamburg 1996, S. 297- 338
Throup, David: "Elections and political legitimacy in Kenya."In: Africa 63/3, 1993, S. 371-396.
The World Bank: Kenya. Re-investing in Stabilization and Growth through Public Sector Adjustment. World Bank, Washington D.C. 1992.
[...]
1 Siehe Dirk Berg-Schlosser: "Demokratie und Entwicklung in Afrika."In: Wilfried von Bredow und Thomas Jäger: Demokratie und Entwicklung. Theorie und Praxis der Demokratisierung in der Dritten Welt. 1997, S. 77.
2 Robert A. Dahl: Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press, New Haven 1971.
3 Kenyatta schuf ein Kartell von Staat und ethnisch-regionalen Eliten, in dem allen wichtigen ethnisch-regionalen Gruppen ein Mindestmaßan Partizipation gewährt war. Das bargaining zwischen prominenten regionalen Führern auf höchster Ebene führte zu Absprachen von Gruppen und verhinderte einen offenen Wettbewerb um Machtanteile. Siehe Naomi Chazan et al.: Politics and society contemporary Africa. Macmillan, London 1988, S. 109f. Siehe auch David Throup: "Elections and political legitimacy in Kenya."In: Africa 63/3, 1993, S. 383ff.
4 "Patrimonial refers to an ideal type where the public domain is not distinguished from the private. Neo-patrimonialism refers to a modified type which supposes an articulation between two contradictory logics: patrimonial logic and bureaucratic logic." Siehe Jean-Francois Medard: "The Historical Trajectories of the Ivorian and Kenyan States" In: James Maner (Hg.): Rethinking Third World Politics. Longman, London and New York 1991, S. 208.
5 Siehe ebd., S. 208.
6 Siehe Throup: Elections, S. 371.
7 Siehe Robert H. Bates: Beyond the miracle of the market. The political economy of agrarian development in Kenya. Cambridge University Press, Cambridge 1989, S. 147. Im ostafrikanischen Kontext steht Kenyattas Vorgehensweise der von Nyerere in Tanzania diametral entgegen, der auf Planwirtschaft, equity und self-reliance setzte.
8 Siehe Stefan Mair: Politischer Wandel in Ostafrika. Stiftung Wissenschaft und Politik, Eberhausen 1996, S. 12.
9 Die jährliche Wachstumrate fiel bis 1984 von 6,5 % auf 3%. Siehe Dirk Berg- Schlosser und Rainer Siegler: Politische Stabilität und Entwicklung. Eine vergleichende Analyse der Bestimmungsfaktoren und Interaktionsmuster in Kenia, Tansania und Uganda. Forschungsberichte des BMZ Band 88. Weltforum, München 1988, S. 59.
10 Siehe Mair: Politischer Wandel, S. 25.
11 Siehe ebd. und Throup: Elections, S. 390.
12 Siehe Dahl: Polyarchy, S. 3.
13 Dahl benutzt den Begriff Poliarchie.
14 Siehe Throup: Elections, S. 373.
15 Obwohl der Verfasser mit den Ergebnissen feministischer Sprachforschung übereinstimmt, nach denen sich ein bestimmtes Bewußtsein auch aus patriarchalischer Sprache bildet, verzichtet er hier aus rein praktischen Gründen auf die Verwendung der weiblichen Formen. Die Arbeit wird schließlich nicht in den "öffentlichen Raum" gelangen. (Jetzt doch: Grüße von Max!)
16 Siehe Throup: Elections, S. 379.
17 Siehe ebd., S. 380.
18 1969 wurden nur 74% der Minister und 52% der assistant ministers wiedergewählt. In den darauffolgenden zwei Wahlen wurden nie mehr als 80% der Minister und 52% der assistant ministers des Kabinetts als Repräsentanten bestätigt. Siehe ebd., S. 377.
19 Ebd., S. 378.
20 Siehe B.A. Ogot: "The Politics of Populism". In: Ogot/Ochieng': Decolonization & Independence in Kenya 1940-93. James Currey Ltd., London 1995, S. 189f.
21 Die Ausgaben pro Stimme beliefen sich auf zwei drittel der Kosten, die in den USA pro Stimme aufgewendet werden. Siehe Throup: Elections, S. 384.
22 Siehe ebd., S. 384.
23 Für eine detailliertere Auflistung der Manipulationspraktiken siehe ebd., S. 388f.
24 Diese Regelung widersprach nach Meinung der Kritiker der Kenianischen Verfassung: Wähler, die nicht Mitglieder der KANU waren, konnten in ihrem Wahlkreis nicht an der Wahl ihres Repräsentanten teilnehmen. Siehe Ogot: Populism, S. 207.
25 Troup: Elections, S. 385.
26 Das Amt, was bei der Anmeldung neuer Organisationen zuständig ist.
27 Siehe ebd., S. 375.
28 Das betraf die Gikuyu, Embu and Meru Association (GEMA), die Luo Union, die New Akamba Union (NAU), die Abaluhya Association, die Kelenjin Association und die Miji-Kenda Association.
29 Message to the Nation (Nairobi, Government Printer 12 December 1982). Ebd., S. 203f.
30 siehe Ogot: Populism, S. 198.
31 Ebd., S. 199.
32 Vorher konnten Verdächtigte nur 24 Stunden festgehalten werden.
33 Matatu taxis sind Überlandbusse. Haugerud schreibt, daßin diesen Bussen oppositionelle Gedanken vermittelt wurden, indem dort z.B. verbotene regimekritische Musik gespielt wurde. Siehe Angelique Haugerud: The culture of politics in modern Kenya. Cambridge University Press, 1995, S. 17.
34 Die, welche Kenia de jure zu einem Einparteienstaat gemacht hatte.
35 Dieser Tag ging als saba saba day als eine Art nationalistische Metapher in die Geschichte ein. Saba ist Swahili für sieben. Siehe ebd., S. 23.
36 Auch die Amtssicherheit für Richter wurde 1990 wieder eingeführt. Siehe Siegmar Schmidt: "Widerstand gegen Demokratie- und Menschenrechtsinventionen: Afrika -
37 Siehe Haugerud: Culture of Politics, S. 28-32.
38 Diese Summe war nur ein Teil von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar Entwicklungshilfe, doch es handelte sich um Mittel, die nicht projektgebunden waren und deren Stornierung somit den Handlungsspielraum der Regierung stark einschränken konnte. Siehe Schmidt: Widerstand, S. 317.
39 Übersetzt "das ursprüngliche FORD".
40 Siehe Throup: Elections, S. 391.
41 Siehe Rolf Hofmeier: "Soziokulturelle Länderanalyse. Kenya". Afrika Spectrum 28/2 (1993), S. 280.
42 FORD -Asili und FORD -Kenya errangen je 31 Sitze, die DP errang 22 Sitze, 3 Sitze gingen an weitere Parteien.
43 Siehe Throup: Elections, S. 390ff.
44 Mair: Politischer Wandel, S. 63f.
45 Siehe Schmidt: Widerstand, S. 320.
46 Siehe ebd., S. 321.
47 Siehe Stefan Mair: "Wahlen in Kenia - ein Zwischenhalt auf dem Weg zur Demokratie.", in: SWP - aktuell. No. 18/Januar 1998, S. 1ff. und Africa Confidential, S. 4.
48 SDP und Safina errangen zusammen 22 Sitze.
49 Mair: Wahlen, S. 4.
50 Siehe Dieter Neubert: "Westliche politische Ideen und ihre Verwirklichung in Afrika. Demokratisierung und Menschenrechte in Kenia und Ruanda." In: Peripherie Nr. 61, 16.Jhg., März 1996, S. 55f.
51 Ralph-Michael Peters: Demokratisierung in der Sackgasse. Kenia - ein Jahr vor den
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieser Analyse über Kenia?
Die Analyse untersucht, ob Kenia als "demokratisch" klassifiziert werden kann, indem die politische und wirtschaftliche Entwicklung seit der Unabhängigkeit betrachtet wird. Sie teilt die postkoloniale Geschichte Kenias in drei Phasen ein und bewertet, inwieweit das Land in jeder Phase als "Demokratie" bezeichnet werden kann. Die Kriterien des Politikwissenschaftlers Robert A. Dahl dienen als Grundlage der Analyse.
Welche drei Phasen der kenianischen Geschichte werden in der Analyse untersucht?
Die drei Phasen sind: 1) Die Politik unter Kenyatta von 1963 bis 1978; 2) Die Politik unter Moi von 1979 bis 1991; und 3) Die Politik seit den Mehrparteienwahlen Ende 1991 bis zur Gegenwart.
Welche Kriterien von Robert A. Dahl werden verwendet, um die Demokratie in Kenia zu bewerten?
Die Analyse orientiert sich an sieben Institutionen, die nach Dahl idealtypisch eine Demokratie konstituieren: Gewählte Vertreter in freien und fairen Wahlen, aktives und passives Wahlrecht für alle Erwachsenen, Versammlungs- und Organisationsfreiheit, Rede- und Meinungsfreiheit, und Informationsvielfalt. Diese werden in drei zentrale Elemente zusammengefasst: Wettbewerb bei unmanipulierten Wahlen, hohes Niveau an Partizipation und bürgerliche/politische Freiheiten.
Wie wird die politische Entwicklung Kenias unter Präsident Kenyatta (Phase 1) charakterisiert?
Kenyatta wird als patriarchaler Herrscher beschrieben, der sein Regime auf die Unterstützung starker ethnisch-regionaler Gruppen aufbaute. Trotz autoritärer Züge, insbesondere gegenüber der Oppositionspartei KPU, wird der Einparteienstaat unter Kenyatta als relativ offen bezeichnet, mit Möglichkeiten zur Artikulation regimekritischer Meinungen innerhalb der KANU und einer relativ freien Presse.
Wie veränderte sich die politische Landschaft unter Präsident Moi (Phase 2)?
Unter Moi wurde das politische System autoritärer. Es gab zunehmende Wahlmanipulationen, Beschränkungen der Bürgerrechte, Einschränkungen der Unabhängigkeit der Judikative und eine generelle Verringerung der politischen Freiheiten. Die Regierung favorisierte zunehmend die Kalenjin und andere ethnische Gruppen, während die zivilgesellschaftliche Opposition unterdrückt wurde.
Welche Rolle spielten die Geberländer bei der Demokratisierung Kenias (Phase 3)?
Die Geberländer übten erheblichen Druck auf die Regierung Moi aus, politische Reformen durchzuführen und Mehrparteienwahlen zuzulassen. Im November 1991 setzten sie die Zahlung von Finanzhilfen an Kenia aus und forderten Demokratisierung, politische Liberalisierung und ein Vorgehen gegen die Korruption.
Wie verliefen die ersten Mehrparteienwahlen nach fast 30 Jahren in Kenia (Phase 3)?
Die Wahlen im Jahr 1992 waren von ethnischen Spannungen und Wahlmanipulationen geprägt. Obwohl die KANU unter Moi siegreich war, zeigten die Wahlen, dass sich das Wahlverhalten der Kenianer stark an der jeweiligen ethnischen Zugehörigkeit orientierte. Die Fragmentierung der Opposition trug zum Sieg von Moi bei.
Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft in der Demokratisierung Kenias (Phase 3)?
Die Zivilgesellschaft in Kenia, einschließlich Kirchen, Gewerkschaften, der Law Society of Kenya und verschiedener NGOs, spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung von Demokratie und Menschenrechten. Sie übt Druck auf die Regierung aus und arbeitet auf Verfassungsreformen hin.
Was ist das größte strukturelle Defizit des kenianischen Demokratisierungsprozesses laut der Analyse?
Das größte strukturelle Defizit ist die soziale Aufgliederung entlang ethnischer Linien. Ethnisch definierte Klientelbeziehungen lassen eine politische Kultur entstehen, in der die Konkurrenz zwischen Volksgruppen die Machtstrategien bestimmt. Diese politisierte Ethnizität stellt eine Gefahr für die Stabilität und weitere Demokratisierung Kenias dar.
- Quote paper
- Paul Michel (Author), 1998, Chancen für Demokratisierung in Kenia?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95195