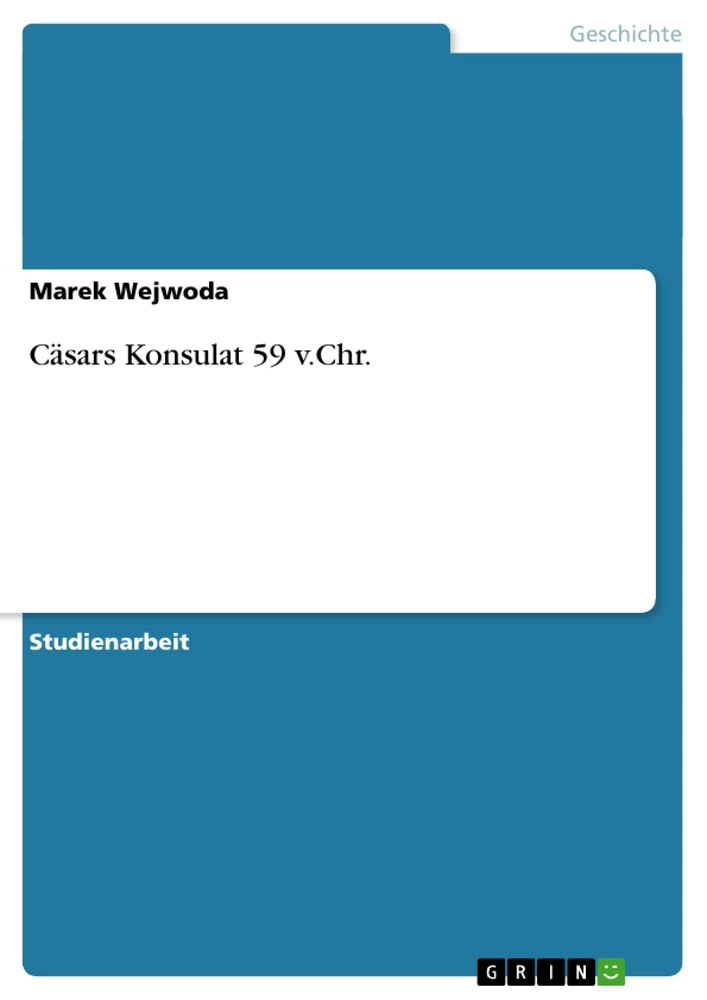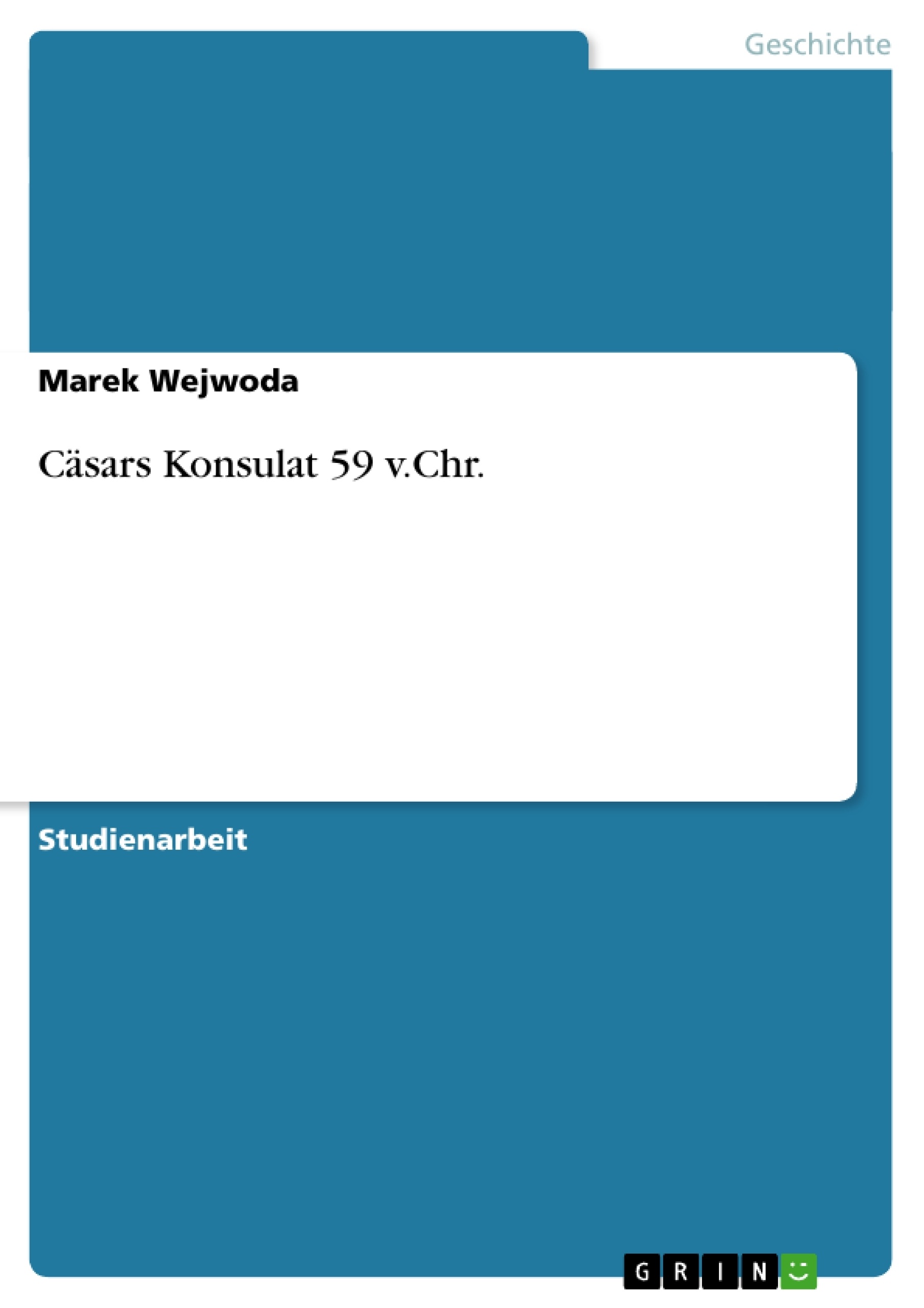Ein Jahr, das Rom veränderte: Tauchen Sie ein in das turbulente Konsulat Caesars im Jahr 59 v. Chr., eine Periode, die oft als Wendepunkt in der Geschichte der Römischen Republik beschrieben wird. Diese tiefgreifende Analyse entwirrt das komplexe Netz politischer Intrigen, persönlicher Ambitionen und gesellschaftlicher Umwälzungen, das die späte Republik kennzeichnete. Im Zentrum steht die Frage, wie sich Caesars Handlungen in das Machtgefüge seiner Zeit einordneten und welche langfristigen Konsequenzen sie nach sich zogen. Beleuchtet werden die tiefgreifenden Krisen, die die Republik bis 60 v. Chr. erschütterten, darunter das brüchige Gleichgewicht zwischen Gleichheitsideal und Leistungsprinzip, die veränderte Clientelstruktur und deren verheerende Auswirkungen auf die römische Politik. Erfahren Sie, wie die Rückkehr des Pompeius und die daraus resultierende Senatsopposition die politische Landschaft prägten und den Weg für das folgenschwere Triumvirat ebneten. Detailliert werden Caesars politische Strategien und die Obstruktionsversuche seiner Gegner analysiert, die in einem Klima der Gewalt und des Misstrauens kulminierten. Die Schlüsselmomente des Jahres, von der Einführung des Ackergesetzes bis zur lex Vatinia de imperio Caesaris, werden in ihrem historischen Kontext beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis der damaligen Machtverhältnisse zu ermöglichen. Es wird untersucht, wie Caesars Konsulat die senatorische Autorität untergrub und den Weg für seinen Aufstieg zur Alleinherrschaft bereitete. Die Rolle von Schlüsselfiguren wie Cicero, Cato, Pompeius und Crassus wird kritisch hinterfragt, um die Dynamik dieses entscheidenden Jahres zu erfassen. Dieses Buch bietet nicht nur eine detaillierte Rekonstruktion der Ereignisse, sondern auch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Ursachen und langfristigen Folgen der Krise der Römischen Republik. Es ist eine unerlässliche Lektüre für alle, die sich für die Geschichte Roms, politische Strategie und die Dynamik von Macht und Autorität interessieren. Entdecken Sie, wie ein einziges Jahr die Weichen für das Schicksal einer ganzen Zivilisation stellte und die Welt für immer veränderte. Eine fesselnde Reise in die Vergangenheit, die auch heute noch relevante Einblicke in die Natur von Politik und Führung bietet. Die Analyse der Quellenlage, darunter Ciceros Briefe, Suetons Biographien und Cassius Dios Römische Geschichte, ermöglicht einen authentischen Einblick in die Denkweise und die Beweggründe der Akteure.
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Zielsetzung
1.2. Quellen
2. Die Krise der Republik bis 60 v.Chr.
2.1. Charakter der Krise
2.1.1. Gleichheitsideal und Leistungsprinzip
2.1.2. Veränderung der Clientelstruktur
2.1.3. Auswirkungen auf die römische Politik
2.1.4. Krise ohne Alternative
2.2. Politische Situation um 60 v.Chr.
2.2.1. Rückkehr des Pompeius und Senatsopposition
2.2.2. Triumvirat
3. Politik und Obstruktion in Caesars Konsulat
4. Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
1.Einleitung
1.1. Zielsetzung
Besonders aus der Perspektive moderner Geschichtswissenschaft erscheint Caesars Konsulatsjahr, das Jahr 59 v.Chr., als "Markstein" (Gelzer), als "tiefer Einschnitt" (Meier) in der römischen Geschichte1. Offensichtlich hat die Beschleunigung, die die Entwicklung der späten römischen Republik in jenem Jahr erfuhr, bei den Betrachtern einen Hauch des Revolutionären erzeugt, der sich in derartigen Urteilen niedergeschlagen hat.
Wenn der Titel dieser Arbeit "Caesars Konsulat" lautet, kann von den Grundzügen die ser Entwicklung also nicht abgesehen werden. Im Vordergrund darf nicht die bloße Ab folge der Ereignisse stehen. Wichtiger muß sein, den inneren Zusammenhang des Ge schehens zu verstehen und zu formulieren. Deshalb soll im Zentrum die Frage stehen, wie sich dieses Jahr in die Geschichte der späten römischen Republik einordnet. Als Caesars Konsulatsjahr ist es dabei andererseits wie kaum ein anderes dazu geeignet, die Grundzüge seiner Zeit zu verdeutlichen.
Weil also "Caesars Konsulat" nur im Kontext seiner Bedingungen verstanden werden kann, ist es Ziel dieser Arbeit, jenen Höhepunkt der Entwicklung vor dem Hintergrund der sich beschleunigt zuspitzenden Krise der Republik nachzuzeichnen. Dazu ist es zunächst notwendig, wenigstens in Umrissen zu klären, was die Krise der Republik ih rem Wesen nach war (2.1.). Danach werde ich kurz auf die Ausgangslage um 60 v.Chr. eingehen (2.2.). Vor diesem Hintergrund werden dann die Ereignisse des Jahres 59 zu schildern sein, wobei die Auswirkungen der in 2.1. erörterten Grundtendenzen immer wieder hervortreten werden(3). Auch hier geht es nicht hauptsächlich um eine gleichge wichtige Darstellung der Ereignisse. Dem Anliegen dieser Arbeit entsprechend werden Prioritäten zu setzen sein. In einem Fazit(4) soll schließlich die historische Bedeutung jenes Jahres zusammenfas send erörtert werden.
1.2. Quellen
Der Höhepunkt der innenpolitischen Auseinandersetzungen in der römischen Republik geht einher mit einem Höhepunkt der Schriftkultur. Kein anderer Zeitraum ist uns besser dokumentiert als der des Niedergangs der res publica. Die wesentlichen unter den erhaltenen Dokumenten sind hier die Reden, Briefe und Abhandlungen Ciceros, die einen tiefen Einblick in das Innenleben des römischen Gemeinwesens ermöglichen, zudem Sallusts Monographie de Catilinae coniuratione, und besonders für die Endphase auch Caesars Schriften de bello civile. Die zeitgenössische Literatur ist aber noch wesentlich vielfältiger gewesen, es existierte z.B. eine große Zahl politischer Schriften (Reden, Pamphlete, Briefe) und auch die Zeitgeschichtsschreibung eines Asinius Pollio. Auch auf diesen beruht die kaiserzeitliche Historiographie, deren Wert für uns um so größer ist, desto mehr ihr der verlorene Teil des Schrifttums zugrunde liegt.
Große Bedeutung haben hier die Biographien Plutarchs, die Cäsar-Vita Suetons sowie das 2.Buch der Bürgerkriege Appians. An antiker Geschichtsschreibung ist uns weiterhin ab Buch 36 (68 v.Chr.) die Römische Geschichte des Cassius Dio überliefert2.
Für die Ereignisgeschichte des Jahres 59 sind am wichtigsten die entsprechenden Pas sagen aus Sueton Divus Iulius und Plutarch Caesar, Pompeius, Cicero, Crassus, Cato, zudem Cassius Dio Buch 38 und natürlich Ciceros Äußerungen, unter diesen die Briefe ad Atticum, Buch 2 und einige Reden (de provinciis consularibus, in Vatinium, pro Sestio und andere)
Eine eigenständige Quellenanalyse habe ich im Rahmen dieser Arbeit nicht vornehmen können und werde darin der Sekundärliteratur folgen. Auch war es mir nicht möglich, das gesamte Spektrum der in Betracht kommenden Überlieferung zu berücksichtigen. Ich habe mich deswegen auf die meistzitierten Autoren beschränkt: Cicero ad Atticum Buch 2, Sueton Divus Iulius, Cassius Dio Buch 38 und Plutarchs Caesar-Biographie.
2. Die Krise der Republik bis 60 v.Chr.
2.1. Charakter der Krise
Die Entwicklung der römischen Republik seit den Gracchen wird im allgemeinen als sich zuspitzende, schließlich in Bürgerkrieg und Prinzipat des Augustus mündende Krise gesehen. Diese Krise war ein komplexer, mehrdimensionaler Prozeß. Uns soll hier die Krise der Herrschaftsorganisation interessieren, deren Ursprung in der mangelnden Anpassungs fähigkeit der römischen Verfassung an die Erfordernisse eines sich bis an die Grenzen der bekannten Welt ausdehnenden Reiches lag: Es gelang nicht, die Verwaltung der Provinzen und die Lösung außergewöhnlicher - vor allem ausgedehnter militärischer -Aufgaben in einer Weise zu regeln, die das Gleichgewicht der Nobilität gewahrt hätte.
2.1.1. Gleichheitsideal und Leistungsprinzip
Der aristokratische Charakter der Nobilität beinhaltete ein Gleichheitsideal, das die sie vor dem Übermächtigwerden Einzelner bewahren und sie damit in ihrer Existenz als "entscheidender politischer Faktor"3, als regierende Schicht, erhalten sollte. Trotz der prinzipiellen Gültigkeit dieses Ideals existierte innerhalb der römischen Nobilität aber auch eine Hierarchie des politischen Einflusses. Der politische Einfluß hing dabei von der Leistung ab, die ein nobilis für die res publica erbrachte, und war verkörpert in seiner dignitas. Der Ehrgeiz der Aristokratie wurde so "eingestaatet" und auf das Allgemeinwohl gerichtet, individuelle Interessen wurden gezügelt4.
Das Leistungsprinzip gewährte auf diese Art und Weise die "Regimentsfähigkeit" der Nobilität, konkurrierte aber mit dem Ideal der Gleichheit, zunächst jedoch ohne, daß diese Konkurrenz zum Dilemma geworden wäre5.
Mit zunehmender Ausdehnung der zu lösenden Aufgaben im sich ausdehnenden Reich, mit den mehrjährigen Imperien während der Punischen Kriege, später denen eines Mari us oder Pompeius, kam es jedoch zu so starken Machtkonzentrationen, daß die prinzi pielle Gleichheit der Oligarchie in Gefahr geriet. Die Nobilität mußte um ihrer Existenzwillen zum Gegner der Träger solcher Macht werden.
2.1.2. Veränderung der Clientelstruktur
Die entscheidendste Ursache für solche Machtkonzentrationen ist dabei wohl die tief greifende Veränderung der Clientelstruktur gewesen. Denn Machtbasis und wichtigstes politisches Instrument des römischen Aristokraten war die Clientel, deren Patron er war. Diese ursprünglich sehr konstante und recht gleichmäßige "Verteilung" der plebs6 geriet in Auflösung, als große Heeresverbände sich als die Clientel ihres Feldherrn zu betrach ten begannen. Seit der Heeresreform des Marius strömten vor allem Landlose in die Legionen, die mit der Aussicht auf eigenen Grundbesitz gelockt wurden und "mit deren Entlassung ... die Ansiedlung notwendig verbunden"7 war. Diese Ansiedlung gegen den widerstrebenden Rest der Nobilität durchzusetzen, war "Aufgabe" ihres Patrons. Nicht nur zur Durchsetzung dieses Anspruchs stand ihm dann seine Heeresclientel zur Verfü gung. Die militarisierten Clientelen waren wesentlich dynamischer, mobilisierbarer und effektiver als die alten "Agrarclientelen". Erst sie ermöglichten die Militarisierung der Politik und die Bürgerkriege und waren damit das entscheidende Instrument der "großen Einzelnen" im Kampf um die dominatio.8
2.1.3. Auswirkungen auf die römische Politik
Welche Bedeutung der Kampf um die Landzuweisungen hatte, läßt sich leicht absehen. Dem Senat als dem Organ der Aristokratie war es kaum möglich, etwas zu beschließen, das die ohnehin akute Machtkonzentration eines Imperiumsträgers nur noch zementiert hätte, so notwendig solche Maßnahmen aus sozialpolitischer Sicht auch gewesen wä ren. Weil also die Durchsetzung solcher Forderungen mit dem Senat nicht möglich war, aktivierte man dazu mit Hilfe der Volkstribunen zunehmend die Volksversammlung. So wurde 20 Jahre nach den Gracchen die gracchisch-populare Methode unter Marius wiederbelebt, was dazu führte, daß sich die Spaltung der politischen Klasse in Populare und Optimaten verstärkte9.
Schwere Erschütterungen der Herrschaftsstruktur brachte der Kampf um die Ausdeh nung des römischen Bürgerrechts auf die Bundesgenossen. Die Nobilität versuchte mit allen Mitteln10, die Aufnahme der italischen Bundesgenossen in das römische Bürgerrecht zu verhindern, wohl weil sie starke Verschiebungen in der Clientelstruktur befürch tete11. Auch Sullas Bürgerkrieg und die Proskriptionen brachten dem Senat und der Nobilität insgesamt einen enormen Verlust an biologischer und moralischer Substanz. Besonders in diesen Auseinandersetzungen vertiefte sich der Graben zwischen Popula ren und Senatspartei.
2.1.4. Krise ohne Alternative
Christian Meier hat auf eine Besonderheit der römischen Gesellschaft hingewiesen, die in der Krise zu einer eigentümlichen Alternativlosigkeit geführt habe12.
Er erkennt in den Reaktionen auf Krisenerscheinungen eine besonders starke Wirklichkeitsverhaftung der Römer, die zur Folge hatte, daß Alternativen zur bestehen den Ordnung nicht gedacht wurden, daß eine andere, als die überkommene Ordnung außerhalb des Vorstellungsbereiches lag.
Die Behebung der Krise, die von den Römern seit den 80er Jahren als nachlassende Wirklichkeitsentsprechung und Verbindlichkeit des mos maiorum, in dem die römische Verfassung gewissermaßen als Normenkomplex komprimiert war, wahrgenommen wur de, sei ihnen nur in umso genauerer Befolgung des mos maiorum vorstellbar gewesen. Dies habe für alle Römer gegolten, auch für die "großen Einzelnen", die mit dem Senat als dem Verteidiger der überkommenen Ordnung aufgrund ihrer herausragenden Stel lung in Konflikt gerieten. Auch die alleinige Verantwortlichkeit des Senates für die Ord nung sei nicht prinzipiell in Frage gestellt worden13. Das Bestreben, die offensichtliche Diskrepanz zwischen Norm und Wirklichkeit zu beseitigen, habe deswegen zu einer "Verengung der Norm"14 geführt, so daß der Senat umso aufmerksamer darauf achtete, daß keiner die
oligarchische Gleichheit störe. Die Folge war Mittelmäßigkeit bis hin zur Einschränkung der Funktionstüchtigkeit des Senates, weil man - paradox, aber system immanent - herausragende Männer um so mehr bekämpfte, als man ihrer bedurft hätte, um die Probleme zu lösen. Der Senat zwang jene gleichsam gegen ihn zu kämpfen. Jeder Versuch zu reformieren, was eigentlich nur `restaurieren' bedeutet hätte, verstärk te nur das Problem15.
2.2. Politische Situation um 60 v.Chr.
2.2.1. Rückkehr des Pompeius und Senatsopposition
Mit der Rückkehr des Pompeius im Jahre 62 wurde der oben beschriebene Komplex latenter Probleme erneut akut. Pompeius war nach den Imperien gegen die Seeräuber und den Mithridates auf dem Höhepunkt seines Einflusses angelangt. Er war Patron eines riesigen, ihm ergebenen Heeres und der von ihm neueingerichteten Ostprovinzen. Um die Erfolge seiner Imperien in adäquaten innenpolitischen Einfluß umzusetzen, muß te Pompeius die Ratifizierung seiner Anordnungen in Asia und die Versorgung seiner Veteranen durchsetzen. Doch in Pompeius sah man damals den "größten und gefähr lichsten Gegner des Senatsregimes"16, und so stand er gegen die führenden Kreise des Senates, die sich schon in der Beratung über die Catilinarier am 5.12.63 gegen die An hänger des Pompeius - die ihn mit seinem Heer zur Bekämpfung der Verschwörung nach Rom hatten rufen wollen - durchgesetzt hatten und eine Machtposition besaßen wie seit den 80er Jahren nicht mehr17. Mit dem heftigen - und zunächst erfolgreichen - Widerstand gegen Pompeius kam im Senat zunehmend eine neue Generation zum Zuge, deren bedeutendster Exponent der Tribunicier(!) Cato gewesen ist. Ihr Ziel war, "kräftige, entschiedene, verantwortungs bewußte senatorische Politik zu betreiben"18, ihr Maßstab der mos maiorum - oder das, was man sich darunter vorstellte - und die überkommene Ordnung. Cato und seine Mit streiter verteidigten das Senatsregime mit krampfhafter Obstruktion und das bedeutet auch oft genug ohne diplomatisches Gespür und gegen die Regeln politischer Klugheit19.
2.2.2. Triumvirat
Aufgrund des energischen Widerstandes des Senates befand sich Pompeius im Jahre 60 in einer Situation, in der er die Unterstützung eines tatkräftigen und durchsetzungs fähigen Mannes in einem hohen Amt benötigte, wenn er seine Forderungen in absehba rer Zeit erfüllt sehen wollte. Der nach seiner Proprätur das Konsulat für 59 anstrebende Caesar bot sich dazu an, wie kaum ein anderer.
Cato und die Optimaten versuchten jedoch mit allen Mitteln, diesen vom Konsulat fernzuhalten. Mit einer Dauerrede hatte Cato bereits die Bewerbung Caesars in dessen Abwesenheit verhindert und ihn so gezwungen, auf seinen Triumph zu verzichten. Außerdem hatte der Senat auf Catos Initiative silvae callesque als prokonsularischen Aufgabenbereich der Konsuln von 59 festgelegt20.
Auch Caesar bedurfte also der Unterstützung und konnte hoffen, seine Wahlchancen durch die Unterstützung des Pompeius zu vergrößern und mit dessen Hilfe das erstrebte Imperium in einer bedeutenden Provinz zu erlangen21.
Auf Initiative Caesars kam es - nachdem auf sein Betreiben noch Crassus hinzugezogen worden war - so zum sogenannten ersten Triumvirat. Trotz der Folgen, die es im folgen den Jahrzehnt zeigen sollte, weisen die bereits angedeuteten Motivationen und zunächst recht begrenzte Ziele auf einen eher taktischen Charakter des Bündnisses hin22. Wie sich das Verhältnis der Partner zueinander entwickelte, wird im folgenden Abschnitt darzulegen sein. Als sich zeigte, daß Caesar mit aller Macht zum Konsulat strebte, unterstützten die Opti maten mit umso größerem Aufwand den Bibulus - selbst Cato stimmte der Sammlung von Bestechungsgeldern zu - um Caesar wenigstens einen der Ihren an die Seite stellen zu können. igitur cum Bibulo consul creatur 23.
3. Politik und Obstruktion in Caesars Konsulat
Caesar begann ohne Umschweife mit der Umsetzung des Programms der Triumvirn. Was er begann, war erwartet worden24. Wie er es begann überraschte allerdings und erregte Unbeholfenheit. Tiefen Respekt für Senat und Sitten bekundend legte er den patres conscripti den Entwurf eines Ackergesetzes vor, mittels dessen die Veteranen des Pompeius und die bedürftige Stadtbevölkerung Land erhalten sollten, der aber ent gegen früheren Initiativen auch allen potentiellen Einwänden der Optimaten (außer dem prinzipiellen; s.o. 2.1.) Rechnung trug25. Er forderte die Senatoren auf, vorzutragen, was ihnen mißfalle. Er werde jeden Einwand berücksichtigen und die betreffende "Stelle abändern oder auch ganz streichen"26. Sachlich hatten die Senatoren nichts einzuwenden, wollten sich jedoch auch nicht für das Gesetz aussprechen, weil sie, wie Cassius Dio berichtet, befürchteten, "daß er durch diese Maßnahme das Volk für sich gewinnen und Ruhm und Macht über alle Menschen erringen werde"27. Cato sagte schließlich, es dürfe nichts geändert werden und setzte zu einer Dauerrede an. Die Senatssitzung en dete im Tumult, als Caesar Cato verhaften ließ, jenem jedoch der Großteil des Senats ins Gefängnis folgen wollte. Caesar ließ Cato daraufhin wieder frei und beendete die Sitzung, indem er den Senatoren vorwarf, ihn durch ihre Härte wider seinen Willen hin zum Volk zu treiben, so daß er sich nun an jenes wenden müsse28.
Der Versuch, sich gütlich und gemäß der Ordnung mit den Optimaten auf ein notwendi ges Vorhaben zu einigen, war damit gescheitert. Caesar sah sich einer unnachgiebigen Senatsmehrheit gegenüber, mit der offensichtlich kein Kompromiß möglich war. Wenn er nicht auf sein ehrgeiziges Programm verzichten wollte, mußte er sich gegen den Senat durchsetzen29.
Plutarch behauptet (Caes.14, siehe Anm.30), Caesar habe nur einen Vorwand gesucht, um sich an das Volk wenden zu können. Es deutet allerdings vieles darauf hin, daß Caesar ernsthaft versucht hat, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Ende 60 wollteer Cicero für seine Unternehmungen zu gewinnen30. Pompeius gegenüber mag er in der Pflicht gestanden haben, nichts unversucht zu lassen, um das gemeinsame Programm im Konsens durchzubringen31. Plutarchs Behauptung setzt außerdem voraus, daß Caesar sicher davon ausgehen konnte, daß der Senat seinen Entwurf eines Ackergesetzes nicht beraten würde. Aber gerade sein weites Entgegenkommen gab auch dem Senat die Möglichkeit, sich zu bewegen, verkörperte damit den Willen und die Chance zum Konsens und war wohl auch nicht ganz wirkungslos: Daß Cato schließlich so massiv intervenierte, kann bedeuten, daß nicht sicher schien, daß der Entwurf abgelehnt würde32.
Nachdem Cato den Weg der Diplomatie abgeschnitten hatte, war der Weg zum Volk33, die populare Methode, tatsächlich erzwungen. Caesar muß das nicht bedauert haben -gerade hier, in der Auseinandersetzung mit und vor allem im Sieg über den Senat, lag für ihn die Chance, eine ähnliche Stellung zu erringen, wie sie Pompeius innehatte. So ernsthaft der Versuch gewesen war, den Konsens herzustellen, so nützlich war er nun nach seinem Scheitern. Nur, daß Caesar Kompromiß und Konsens ernsthaft gesucht hatte und daß es ihm dadurch gelungen war, Starrköpfigkeit und Uneinsichtigkeit der Optimaten gegen ein sachlich berechtigtes und einwandfreies Gesetz zu demonstrieren, konnte geeignet sein, sein weiteres Vorgehen zu legitimieren34.
Caesar brachte die lex agraria vor die Volksversammlung. In den contiones gelang es ihm erneut, die Fundamentalopposition der Senatspartei zu verdeutlichen. Caesar befragte auch seinen Kollegen Bibulus nach Einwänden, worauf dieser der Masse nur versichern konnte, sie würde das Gesetz in diesem Jahr nicht bekommen. Crassus und Pompeius dagegen bekräftigten Caesar vor dem Volk ihres Beistandes, wobei Pompeius den Gegnern sogar mit Gewaltanwendung drohte35.
Um die Abstimmung zu verhindern, beobachtete Bibulus nun täglich den Himmel und erklärte später kurzerhand alle übrigen Comitialtage zu Festtagen, an denen keineVolksversammlungen stattfinden durften. Caesar jedoch kümmerte sich nicht darum und legte den Tag für die Abstimmung fest. Als Bibulus auf diesen abstimmenden Comitien intercedieren wollte, wurde er mit Mist überschüttet und mit seinen Anhängern vom Fo rum gejagt. Die Erregung der Masse schüchterte die Optimaten offenbar derart ein, daß sie es nicht wagten, den am nächsten Tag im Senat über die Vorgänge berichtenden Bibulus mit einem Notstandsbeschluß zur Bekämpfung Caesars auszustatten. Daraufhin zog sich Bibulus für den Rest des Amtsjahres in sein Haus zurück und obnuntiierte, sobald Caesar etwas unternahm, wodurch alle dessen Akte formal rechtsungültig wur den36. Auch die meisten Senatoren blieben von nun an den Senatssitzungen fern37.
Bis zur Gesetzgebungspause im April(4.-24.) setzte Caesar nun mit dem Druckmittel der Veteranen des Pompeius und gewisser gewaltbereiter Teile der plebs urbana in der Volksversammlung die wichtigsten Vorhaben der Triumvirn durch, ohne sich weiter um die Obstruktionsversuche der Optimaten zu kümmern. Die noch ein Jahr vorher durch Cato verhinderte nachträgliche Senkung der Steuerpacht für die publicani der Provinz Asia, die das wesentliche Anliegen des Crassus und der Ritter war, aber wohl auch Caesar selbst zugute kam, wurde im concilium plebis durchgesetzt. Auch die acta des Pompeius in Asia wurden ratifiziert. Die Senatoren zwang Caesar zum Eid auf das Agrargesetz38.
Ebenso ist wohl die lex Vatinia de imperio Caesaris, durch die Caesar die Gallia Cisalpina und Illyricum mit 3 Legionen auf 5 Jahre verliehen wurden, in diese Zeit zu datieren39. Nachdem er die Wünsche seiner Partner im Triumvirat erfüllt hatte, wurde damit auch Caesars wichtigstes Anliegen umgesetzt. Nur ein Imperium solcher Dauer bot ihm die nötige Sicherheit vor Verfolgung, die er, nachdem er sich durch seinen Verfassungs brüchen verhaßt gemacht hatte, brauchte, nur eines in einer Provinz, in der die Möglich keit militärischer Erfolge vorhanden war(Illyrien), eröffnete die Chance, sich neue Clien telen zu schaffen sowie Macht und Ansehen zu sammeln40.
Caesar hatte die wesentlichsten Vorhaben der Triumvirn gegen den Senat durchgesetzt. Aber hatte der Senat verloren? Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die römischen Ver hältnisse, wenn er mit seiner Niederlage werben und die Stimmung zu seinen Gunsten beeinflussen konnte. Die massive Anwendung der Obnuntiation und anderer Mittel zur Obstruktion, die aus heutiger Sicht grotesk erscheinen mag und auch dem konsens stiftenden Sinn solcher Verfassungsinstrumente widersprach, führte nicht zu deren Abschwächung oder zum Funktionsverlust41. Im Gegenteil: die permanente Verletzung der durch das Herkommen geheiligten Institutionen der römischen Verfassung durch Caesar weckte "unheimliche Gefühle" und war ganz offensichtlich geeignet, nicht nur die boni gegen ihn aufzubringen42. Auch die rechtliche Relevanz der Verfassungsbrüche, d.h. die formale Rechtsungültigkeit der cäsarischen Gesetzgebung und deren Bedro hung durch Kassation sowie Caesars Bedrohung durch mögliche Verfahren gegen ihn nach Ablauf des Amtsjahres, stand nicht in Frage43.
So konnte der "Boykott der Politik"44 durch die Optimaten Früchte tragen. Man trieb nun keine Politik mehr, setzte sich nicht offen zur Wehr, sondern agitierte mit Erfolg gegen die "hochmütigen Könige"45. Der in seinem Haus verschanzte Bibulus gab Edikte und Flugblätter heraus, die Caesar öffentlich bloßstellten und anprangerten46. Und die Voraussetzungen waren nicht ungünstig, Cicero sah es so: non enim poterimus ulla esse invidia spoliati opibus et illa senatoria potentia 47.
Hatte Caesars Erfolg nun vor allem auf der Macht und dem Einfluß des Pompeius be ruht, der seine Veteranen in die Volksversammlungen entsandt hatte und öffentlich für Caesar aufgetreten war48, so mußte dieser Erfolg in dem Maße in Gefahr geraten, in dem es den Optimaten gelang, die öffentliche Meinung zu dominieren. Denn Caesars Vorgehen - so angemessen es rein sachlich sein mochte - widersprach so offensichtlich und grob der überkommenen Ordnung, daß Pompeius, der erkennen mußte, daß sein Ansehen rapide dahinschwand, zunehmend unter Druck geriet, sich von Caesar zudistanzieren49.
Doch gelang es Caesar im April das Bündnis wieder zu festigen. Wie ihm das gelang, ist nicht ganz klar zu sehen, der einzige direkte Hinweis in den Quellen ist der darauf, daß Caesar dem Pompeius seine einzige Tochter Julia zur Frau gab50. Daß diese mit einem engem Gefolgsmann Caesars, dem Quintus Servilius Caepio verlobt war und kurz vor der Hochzeit stand, kann darauf hindeuten, daß Caesar tatsächlich in großer Bedrängnis war. Auch Gelzer und Meier verweisen intensiv auf diese Heirat als wesentliches In strument der Bindung51, doch wird Caesar wohl auch politisch argumentiert haben. So weist Christian Meier auch darauf hin, daß eine Verständigung zwischen den Optimaten und Pompeius nur noch schwer möglich gewesen wäre, da es erklärtes Ziel der Opposi tion war, alle Maßnahmen Caesars wieder rückgängig zu machen52. Nicht nur Caesars größte Sorge mußte also der Sicherung des Erreichten bis zum Ende seines Konsulats und darüber hinaus gelten. Auch Pompeius mußte klar werden, daß mit Caesar auch die von diesem zu Pompeius' Gunsten durchgesetzten Maßnahmen standen und fielen.
Erst, daß Caesar den Pompeius in dieser kritischsten Phase seines Konsulates an sich zu binden vermochte, ermöglichte den endgültigen Sieg über die Senatspartei. Erst hier erlangte der der Dreibund, der mehr und mehr zum Zweibund wurde53, seine eigentliche Tragweite. Daß jetzt auch Pompeius es wagte, sich offen gegen die Ordnung zu stellen und mit Caesars Unterstützung offen um noch mehr Macht, wenn nicht gar die Allein herrschaft zu kämpfen, daß gerade in dieser entscheidenen Situation die Integrations kraft der römischen Ordnung zu schwach war, bedeutete die vielleicht entscheidendste Niederlage des Senates und der römischen Republik54.
Der als radikal empfundene Kurswechsel des Pompeius und die Absprachen des April wurden offenbar, als kurz vor dem 1.Mai 59 (der nach Cic.Att. 2,16 den terminus ante quem bildet) die Verschwägerung der beiden Triumvirn und eine geplante lex Iulia deagro Campano bekannt wurden55. Die Überraschung und das Entsetzen der Optimaten über das erneuerte Einvernehmen und die neuen Unternehmungen waren groß, Cicero sah die Zukunft in düsteren Farben: ea natura rei est, ut haec extrema esse non possint 56. Er hatte seinen Freund Atticus schon einige Tage vorher darauf hingewiesen, daß es nicht allein um Ansiedlung gehen könne, da der Ager Campanus nur 5000 Siedler fasse. Zwar war die Einbeziehung zusätzlichen Landes in die Verteilung offenbar not wendig, die bisher dafür zur Verfügung stehende Fläche reichte nicht aus. Die lex Campana war aber auch Machtdemonstration und Provokation und brach gewissermaßen ein Tabu. Gerade die Verteilung der kampanischen Staatsdomäne hatte Symbol charakter, da sie ein altes populares Projekt realisierte, das bis dahin immer am heftig sten Widerstand der Optimaten gescheitert war. Viele Senatoren hatten Anteile am ager Campanus, die Pachtzinsen waren neben der Freilassungssteuer die einzige direkte Einnahmequelle des Staates57.
Außer der lex Campana war offensichtlich auch abgesprochen worden, daß Caesar zu den bisher erhaltenen Provinzen auch die Gallia Transalpina mit einer weiteren Legion zugewiesen werden sollte. Diese Übertragung erfolgte bis spätestens Anfang Juli auf Antrag des Pompeius durch den (Rest-)Senat, der vermutlich verhindern wollte, daß Caesar auch dieses Imperium durch die Volksversammlung erhielt58. Die von den Helvetiern bedrohte Gallia Transalpina konnte Caesar noch bessere Möglichkeiten militäri scher Erfolge bieten als Illyricum, und war "frei" geworden, nachdem im April der bisheri ge Imperator dieser Provinz, Quintus Caecilius Metellus Celer, gestorben war59 Vorrangig zur Sicherung des Erreichten war für Caesar und Pompeius nun, für das nächste Jahr Männer an die Spitze der res publica - ins Konsulat - zu bringen, die die zu erwartenden heftigen Angriffe der Gegner Caesars abfangen konnten. Die Kandidaten der Triumvirn waren Aulus Gabinius und Calpurnius Piso, dessen Tochter Caesar imApril zur Frau genommen hatte60.
Inzwischen wendete sich die Stimmung in Rom immer mehr gegen die Machthaber. Cicero berichtet Mitte Juli: populare nunc nihil tam est quam odium popularium61. Nach wie vor verfehlte die Taktik der Optimaten ihre Wirkung nicht. Die Pamphlete des Bibu lus wurden gelesen und verbreitet. Der Stimmungsumschwung der breiten Masse wurde während der im Juli stattfindenden Spiele deutlich. Auch Pompeius begann unter dem Druck der öffentlichen Meinung wieder zu wanken.
In dieser Situation verlegte Bibulus die Konsulwahlen für 58 auf den 18.Oktober, wohl hoffend, dadurch die Chancen der optimatischen Kandidaten zu verbessern62. Wie teifgreifend der Stimmungswandel auch beim Volk war, wird daran deutlich, daß es Caesar nicht gelang, die plebs, die - wie Cicero berichtet - über Wahlverlegungen gewöhnlich nicht erfreut war, zu Aktionen gegen Bibulus zu bewegen63.
Obwohl Caesars Lage, was das betrifft, kritisch blieb64, behielt er die Machtmittel doch soweit in der Hand, daß es ihm gelang, seine Kandidaten bei den Konsulwahlen im Oktober durchzubringen. Caesar konnte am Ende seines Konsulats also zuversichtlich hoffen, Sieger zu bleiben.
4. Fazit
"Dieses Consulatsjahr würde in der römischen Geschichte einen Markstein bilden, auch wenn es nicht die Vorbedingungen geschaffen hätte, für Caesars Aufstieg zur Alleinherr schaft"65. Dieses Fazit Matthias Gelzers gilt: Das Jahr 59 v.Chr. brachte eine entscheidende Niederlage des Senates. Caesar hatte als Konsul widerrechtlich, ohne davon abgehalten werden zu können, ein ums andere Gesetz gegen den Willen des Senates, der doch eigentlich Träger der Ordnung sein sollte, durchgebracht. Die eigentliche Nie derlage lag jedoch darin, daß es nach Caesars Konsulat nicht gelang, seine Maßnah men zu annullieren. Bisher war jeder, der sich gegen die Senatsherrschaft gestellt hatte, mochte er auch anfangs erfolgreich gewesen sein, letztlich dafür bestraft worden. Gera de jetzt jedoch, trotz dieser massiven Verfassungsbrüche, trotz Mißachtung aller Ob struktionsmittel, gelang es dem dafür Verantwortlichen nicht nur, ungestraft zu bleiben, sondern auch noch mit einem umfangreichen Imperium ausgestattet nach Gallien ab zugehen.
"Damit war die Grundlage der senatorischen Autorität aufs tiefste getroffen"66. Und indem so die - zumindest potentielle - Machtlosigkeit des Senates demonstriert und da durch die Basis der römischen Ordnung schwer erschüttert worden war, wurden des integrative Tendenzen in der römischen Gesellschaft enorm verstärkt. Im Jahre 59 be ginnen die Prozesse, die konkret zum Zerfall der res publica, wie sie z.B. Cicero verstand, führen sollten.
Das Paradoxeste daran aber war, daß die Optimaten diese Niederlage durch die Kom promißlosigkeit ihres Widerstandes gleichsam mitverschuldet hatten. Indem der Senat als Organ der römischen Aristokratie nach seinem Selbstverständnis alles tun mußte, um die Auflösung der oligarchischen Gleichheit zu verhindern, die ja die Grundlage der Ordnung war, leistete er einen wesentlichen Beitrag zur eigenen Entmachtung und zum Untergang der res publica.
zeitgenössische Quellen:
Cicero, ad Atticum, 2,1-2,25
antike Historiographie:
Cassius Dio, Römische Geschichte, Buch 38 (herausgegeben und übersetzt von Otto Veh, Zürich & München 1985)
Plutarch, Von großen Griechen und Römern (herausgegeben von Manfred Fuhrmann, übersetzt von Walter Wehrmann und Konrat Ziegler, München 1991)
Sueton, Divus Julius
Literatur:
Bleicken, Jochen, Die Geschichte der römischen Republik (Oldenburg Grundriß der Geschichte, Band 2), 3., überarbeitete Auflage, München 1988
Bleicken, Jochen, Die Verfassung der römischen Republik, Paderborn 1993 (6. Auflage) Christ, Karl, Caesar. Annäherungen an einen Diktator, München 1994
Gelzer, Matthias, Caesar, der Politiker und Staatsmann, 6., neubearbeitete Auflage, Wiesbaden 1960
Gelzer, Matthias, Die lex Vatinia de imperio Caesaris, in: Hermes 63 (1928), 113-137 (sowie in: Ders., Kleine Schriften, Band II, Wiesbaden 1963, 206-228)
Gesche, Helga, Caesar (Erträge der Forschung; Band 51), Darmstadt 1976 de Libero, Loretana, Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksver sammlung der ausgehenden römischen Repblik (70-49 v.Chr.) (Hermes: EinzelschriftenHeft 59; Diss. Göttingen 1991), Stuttgart 1992
Meier, Christian, Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik, 3., veränderte Auflage, Frankfurt/Main 1997
Meier, Christian, Zur Chronologie und Politik in Caesars erstem Konsulat, in: Historia 10 (1961), 68-98
Meier, Christian, Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar, München 1978 Meier, Christian, Caesar, Berlin 1983
Strasburger, Hermann, Caesars Eintritt in die Geschichte, München 1938 Will, Wolfgang, Julius Caesar. Eine Bilanz, Stuttgart - Berlin - Köln 1992
[...]
1 Stellvertretend für viele: M. Gelzer, Caesar, der Politiker und Staatsmann, Wiesbaden 1960, S. 90f.; Chr.Meier, Caesar, Berlin 1982, S.276
2 J.Bleicken, Die Geschichte der römischen Republik (Oldenburg Grundriß der Geschichte Band 2), 3., überarbeitete Auflage, München 1988, S.196-199
3 Jochen Bleicken, Die Verfassung der römischen Republik, Paderborn 1993, S.46
4 Chr.Meier, Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der römischen Republik, Frankfurt/Main 1997 S.46, "... in der Leistung für das Gemeinwesen gipfelte der Tugendkanon des römischen Adels"; Vgl. auch: Derselbe, Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar, München 1978, S.30
5 Chr.Meier, Ohnmacht, S.46ff.
6 Die Clientel war zunächst vor allem eine Familienclientel, auf die das einzelne Familienmitglied zurückgreifen konnte. Bleicken, Verfassung, S.31
7 Ebenda S.38
8 Ebenda S.33ff., Vgl. auch K.Christ, Cäsar. Annäherungen an einen Diktator, München 1994, S.19f.
9 Bleicken, OGG, S.70
10 Ermordung des Livius Drusus 91 v.Chr.
11 Bleicken, Verfassung, S.36f. und 209; OGG, S.70f.
12 Chr.Meier, Die Ohnmacht des allmächtigen Dictators Caesar, München 1978, hier S.29-40
13 Ebd. S.36; Mit Abstrichen bei Caesar, der nach Meier dieser römischen Wirklichkeitsverhaftung nicht so stark unterworfen gewesen sei und "seit 59 den Widerspruch zu Senat und res publica bewußt riskiert" hat. (S.40)
14 Ebd. S.31
15 Chr.Meier, Ohnmacht, S.29-41
16 Chr.Meier, Res publica amissa, S.279
17 Chr.Meier, Res publica amissa, S.271
18 Ebenda, S.276
19 Ebd. S.276ff.
20 Triumph: Plutarch Caes.13 , etwas ungenau Cassius Dio 37,54,1-2; silvae callesque: Sueton Jul.19
21 Zu Caesars Interessen im Triumvirat siehe: größere Chance der Wahl: Gesche, Caesar. Erträge der Forschung, Darmstadt 1968, 42; zum Imperium: Meier, Res publica amissa, 278, dort auch Anm. 70
22 Zur Frage von Charakter und Motivation vgl. auch Gesche, Caesar, 41ff.; Zum Inhalt: Sueton Jul. 19 ne quid ageretur in re publica, quod displicuisset ulli e tribus; Cic. Att. 2,3,3 deutet darauf hin, daß Crassus dem Bündnis zwischen Caesar und Pompeius erst Ende 60 oder Anfang 59 hinzugezogen wurde; So z.B. Gelzer, Caesar, S.62. Auch das Bündnis zwischen Caesar und Pompeius wird von Sueton Jul. 19 erst nach der Wahl berichtet, bei Plutarch Caes.13 davor. Cassius Dio 37.54,3-4.55-57 ist nicht ganz eindeutig: Caesars Wahl sei durch Pompeius und Crassus begünstigt worden. Die Versöhnung und der Abschluß eines regelrechten Abkommens werden allerdings erst nach der Wahl berichtet. Diese Datierung ist besonders hinsichtlich der Motivation Caesars von Bedeutung. Datiert man den Abschluß nach die Wahl, müßte man bei ihm langfristigere Ziele und stärker strategische Überlegungen vermuten. Vgl. auch hier Gesche a.a.O.
23 Sueton Jul.19
24 Cic.Att. 2,3,3,
25 Einzelheiten des Gesetzes berichtet Cassius Dio in 38,1,4-7, dessen Notwendigkeit in 38,1,3, die Absicht im Konsens mit den Optimaten zu handeln in 38,1,1-2; zum demonstrativen Respekt den alten Sitten gegenüber siehe auch Sueton Jul.20: Antiquum etiam retulit morem, ut quo mense fasces non haberet, accensus ante eum iret, lictores pone sequerentur.
26 Cassius Dio 38,2,1 in Übersetzung von Otto Veh
27 Cassius Dio 38,2,3 (Übersetzung Otto Veh), Vgl. auch Gelzer, Caesar, S.65
28 Zur Dauerrede vgl. Loretana de Libero, Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden römischen Republik (70-49 v.Chr.), S.19f.; Verhaftung Catos bei Cassius Dio 39,3,2; Caesars Äußerungen zur Beendigung der Sitzung Cassius Dio 38,3,3, bei Plutarch Caes.14 mit der Anmerkung, Caesar habe schon längst einen Vorwand gesucht.
29 Chr.Meier, Res publica amissa, S.284
30 Cic.Att. 2,3,3
31 Chr. Meier, Caesar, 260
32 Vgl. Chr.Meier, Caesar, 259f. Bereits 60 hatte Cato die Steuerpachtsenkung, nachdem die Stimmung dafür zunächst günstig schien, durch Dauerreden quasi im Alleingang verhindert. Dazu de Libero, Obstruktion, S.16f. und Meier, Res publica amissa, S.276 unter Bezug auf Cic.Att. 1,18,7 und 2,1,8
33 Das bedeutet hier vor allem: zu den Veteranen des Pompeius, die die Volksversammlungen dominierten. Plut.Pomp. 48
34 Vgl. Chr.Meier, Caesar, S.260f.; Zum Legalitätswillen: Ders., Res publica amissa, S.284
35 Cassius Dio 38,4,3; Diese offene Drohung des Pompeius mag, gerade im Hinblick auf dessen späteres Wanken, dafür sprechen, daß die Reaktion der Optimaten auf Caesars Angebote anfänglich tatsächlich legitimierend für Caesar gewirkt hat. Meier interpretiert großen Einfluß Caesars auf den bis dahin maßvoll agierenden Pompeius.(Chr.Meier, Zur Chronologie und Politik in Caesars erstem Konsulat, in: Historia 10(1961) 68-98, S.86)
36 Cassius Dio 38,6, Sueton Jul.20
37 Plut. Caes. 14; Vgl. de Libero, Obstruktion, S.73
38 Cassius Dio 38,7,1-6; Zur Datierung Vgl. Meier, Gesche
39 Die Frage der Datierung dieses Gesetzes ist recht umstritten gewesen (Vgl. Gesche, Caesar, S.47ff.), wobei mir die Datierung Christian Meiers, Chronologie, S.69-88, am fundiertesten und in der Berücksichtigung des politischen Hintergrundes am umfassendsten zu sein scheint. Meiers Datierung beruht neben einer Neubewertung der Sekundärquellen vor allem auf einer plausiblen Neuinterpretation des "exercitus Caesaris" aus Cic.Att. 2,16,2, die in eine umfassende Analyse der politischen Situation der ersten Hälfte des Jahres 59 mündet. Aufgrund der so rekonstruierten politischen Realität sei die lex Vatinia de imperio Caesaris nur in der Zeit bis 4. April mit dem Kanon caesarischer Gesetzgebung konsistent denkbar. Dieser Interpretation folgen die meisten Darstellungen neueren Datums (u.a. de Libero, Obstruktion, S.107, Anm.1) und auch diese Arbeit.
40 Meier, Chronologie, S.85
41 de Libero, Obstruktion, S.105
42 Zitat bei Gelzer, Caesar, S.71, siehe dazu auch Cic.Att. 2,13,2
43 de Libero, Obstruktion, 65, 68
44 Chr.Meier, Caesar, S.260
45 aus Cic.Att. 2,8,1, Cicero berichtet über Curio ipse vero mirandum in modum "reges odisse superbos"
46 Vgl. auch Chr.Meier, Caesar, S.264f.
47 Cic.Att. 2,9,1. Diese Äußerung ist sehr bezeichnend für die tiefe Verankerung der Ordnung im Bewußtsein der Römer, auch dafür, wie überzeugt von deren Legitimität man gewesen ist. (Wobei die Deutung auch von der Übersetzung von invidia abhängig ist.)
48 Plut.Pomp. 48; Vgl. auch Chr.Meier, Res publica amissa, S.284; Ders., Chronologie, S.82
49 Cic.Att. 2,14,1.16,2, dort u.a.: Pompeius habe gesagt se leges Caesaris probare, actiones ipsum praestare debere; Auch Pompeius war ja trotz der Gegnerschaft des Senates von der prinzipiellen Legitimität der Ordnung überzeugt, sichtlich unwohl war ihm dementsprechend bei Caesars Aktionen.; Vgl. auch Chr.Meier, Res publica amissa, S.284; Ders., Chronologie, S.70; Gelzer, Caesar, S.72
50 Sueton Jul. 21
51 M.Gelzer, Caesar, S.72 spricht vom "stärksten Mittel, ihn (Pompeius) zu fesseln";
Chr.Meier, Res publica amissa, S.284
52 Chr.Meier, Caesar, S.269; Ders., Res publica amissa, S.285
53 Die Verbindung mit Crassus wurde - vorerst - immer schwächer, Chr.Meier, Caesar, S.270
54 Alleinherrschaft: Cic.Att. 2,17,1; In diesem Zusammenhang bestätigt sich die bei Plutarch Caes.13 überlieferte Aussage Catos, nicht die Feindschaft, sondern die Freundschaft zwischen Caesar und Pompeius habe zum Untergang der res publica geführt.
55 Cic.Att. 2,17,1; Vgl. Chr. Meier, Chronologie, S.71; Ders., Res publica amissa, S.285; Zum Kurswechsel des Pompeius weiterhin: Cic.Att. 2,19,2 und 3
56 Cic.Att.2,17,1
57 Nur 5000 Siedler: Cic.Att. 2,16,1; Notwendigkeit zusätzlichen Landes: Cic.Att. 2,15,1; Einnahmequelle: Cic.Att. 2,16,1; in den Kontext von Machtdemonstration und Provokation gehört auch die nach der Entscheidung über die Transalpina im Senat gefallene Äußerung Caesars: invitis et gementibus adversaris adeptum se quae concupisset, proinde ex eo insultaturum omnium capitibus. (Sueton Jul.22)
58 Sueton, Jul.22; Antrag des Pompeius: naheliegend, weil dieser seit April von Caesar als Erster im Senat aufgerufen wurde (Sueton Jul.21), Vgl. dazu Meier, Chronologie, S.74, Anm.23. Zur Datierung: Ebd., S.75f.; Der Zusammenhang dieses Aktes mit der Verheiratung der Julia und damit mit den Absprachen des April wird nahegelegt durch Catos Beschwerde über den Handel mit Weibern, Ämtern und Provinzen, der bei Plutarch Caes.14 überliefert ist.
59 Daß zuvor wohl auch Illyricum aus jenem Grunde ausgewählt worden war spricht dafür, daß diese zweite Provinzregelung in eine andere "Planungsperiode" zu zählen ist und somit für eine Datierung der lex Vatinia vor den 4.April. Vgl. Meier, Chronologie S.87f., dort auch Anm.71
60 Sueton Jul.21
61 Cic.Att. 2,20,4
62 Stimmungsumschwung: Cic.Att. 2,18,1-2.19,3.21,1.22,6 und öfter; Pamphlete des Bibulus: Cic.Att. 2,20,4; Wanken des Pompeius: Cic.Att. 2,21,3.22,6.23,2; Verlegung der Wahlen: Cic.Att. 2,20,6
63 Cic.Att. 2,22,5
64 Darauf deutet die Vettiusaffärevom August hin, die sicherlich dazu dienen sollte, die Stimmung zu beeinflussen und Pompeius wiederum fester zu binden. Vgl. Cic.Att.2.24, zu Bedeutung und Datierung: Chr.Meier, Chronologie, S.88-96
65 Gelzer, Caesar, S.90
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es handelt sich um OCR-Daten, die ausschließlich für akademische Zwecke zur Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise bestimmt sind.
Was ist das Hauptthema des Textes?
Das Hauptthema des Textes ist Caesars Konsulat im Jahr 59 v.Chr. und dessen Bedeutung im Kontext der Krise der Römischen Republik.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Zu den wichtigsten Quellen gehören Ciceros Reden, Briefe und Abhandlungen, Sallusts de Catilinae coniuratione, Caesars Schriften de bello civile, Plutarchs Biographien, Suetons Cäsar-Vita und Appians Bürgerkriege.
Was waren die Hauptursachen für die Krise der Republik?
Die Hauptursachen für die Krise der Republik waren die mangelnde Anpassungsfähigkeit der römischen Verfassung, die veränderte Klientelstruktur (insbesondere die Militarisierung der Klientel) und der Konflikt zwischen dem Gleichheitsideal und dem Leistungsprinzip in der Nobilität.
Was war das Triumvirat und wer waren seine Mitglieder?
Das Triumvirat war ein Bündnis zwischen Caesar, Pompeius und Crassus, das gebildet wurde, um ihre jeweiligen politischen Ziele zu erreichen. Es entstand aufgrund des Widerstands des Senats gegen Pompeius und Caesars Bedürfnis nach Unterstützung.
Welche Rolle spielte Cato in der Politik der Zeit?
Cato war ein wichtiger Exponent einer neuen Generation im Senat, die das Senatsregime mit krampfhafter Obstruktion verteidigte und sich am mos maiorum orientierte.
Wie hat Caesar seine Ziele als Konsul erreicht?
Caesar setzte seine Ziele als Konsul durch, indem er zunächst versuchte, eine einvernehmliche Lösung mit dem Senat zu finden. Als dies scheiterte, aktivierte er mit Hilfe der Volkstribunen die Volksversammlung und setzte seine Vorhaben gegen den Willen des Senats durch.
Was war die Bedeutung des Ackergesetzes (lex agraria)?
Das Ackergesetz diente dazu, die Veteranen des Pompeius und die bedürftige Stadtbevölkerung mit Land zu versorgen. Caesars Vorschlag löste heftige Auseinandersetzungen aus, da der Senat befürchtete, dass Caesar dadurch zu viel Macht gewinnen würde.
Was war die Rolle von Bibulus während Caesars Konsulat?
Bibulus war Caesars Mitkonsul, der versuchte, Caesars Politik durch Obstruktion und Obnuntiation zu verhindern. Er zog sich schließlich für den Rest des Amtsjahres in sein Haus zurück.
Was war die lex Vatinia de imperio Caesaris?
Die lex Vatinia de imperio Caesaris verlieh Caesar die Gallia Cisalpina und Illyricum mit 3 Legionen auf 5 Jahre.
Wie beeinflusste Caesars Konsulat die Stabilität der Römischen Republik?
Caesars Konsulat untergrub die senatorische Autorität und demonstrierte die Machtlosigkeit des Senats, was zu einer Zunahme integrativer Tendenzen in der römischen Gesellschaft und letztendlich zum Zerfall der res publica beitrug.
- Quote paper
- Marek Wejwoda (Author), 1999, Cäsars Konsulat 59 v.Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/95115