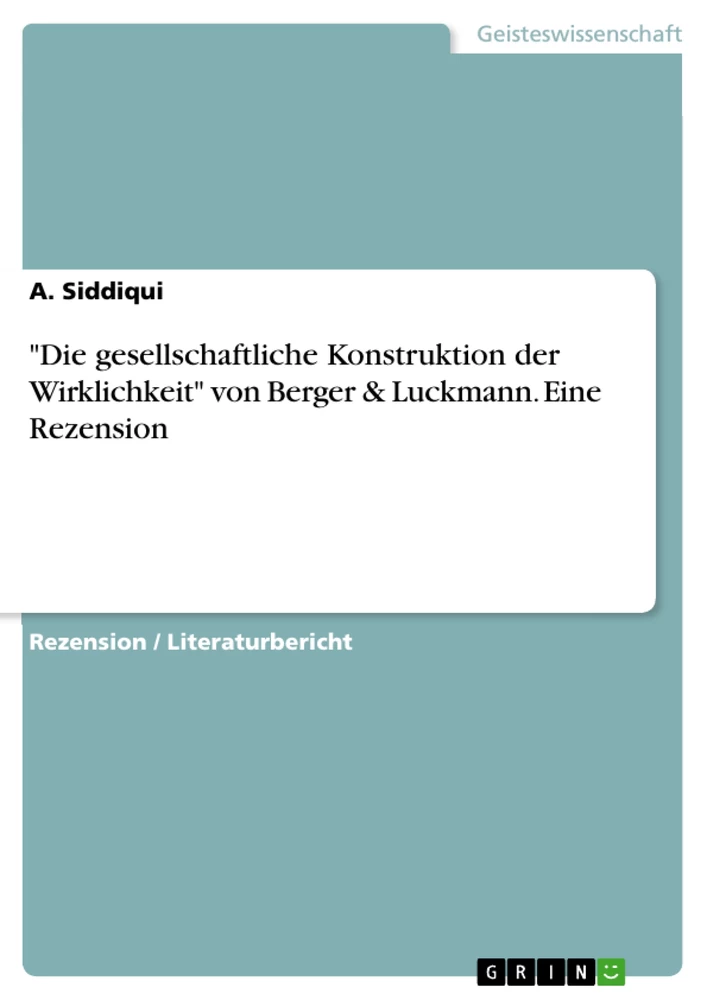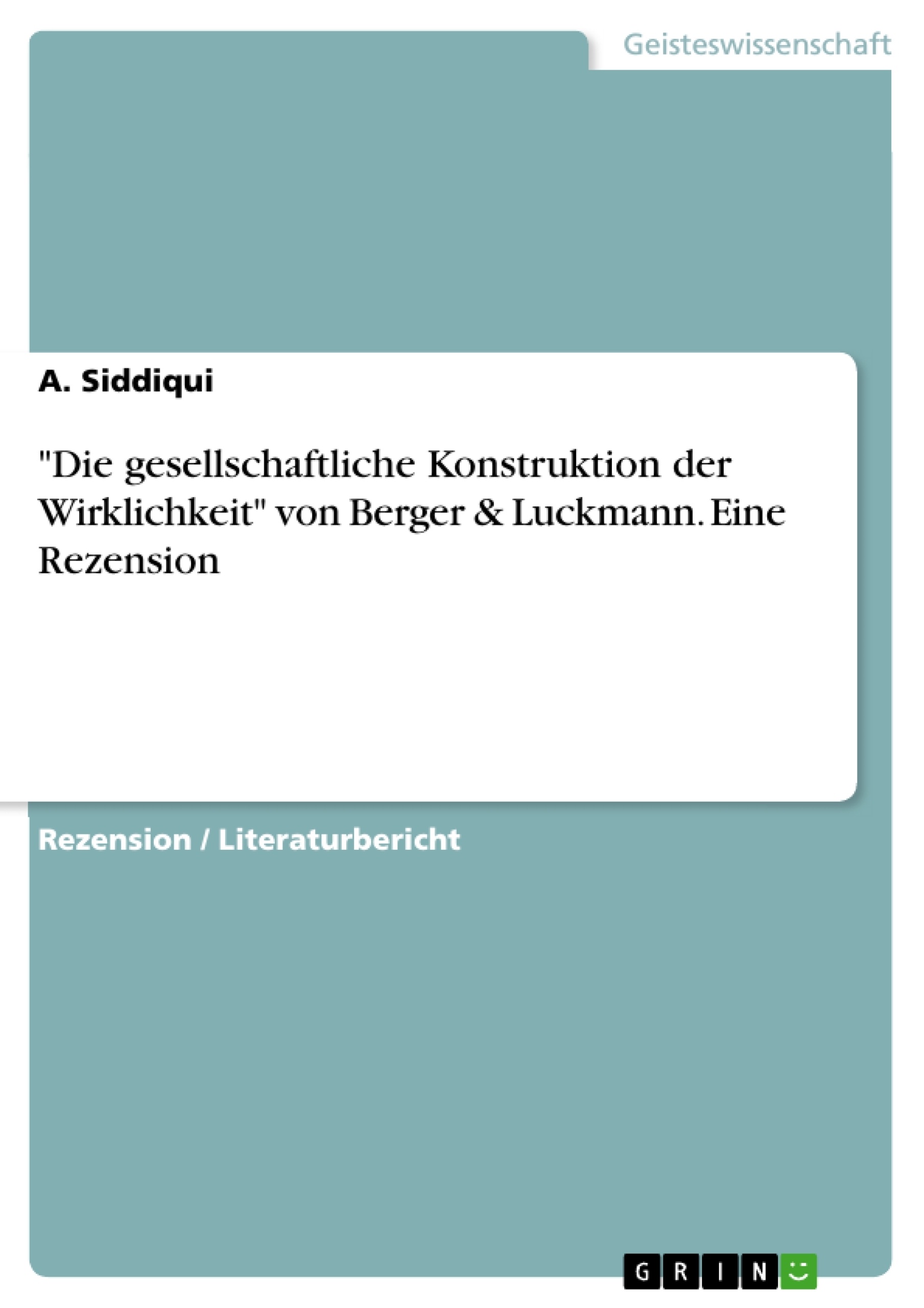Thomas Luckmann und Peter L. Berger veröffentlichten ihr soziologisches Hauptwerk erstmals 1966 in den USA unter dem Namen „The Social Construction of Reality“.
1969 wurde es unter dem Titel „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ ins Deutsche übersetzt und gilt als eines der prägendsten Werke der Wissenssoziologie. Im Grunde genommen hat die Arbeit von Berger & Luckmann den Anspruch, eine paradigmatische Neuorientierung der Wissenssoziologie als Ganzes herbeizuführen. War es bis dato noch üblich das bereits bestehende, „normale“ Alltagswissen nicht zu hinterfragen und somit auch nicht zum Gegenstand soziologischer Untersuchung zu machen, ist genau dieser Aspekt – das Alltagswissen – das Hauptproblem der Wissenssoziologie von Berger & Luckmann (vgl. Berger & Luckmann 1969, S.16f). Ihr Anspruch ist es, ein theoretisches Modell zu konstruieren, welches sich systematisch mit der Erschließung des vortheoretischen Wissens bzw. der vortheoretischen Wirklichkeit beschäftigt.
Inhaltsverzeichnis
- I. INHALT & THESE
- II. EINORDNUNG IN DEN FORSCHUNGSSTAND
- III. KRITIK & FAZIT
- IV. QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung von Berger und Luckmann in "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" ist eine paradigmatische Neuorientierung der Wissenssoziologie. Sie wollen ein theoretisches Modell entwickeln, das die Erschließung vortheoretischen Wissens und der vortheoretischen Wirklichkeit systematisch untersucht und die Wissenssoziologie als zentralen Bereich soziologischer Forschung etabliert.
- Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit als sozialer Prozess
- Bedeutung von Habitualisierung und Institutionalisierung für soziale Ordnung
- Rolle des Alltagswissens und der Objektivation (Sprache, Symbole) in der Wissensproduktion
- Einordnung in den bestehenden Forschungsstand (Schütz, Weber, Mead, Durkheim)
- Dualistische Betrachtungsweise von subjektiver und objektiver Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. INHALT & THESE: Berger und Luckmann untersuchen in diesem Kapitel die Entstehung und Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Ordnung. Sie argumentieren sozialkonstruktivistisch, dass soziale Ordnung ein Produkt ständiger menschlicher Produktion ist, basierend auf Habitualisierung (wiederholte Handlungen werden zu Gewohnheiten) und Institutionalisierung (Typisierung von Habitualisierungen, die über Individuen hinaus bestehen). Das Alltagswissen, als „Allerweltswissen“, bildet die Bedeutungs- und Sinnstruktur der Gesellschaft. Sprache und andere Formen der Objektivation (Symbole, Zeichen) dienen der Vermittlung und Reproduktion dieses Wissens. Die Autoren präsentieren eine dualistische Sichtweise der Wirklichkeit: objektiv, da Individuen mit bereits bestehenden Strukturen interagieren, und subjektiv, da sich die Wirklichkeit in individuellen Handlungen manifestiert.
II. EINORDNUNG IN DEN FORSCHUNGSSTAND: Dieses Kapitel ordnet das Werk von Berger und Luckmann in den wissenschaftlichen Kontext ein. Der Einfluss von Alfred Schütz und seiner phänomenologischen Herangehensweise wird hervorgehoben, ebenso wie die Rezeption von Max Webers Konzept des „subjektiv gemeinten Sinnes“, George H. Meads symbolischem Interaktionismus und Émile Durkheims analytischer Betrachtungsweise der Gesellschaft als Realität sui generis. Berger und Luckmann verbinden diese verschiedenen Paradigmen zu einem integrativen Ansatz, um die grundlegende soziologische Frage nach der Möglichkeit von Gesellschaft zu beantworten, in der Tradition von Denkern wie Hobbes, Rousseau und Parsons.
Schlüsselwörter
Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Wissenssoziologie, Habitualisierung, Institutionalisierung, Alltagswissen, Objektivation, soziale Ordnung, Alfred Schütz, Max Weber, George H. Mead, Émile Durkheim.
Häufig gestellte Fragen zu "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" von Berger und Luckmann
Was ist die zentrale These von Berger und Luckmanns Werk?
Die zentrale These von Berger und Luckmann in "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" ist, dass soziale Ordnung nicht als etwas Natürliches oder Vorgegebenes betrachtet werden kann, sondern als ein fortwährendes Produkt menschlicher Handlungen. Sie argumentieren sozialkonstruktivistisch und zeigen, wie durch Habitualisierung (wiederholte Handlungen werden zu Gewohnheiten) und Institutionalisierung (Typisierung von Habitualisierungen) soziale Strukturen entstehen und erhalten bleiben.
Welche Rolle spielt das Alltagswissen?
Alltagswissen, das sogenannte „Allerweltswissen“, bildet die Grundlage der Bedeutungs- und Sinnstruktur der Gesellschaft. Es ist der gemeinsame Wissensfundus, auf dem soziale Interaktionen und das Verständnis der Welt beruhen. Sprache und andere Symbole dienen der Vermittlung und Reproduktion dieses Wissens.
Welche Konzepte sind zentral für die Argumentation?
Zentrale Konzepte sind Habitualisierung (Verfestigung von Handlungen zu Gewohnheiten), Institutionalisierung (Verfestigung von Habitualisierungen zu stabilen sozialen Strukturen), Objektivation (Vergegenständlichung von Wissen in Sprache, Symbolen etc.) und die dualistische Betrachtungsweise von subjektiver (individuell erlebter) und objektiver (gesellschaftlich geprägter) Wirklichkeit.
Wie ordnen Berger und Luckmann ihr Werk in den Forschungsstand ein?
Das Werk baut auf verschiedenen soziologischen Ansätzen auf, insbesondere auf der Phänomenologie Alfred Schütz', dem Konzept des „subjektiv gemeinten Sinnes“ von Max Weber, dem symbolischen Interaktionismus von George H. Mead und der analytischen Betrachtungsweise Émile Durkheims. Berger und Luckmann verbinden diese Ansätze zu einem integrativen Modell.
Welche Kapitel umfasst das Buch und was behandeln sie?
Das Buch umfasst mindestens vier Kapitel: Kapitel I ("Inhalt & These") behandelt die Entstehung und Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Ordnung. Kapitel II ("Einordnung in den Forschungsstand") verbindet die eigene Theorie mit bestehenden soziologischen Ansätzen. Weitere Kapitel behandeln vermutlich Kritik und Fazit sowie Quellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Werk?
Schlüsselwörter sind: Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Wissenssoziologie, Habitualisierung, Institutionalisierung, Alltagswissen, Objektivation, soziale Ordnung, Alfred Schütz, Max Weber, George H. Mead, Émile Durkheim.
Was ist die Zielsetzung des Buches?
Die Zielsetzung ist eine paradigmatische Neuorientierung der Wissenssoziologie. Berger und Luckmann wollen ein theoretisches Modell entwickeln, das die Erschließung vortheoretischen Wissens und der vortheoretischen Wirklichkeit systematisch untersucht und die Wissenssoziologie als zentralen Bereich soziologischer Forschung etabliert.
- Quote paper
- A. Siddiqui (Author), 2020, "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" von Berger & Luckmann. Eine Rezension, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/950808