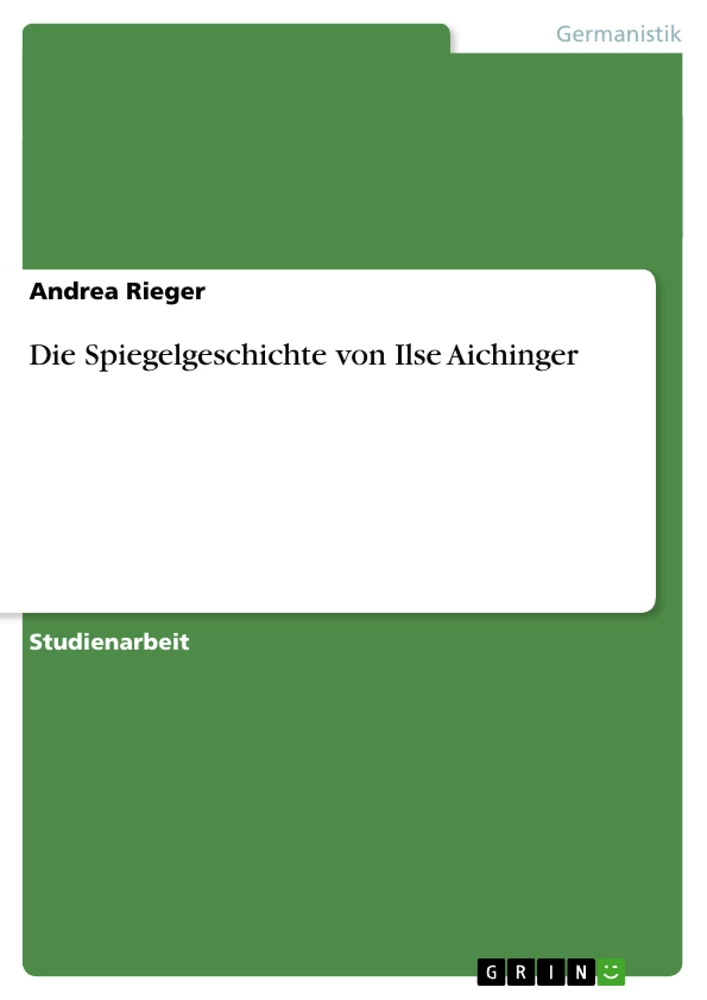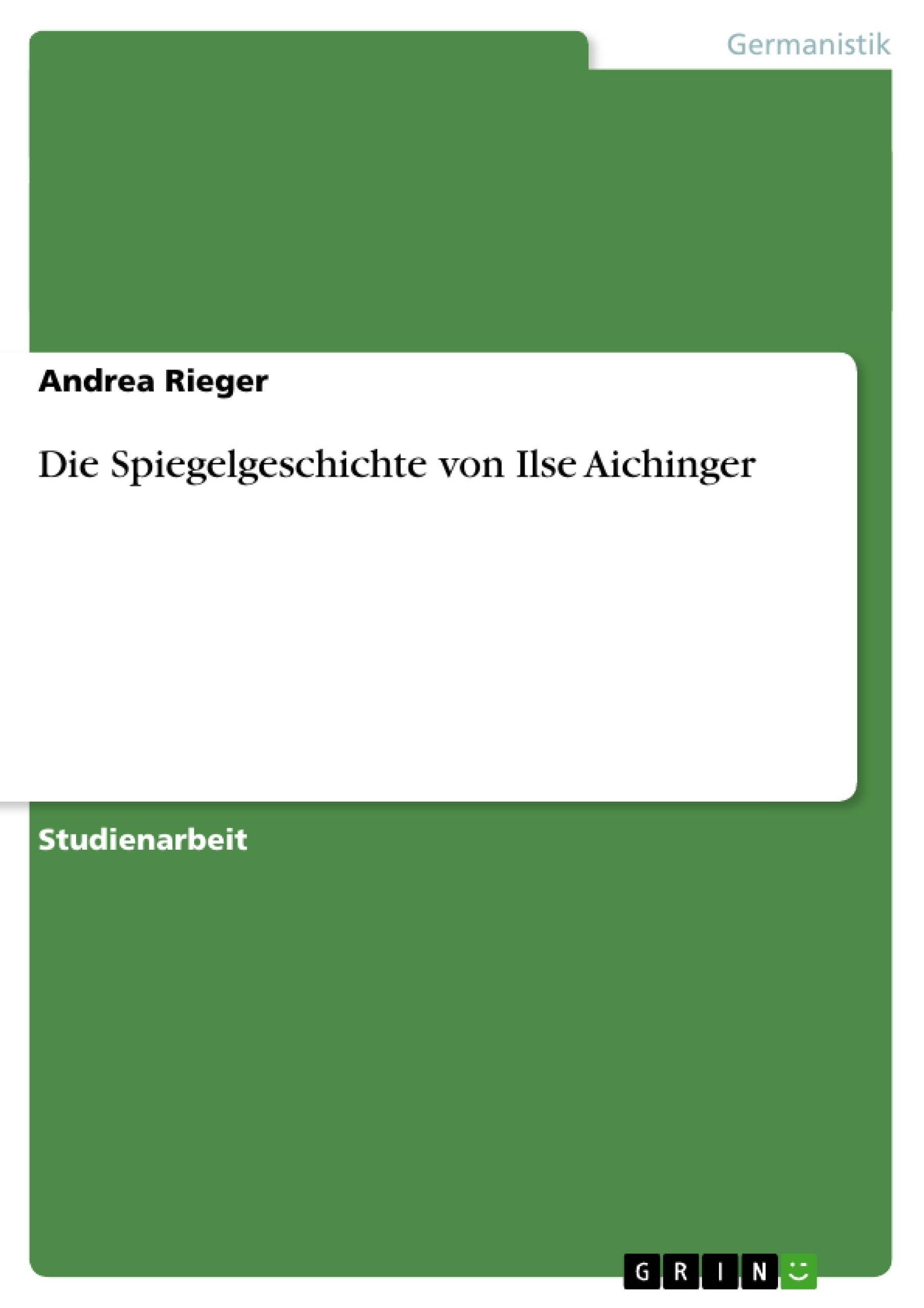Stellen Sie sich vor, das Ende ist erst der Anfang… Ilse Aichingers "Spiegelgeschichte" entführt Sie in eine Welt, in der die Zeit rückwärts fließt und das Leben einer jungen Frau von ihrem Tod bis zu ihrer Geburt aufgerollt wird. Ein Krankenhausbett wird zur Bühne eines außergewöhnlichen Schauspiels, während das Personal den vermeintlichen Todeskampf kommentiert, ahnt der Leser, dass hier mehr geschieht als bloßes Sterben. Die Erzählung, durchwoben von eindringlicher Symbolik wie der Farbe Grün, die für Hoffnung und Unsterblichkeit steht, und dem Spiegel selbst, der die verzerrte Realität widerspiegelt, konfrontiert uns mit der Frage nach Leben, Tod und der Möglichkeit eines Neubeginns. Erleben Sie die Schlüsselerlebnisse der Protagonistin – eine erzwungene Abtreibung, die Begegnung mit einem Liebhaber, der Tod der Mutter – in einer nie dagewesenen Perspektive. Aichingers ungewöhnliche Du-Form lässt den Leser zum Vertrauten der Sterbenden werden, während der Erzähler, möglicherweise eine göttliche Instanz, tröstende Worte spendet und vor den Schattenseiten des Lebens warnt. Doch wer ist dieser Liebhaber, der im Leben der jungen Frau eine so ambivalente Rolle spielt? Und welche Bedeutung hat die grüne Farbe, die immer wieder in ihren letzten Momenten aufscheint? Tauchen Sie ein in diese literarische Vexierbild, eine faszinierende Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz, der Akzeptanz des Todes und der verborgenen Schönheit im Kreislauf des Lebens. "Die Spiegelgeschichte" ist mehr als nur eine Erzählung; sie ist eine poetische Reise durch die Tiefen der Seele, ein Spiegelbild unserer eigenen Ängste und Hoffnungen, und ein unvergessliches Leseerlebnis, das noch lange nachwirkt. Lassen Sie sich von Aichingers Sprachgewalt verzaubern und entdecken Sie die überraschenden Wendungen in diesem außergewöhnlichen Werk der deutschsprachigen Literatur. Erkunden Sie die einzigartige Erzählstruktur, die innovative Verwendung von Symbolen und die tiefgründigen Themen, die diese Geschichte zu einem Meisterwerk machen.
Inhaltsverzeichnis
-Vorwort
-Die Autorin - Ilse Aichinger
-Die Spiegelgeschichte
Inhalt
Symbolik
Thematik
-Zeitgerüst - Erzählzeit
-Erzählkategorien
Erzählform
Erzählverhalten
Erzählhaltung
-Textkommunikation
-Literaturverzeichnis
-Sigleverzeichnis
Vorwort
Die vorliegende Arbeit war unser Versuch, das im Proseminar erarbeitete Wissen über die Erzähltextanalyse, in die Praxis umzusetzen.
Da uns diese Aufgabe alleine in dieser kurzen Zeit nicht bewältigbar schien, schlossen wir uns zu einer Gruppe zusammen, und versuchten so diese Aufgabenstellung zu lösen. Diese Grup- penarbeit erwies sich für uns als große Bereicherung, da sie es uns ermöglichte, viele wertvol- le Erfahrungen zu sammeln. So mußten wir in unseren zahlreichen Diskussionen immer wie- der Kompromisse eingehen, außerdem wurden uns einige Bereiche der Erzähltextanalyse erst im Gespräch klarer.
Die folgenden Seiten stellen also das Ergebnis einer Woche intensiver Beschäftigung mit der Spiegelgeschichte dar.
Die Autorin - Ilse Aichinger
Ilse Aichinger, die Tochter einer jüdischen Ärztin und eines Lehrers, wurde am 1.11.1921 in Wien geboren.
Wegen der Rassengesetze konnte sie ihr Medizinstudium erst nach Kriegsende beginnen. Sie brach dieses aber ab, um ihren Roman „Die größere Hoffnung“ fertigstellen zu können. Großen Erfolg hatte sie mit der Spiegelgeschichte, die ihr 1952 den Preis der Gruppe 47 ein- brachte.1
Die Spiegelgeschichte
Die Spiegelgeschichte, die Ilse Aichinger im Jahre 1948 zu schreiben begann, wurde von ihr erst eineinhalb Jahre später fertiggestellt. Das erste Mal erschien sie 1949 in der „Wiener Ta geszeitung“ in drei Fortsetzungen.2
Inhalt
Die Geschichte beginnt mit dem Tod - der eigentlich das Ende bedeutet - einer jungen Frau. In diesem Fall wird der Tod allerdings nicht als Ende sondern als Ausgangspunkt der Ge- schichte gesehen. Wie durch einen Spiegel sieht der Leser ihr ganzes Leben im Rücklauf, wie folgendes Beispiel zeigt:
Bald kommt der Sommer mit den langen Tagen. Bald stirbt deine Mutter. Du und dein Vater, ihr beide holt sie vom Friedhof ab. Drei Tage liegt sie noch zwischen den knisternden Kerzen, wie damals du. Blast alle Kerzen aus, eh sie erwacht! Aber sie riecht das Wachs und hebt sich auf die Arme und klagt leise ü ber die Verschwendung. Dann steht sie auf und wechselt ihre Kleider.3
Einzelne Schlüsselerlebnisse, wie der Krankenhausaufenthalt und die von ihrem Freund erzwungene Abtreibung, das Kennenlernen ihres Liebhabers, der Tod der Mutter und ihre Kindheit und Geburt, wurden dazu herausgenommen.
Parallel zu dieser Geschichte kommentiert das Krankenhauspersonal den Todeskampf der Patientin. Diese Kommentare beginnen allerdings erst nach der mißlungenen Abtreibung beziehungsweise bei der Einlieferung der Patientin ins Krankenhaus mit der Bemerkung: „Die Fieberkrämpfe lassen nach [...] der Todeskampf beginnt!“4
Symbolik
Ilse Aichinger hat sich unserer Meinung nach einiger Symbole bedient, auf deren Bedeutung wir im Folgenden näher eingehen wollen.
Die Farbe Grün
Auffallend ist hier vor allem, daß die Farbe Grün in den verschiedensten Variationen vor- kommt. Grün galt im Alten Testament als Farbe der Gerechten und im Mittelalter als Farbe des Lebens.5 Außerdem symbolisiert im Volksmund die Farbe Grün die Hoffnung und die Unsterblichkeit.
Folgende Beispiele haben wir dazu in der Spiegelgeschichte gefunden:
- Dein Wagen wartet an der Kreuzung auf das gr ü ne Licht. 6
Das Warten an der Kreuzung auf das grüne Licht wird von uns als das Warten auf das Leben bzw. das ewige Leben interpretiert.
- Sie lassen dich allein. So allein lassen sie dich, da ß du die Augen aufschl ä gst und den gr ü nen Himmel siehst, so allein lassen sie dich, da ß du zu atmen beginnst, schwer und r ö chelnd und tief, prasselnd wie eine Ankerkette, wenn sie sich l ö st. Du b ä umst dich auf und schreist nach deiner Mutter. Wie gr ü n der Himmel ist! 7
Wenn sie aufwacht und das Grüne sieht, symbolisiert das für uns ihre Rückkehr ins Leben.
Sieht man die Geschichte in diesem Punkt ohne den Spiegel, also in chronologischer Abfolge, dann ist der grüne Himmel das letzte von ihr vor ihrem Tod Gesehene, d.h. sie blickt dem ewigen Leben entgegen.
Der Spiegel als Symbol
Schon der symbolische Titel, der auf den durch den Spiegel hervorgerufenen Bildre flex deutet, also sowohl auf den verkehrten Geschehensverlauf wie auch die Unwirklichkeit des Geschehens verweist, nimmt in Chiffrenform die zentrale, … Aussage vorweg, d.h. sie wird durch die Bewegung des Erz ä hlvorgangs, die dem R ü ckspulen eines Films gleicht, ausgedr ü ckt. 8
Um das Leben mit dem Tod beginnen zu können, ein Vorgang der im „wirklichen“ Leben unmöglich ist, bedient sich Ilse Aichinger einer Spiegelebene, durch die die Geschichte rückläufig erzählt werden kann, und so an Glaubwürdigkeit gewinnt.
Thematik
Einen wichtigen Stellenwert in dieser Geschichte nimmt der Tod ein. „Vom Tod, dem Fixpunkt der Geschichte, geht alles aus, zum Tod strebt alles hin.“9
Es scheint aber, daß der Tod in der Geschichte nicht akzeptiert wird, da nach dem letzten Kommentar des Krankenhauspersonals: „Es ist zu Ende - ... sie ist tot!“ der Erzähler „Still! Laß sie reden!“10 sagt, und damit die Worte des Krankenhauspersonals als bloßes Gerede abtut. Auch am Beginn der Geschichte fordert der Erzähler die junge Tote auf, aufzustehen.
Zeitgerüst Erzählzeit
Was das Erzähltempo betrifft, ist eine klare Zuordnung schwierig. Während die Erzählzeit klar mit 12 Seiten definiert werden kann, muß man die erzählte Zeit zu zwei Handlungssträngen zuordnen.
Auf der einen Seite kommentiert das Krankenhauspersonal den Todeskampf: „ Die Fieber- tr ä ume lassen nach … der Todeskampf beginnt! “ 11 bis zum eigentlichen Tod hin: „ Es ist zu Ende- … sie ist tot! “12 Diese Kommentare bilden den losen Rahmen um die Geschichte13 ; sie laufen chronologisch ab.
Obwohl man nicht genau sagen kann, wie lange ein Todeskampf dauern kann, gehen wir davon aus, daß er länger dauert als das eigentliche Lesen, das würde bedeuten, daß es sich um Zeitraffung handelt.
Auf der anderen Seite steht die szenische Darstellung des Lebens der Frau. Diese läuft im Gegensatz zum ersten Handlungsstrang rückwärts, als ob man einen Film zurückspulen würde14. Da es sich unserem Verständnis nach hier um einen Traum der Frau handelt - auch das Krankenhauspersonal spricht von Fieberträumen - kann sich die erzählte Zeit des Traumes auf einige wenige Sekunden beschränken.
In diesem Fall wäre es eine Zeitdehnung, vergleichbar mit der Zeitlupentechnik, d.h. die Erzählzeit ist länger als die erzählte Zeit (ein paar Sekunden).
Nimmt man jedoch das Leben der Frau, das länger dauert als die Erzählzeit (12 Seiten) als erzählte Zeit an, handelt es sich um Zeitraffung.
Bei der Zeitraffung werden für die Geschichte irrelevante Teile ausgespart. Diese Stellen kann man auf zwei verschiedene Arten überbrücken:
Implizite Textaussparung
Wenn einer dein Bett aus dem Saal schiebt, wenn du siehst, da ß der Himmel gr ü n wird, und wenn du dem Vikar die Leichenrede ersparen willst, so ist es Zeit f ü r dich, aufzustehen, leise, wie Kinder aufstehen, wenn am Morgen Licht durch die L ä den schimmert, heimlich, da ß es die Schwester nicht sieht - und schnell! Aber da hat er schon begonnen, der Vikar, da h ö rst du seine Stimme, jung und eifrig und unaufhaltsam,... 15
Explizite Aussparung
Da tobst du nur drei Tage lang gegen dich und trinkst dich satt am gr ü nen Himmel, da st öß t du nur drei Tage lang die Suppe weg, die dir die Frau von oben bringt, am vierten nimmst du sie.
Und am siebenten, der der Tag der Ruhe ist, am siebenten gehst du weg. 16
Erzählkategorien
Erzählform
Bei der Erzählform handelt es sich um die sehr selten auftretende, und deshalb ungewohnte Du-Form.17
So berichtet der Erzähler „in der Du-Form von einem Du, Ereignissen und Erlebnissen des Angesprochenen.“18
Du h ä ngst den blauen Hut an den Nagel, den alle Kinder tragen, wieder an den Nagel und verl äß t die Schule. Es ist wieder Herbst. Die Bl ü ten sind lange schon zu Knospen geworden, die Knospen zu nichts und nichts wieder zu Fr ü chten. Ü berall gehen kleine Kinder nach Hause, die ihre Pr ü fung bestanden haben, wie du. Ihr alle wi ß t nichts mehr. Du gehst nach Hause, dein Vater erwartet dich, und die kleinen Br ü der schreien so laut sie k ö nnen und zerren an deinem Haar. Du bringst sie zur Ruhe und tr ö stest deinen Vater.19
Petersen meint, daß in der Du-Form der Erzähler seine Kommentare „letztlich auch an den Leser“20 richtet, bzw. diese auf den Leser wenigstens so wirken können.21
Auch wir hatten, insbesondere beim Lesen des ersten Absatzes der Spiegelgeschichte das Gefühl vom Erzähler angesprochen zu werden, da man beim ersten Durchlesen noch nicht weiß, daß der Erzähler sich auf eine junge Frau, die gerade gestorben ist, bezieht.
Wenn einer dein Bett aus dem Saal schiebt, wenn du siehst, da ß der Himmel gr ü n wird, und wenn du dem Vikar die Leichenreden ersparen willst, so ist es Zeit f ü r dich, aufzustehen, leise, wie Kinder aufstehen, wenn am Morgen Licht durch die L ä den schimmert, heimlich, da ß es die Schwester nicht sieht - und schnell! 22
Der Du-Erzähler erscheint uns wie ein Beschützer (1), der der jungen Frau immer wieder gut zuredet, und tröstende (2) und beruhigende (3) Worte an sie richtet. Außerdem versucht er auch, sie von den Kommentaren des Krankenhauspersonals abzulenken (4) und sie mit Aufforderungen, auf den richtigen Weg zu bringen (5).
ad 1: „Gib acht, jetzt beginnt er bald von der Zukunft zu reden, von den vielen Kindern und vom langen Leben, und seine Wangen brennen vor Eifer.“23
ad 2: „Sei geduldig. Es ist ja Frühsommer. Da reicht der Morgen noch lange in die Nacht hinein. Ihr kommt zurecht.“24
ad 3: „»Es dauert nicht mehr lang«, sagen die hinter dir, »es geht zu Ende!« Was wissen die? Beginnt nicht jetzt erst alles?25
ad 4: „»Die Fieberträume lassen nach«, sagt eine Stimme hinter dir, »der Todeskampf beginnt! « Ach die! Was wissen die ?“26
ad 5: „Und nimm Abschied, eh du dich an seinen Arm hängst. Nimm von ihm Abschied!“27
All diese Beispiele führen uns zu der Annahme, daß es sich bei diesem fürsorglich und positiv wirkendem Erzähler, um Gott handeln könnte.
Erzählverhalten
Bei einem in der Du-Form verfaßten Text ist es nicht nur für uns schwierig, das Erzählverhalten herauszufinden. So meint auch Jürgen H. Petersen, daß man in bestimmten Fällen nicht zwischen auktorialem und personalem Erzählverhalten unterscheiden kann, da „die Du-Form sozusagen von Natur aus in gewisser Weise [ein] auktoriales Gepräge [besitzt].“28 Aus diesem Grund haben wir als Beispiel eine klar auktoriale Textpassage gewählt.
Die Schmerzen jagen dich, den Weg wirst du ja finden. Erst links, dann rechts und wieder links, quer durch die Hafengassen, die so elend sind, da ß sie nicht anders k ö n- nen, als zum Meer zu f ü hren. Wenn nur der junge Mann in deiner N ä he w ä re, aber der junge Mann ist nicht bei dir, im Sarg warst du viel sch ö ner.[...] Und jetzt steht auch der Schwei ß wieder auf deiner Stirne, den ganzen Weg lang, nein, im Sarg, da warst du sch ö ner! 29
Das Präsens ist die typische Zeitform des auktorialen Erzählens, die es dem Erzähler ermöglicht, die Gefühle und Gedanken des „Du“ zu beschreiben. So ist auch die Spiegelgeschichte im Präsens verfaßt.
Das oben zitierte Beispiel zeigt, daß der Erzähler die Gedanken und Gefühle mehrerer Perso- nen kennt, da er weiß, daß sich die Frau nach ihrem Liebhaber sehnt und daß der junge Mann die Frau als Tote hübscher fand. Darum meinen wir, daß es sich hierbei um auktoriales Er- zählverhalten handelt.
Weiters ist sein Blickwinkel nicht eingeschränkt. Er hat Einblick in die Gedanken und Ge- fühlswelt der Figuren, kann dem Geschehen ganz nahe sein, es aber auch aus größerer Distanz beobachten.
Obendrein lassen sich in diesem Text aber auch Beispiele für ein neutrales Erzählverhalten finden:
Und sie nehmen den Kranz vom Deckel und geben ihn dem jungen Mann zur ü ck, der mit gesenktem Kopf am Rand des Grabes steht. Der junge Mann nimmt seinen Kranz und streicht verlegen alle B ä nder glatt, er hebt f ü r einen Augenblick die Stirne, und da wirft ihm der Regen ein paar Tr ä nen ü ber die Wangen. Dann bewegt sich der Zug die Mauern entlang wieder zur ü ck. 30
Erzählhaltung
Der Begriff „Erzählhaltung“ bedeutet die Haltung des Erzählers zum erzählten Geschehen und auch zu den Figuren.
Unserer Meinung nach ist die Erzählhaltung in diesem Text vor allem dem jungen Mann gegenüber kritisch. Allein der Satz: „Und weil der Regen ihm keine Tränen gibt, starrt er ins Leere und dreht die Mütze zwischen seinen Fingern.“31 zeigt, wie der Narrator das Verhalten des jungen Mannes bewertet. Hiermit dokumentiert er, daß der Liebhaber zwar gefühlskalt ist, sich aber doch am Tod seiner Geliebten schuldig fühlt.
Der Erzähler warnt die Frau sogar vor ihrem Geliebten: „Gib acht, jetzt beginnt er bald von der Zukunft zu reden, von den vielen Kindern und vom langen Leben“32.
Zwar redet der Mann von einer glücklichen Familie, als die junge Frau aber schwanger ist, ist er nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen und drängt sie zur Abtreibung: „Kann denn das sein? Bevor er weiß, daß du das Kind erwartest, nennt er dir schon die Alte, bevor er sagt, daß er dich liebt, nennt er die Alte.“33
Im großen und ganzen haben wir den Eindruck, daß der Erzähler das Verhalten des jungen Mannes mißbilligt, gleichzeitig aber voll und ganz hinter der jungen Frau steht.
Textkommunikation
Aus dem großen Bereich der Textkommunikation haben wir den Teilbereich „Codes“ herausgenommen und versucht zu analysieren.
Der Begriff „Code“ wird im Glossar von „Grundzüge der Literaturwissenschaft“ folgendermaßen definiert:
In der Semiotik werden Codes als Grundlage f ü r das Verstehen von Zeichen begriffen; aus dieser Perspektive kann ein literarischer Text als eine vom Autor codierte Infor- mation betrachtet werden. Seine Decodierung durch den Leser schafft dann nicht ei- genst ä ndig etwas Neues, sondern entschl ü sselt lediglich die bereits vorhandene Be deutung. 34
Die Autorin verwendet in ihrem Text verschiedene Codes. Einer davon ist der bereits im Titel erwähnte Spiegel. Während ein Spiegel für die meisten ein bloßer Gebrauchsgegenstand ist, reflektiert er in der Spiegelgeschichte unter anderem auch Vergessen und Vergeben35
Ein weiterer Code wäre auch die Farbe Grün, auf deren mögliche Bedeutungen wir schon in dem Kapitel Symbolik näher eingegangen sind. Denn auch hier kann Grün als Farbe an sich stehen, wie z.B.: „Und hinter allem, was ihr tut, liegt gr ü n die See.“36 (optisch kann das Meer grün erscheinen).
Literaturverzeichnis
AICHINGER, Ilse: Der Gefesselte. Erzählungen (1948- 1952). Hrsg. von Richard Reichensperger. Frankfurt/ Main: Fischer 1991.
ARNOLD; Heinz Ludwig und DETERING, Heinrich (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv 1996.
ARNOLD; Heinz Ludwig (Hrsg.): Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG) München: edition text + kritik 1994.
GUTZEN, Dieter, OELLERS, Norbert u. PETERSEN, Jürgen H.: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. Berlin: Erich Schmidt 1984.
JENS, Walter (Hrsg.): Kindlers neues Literaturlexikon. Chefredaktion Rolf Geisler u. Rudolf Radler. Bd. 6. Zürich: Kindler 1965.
PETERSEN, Jürgen H.: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte. Stuttgart und Weimar: Metzler 1993.
SCHWEIKLE, Günther und Irmgard (Hrsg.): Metzler Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen. Stuttgart: Metzler 1990.
ŠLIBAR-HOJKER, Neva: Das dichterische Werk Ilse Aichingers. Ljubljana. Phil Diss. 1980. [Masch.]
Sigleverzeichnis
DG = Ilse Aichinger: Der Gefesselte. Erzählungen (1948- 1952). Hrsg. von Richard Reichensperger. Frankfurt/ Main: Fischer 1991.
[...]
1 Vgl. Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG). Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München: edition text + kritik 1994, S. 1.
2 Vgl. Ilse Aichinger: Die Spiegelgeschichte. In: Der Gefesselte. Erzählungen (1948- 1952). Hrsg. von Richard Reichersperger. Frankfurt/ Main: Fischer 1991, S. 109. In der Folge zitiert als: DG.
3 DG, S. 73.
4 DG, S. 66.
5 Metzler Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen. Hrsg. v. Günther und Irmgard Schweikle. 2., überarbeitete Aufl. Stuttgart: Metzler 1990, S. 451.
6 DG, S. 64.
7 Ebda, S. 66.
8 Neva Šlibar-Hojker: Das dichterische Werk Ilse Aichingers. Ljubljana. Phil Diss. 1980. [Masch.] S. 81f..
9 Kindlers neues Literaturlexikon. Hrsg. v. Walter Jens. Chefredaktion Rolf Geisler u. Rudolf Radler. Bd. 6. Zürich: Kindler 1965, S. 1818.
10 DG, S. 74.
11 Ebda, S. 66.
12 DG, S. 74.
13 Neva Šlibar-Hojker: Das dichterische Werk Ilse Aichingers. Ljubljana. Phil Diss. 1980. [Masch.] S. 82.
14 Vgl. Kindlers neues Literaturlexikon. Hrsg. v. Walter Jens. Chefredaktion Rolf Geisler u. Rudolf Radler. Bd. 6. Zürich: Kindler 1965, S. 1818.
15 DG, S. 63.
16 Ebda, S. 67.
17 Vgl. Dieter Gutzen u. Norbert Oellers u. Jürgen H. Petersen: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. 5.,überarb. Aufl. Berlin: Erich Schmidt 1984, S 15.
18 Jürgen H. Petersen: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte. Stuttgart und Weimar: Metzler 1993, S. 64.
19 DG, S. 73.
20 Jürgen H, Petersen: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte. Stuttgart und Weimar: Metzler 1993, S. 69
21 Vgl. ebda.
22 DG, S. 63.
23 Ebda, S. 70.
24 DG, S. 64.
25 Ebda, S. 71.
26 Ebda, S. 66.
27 Ebda, S. 68.
28 Jürgen H. Petersen: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte. Stuttgart und Weimar: Metzler 1993, S. 69.
29 DG, S. 67.
30 Ebda, S. 63.
31 Ebda, S. 65.
32 Ebda, S. 70.
33 Ebda, S. 69.
34 Grundzüge der Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering. München: dtv 1996, S. 649.
35 Vgl. Kindlers neues Literaturlexikon. Hrsg. v. Walter Jens. Chefredaktion Rolf Geisler u. Rudolf Radler. Bd. 6. Zürich: Kindler 1965, S. 1818.
Häufig gestellte Fragen zu "Die Spiegelgeschichte"
Was ist das Thema von "Die Spiegelgeschichte"?
Ein wichtiges Thema in dieser Geschichte ist der Tod. Der Tod ist der Ausgangspunkt der Geschichte, und alles strebt dem Tod zu. Es wird auch die Akzeptanz des Todes thematisiert.
Was symbolisiert die Farbe Grün in "Die Spiegelgeschichte"?
Die Farbe Grün, in ihren verschiedenen Variationen, kommt häufig vor. Sie könnte die Hoffnung und die Unsterblichkeit symbolisieren. Im Alten Testament galt sie als Farbe der Gerechten und im Mittelalter als Farbe des Lebens.
Welche Erzählform wird in "Die Spiegelgeschichte" verwendet?
Die Erzählform ist die ungewöhnliche Du-Form, in der der Erzähler von einem "Du", den Ereignissen und Erlebnissen des Angesprochenen, berichtet.
Was ist die Erzählzeit in "Die Spiegelgeschichte"?
Die Erzählzeit beträgt 12 Seiten. Die erzählte Zeit ist zweigeteilt: Einerseits der Todeskampf, kommentiert vom Krankenhauspersonal, andererseits die rückwärts laufende Darstellung des Lebens der Frau, die wie ein Traum wirkt.
Welches Erzählverhalten liegt in "Die Spiegelgeschichte" vor?
Es wird argumentiert, dass sowohl auktoriales als auch neutrales Erzählverhalten vorhanden sind. Der Erzähler kennt die Gedanken und Gefühle der Personen (auktorial), andererseits gibt es neutrale Beschreibungen von Ereignissen.
Wie ist die Erzählhaltung des Erzählers?
Die Erzählhaltung wird als kritisch gegenüber dem jungen Mann (Liebhaber) interpretiert, während der Erzähler voll und ganz hinter der jungen Frau steht.
Welche Codes werden in "Die Spiegelgeschichte" verwendet?
Die Autorin verwendet verschiedene Codes, z. B. den Spiegel (der Vergessen und Vergeben reflektiert) und die Farbe Grün.
Wer ist Ilse Aichinger?
Ilse Aichinger wurde am 1.11.1921 in Wien geboren. Die Spiegelgeschichte brachte ihr 1952 den Preis der Gruppe 47 ein.
Wann wurde "Die Spiegelgeschichte" geschrieben und veröffentlicht?
Ilse Aichinger begann "Die Spiegelgeschichte" im Jahr 1948 und stellte sie eineinhalb Jahre später fertig. Sie erschien erstmals 1949 in der "Wiener Tageszeitung" in drei Fortsetzungen.
Wie wird der Tod in der Geschichte dargestellt?
Der Tod wird als Ausgangspunkt der Geschichte gesehen. Die Geschichte beginnt mit dem Tod der Protagonistin und rollt dann ihr Leben rückwärts auf.
Was ist die Funktion des Spiegels in der Geschichte?
Der Spiegel dient als Metapher für die rückläufige Erzählstruktur der Geschichte, die das Leben der Protagonistin vom Tod bis zur Geburt zurückverfolgt.
Welche Bedeutung hat das Krankenhauspersonal in der Erzählung?
Das Krankenhauspersonal kommentiert den Todeskampf der Protagonistin, wodurch ein chronologischer Rahmen für die rückwärts erzählte Lebensgeschichte entsteht.
Wird der Erzähler als beschützend oder als allwissend angesehen?
Der Erzähler wird als beschützend dargestellt, der der jungen Frau gut zuredet, tröstende Worte spendet und sie vor den Kommentaren des Krankenhauspersonals abzulenken versucht. Es wird spekuliert, dass es sich bei dem Erzähler um Gott handeln könnte.
Wie ist die Textkommunikation?
Die Autorin verwendet Codes, wie z.B. den Spiegel, um die Bedeutung in der Geschichte zu vermitteln.
- Quote paper
- Andrea Rieger (Author), 1999, Die Spiegelgeschichte von Ilse Aichinger, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94783