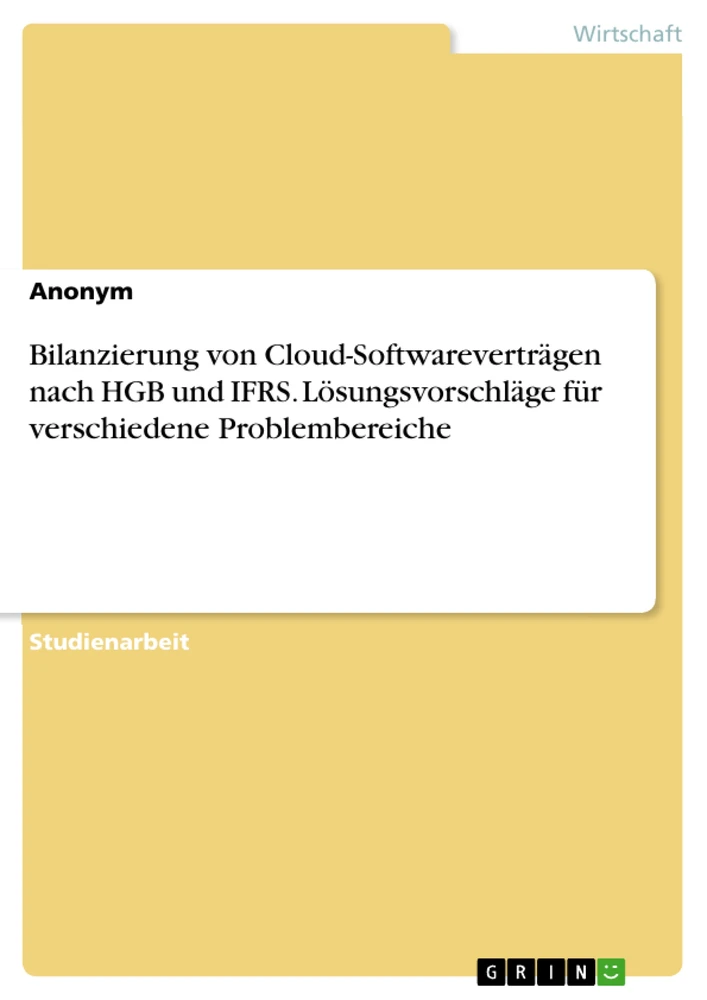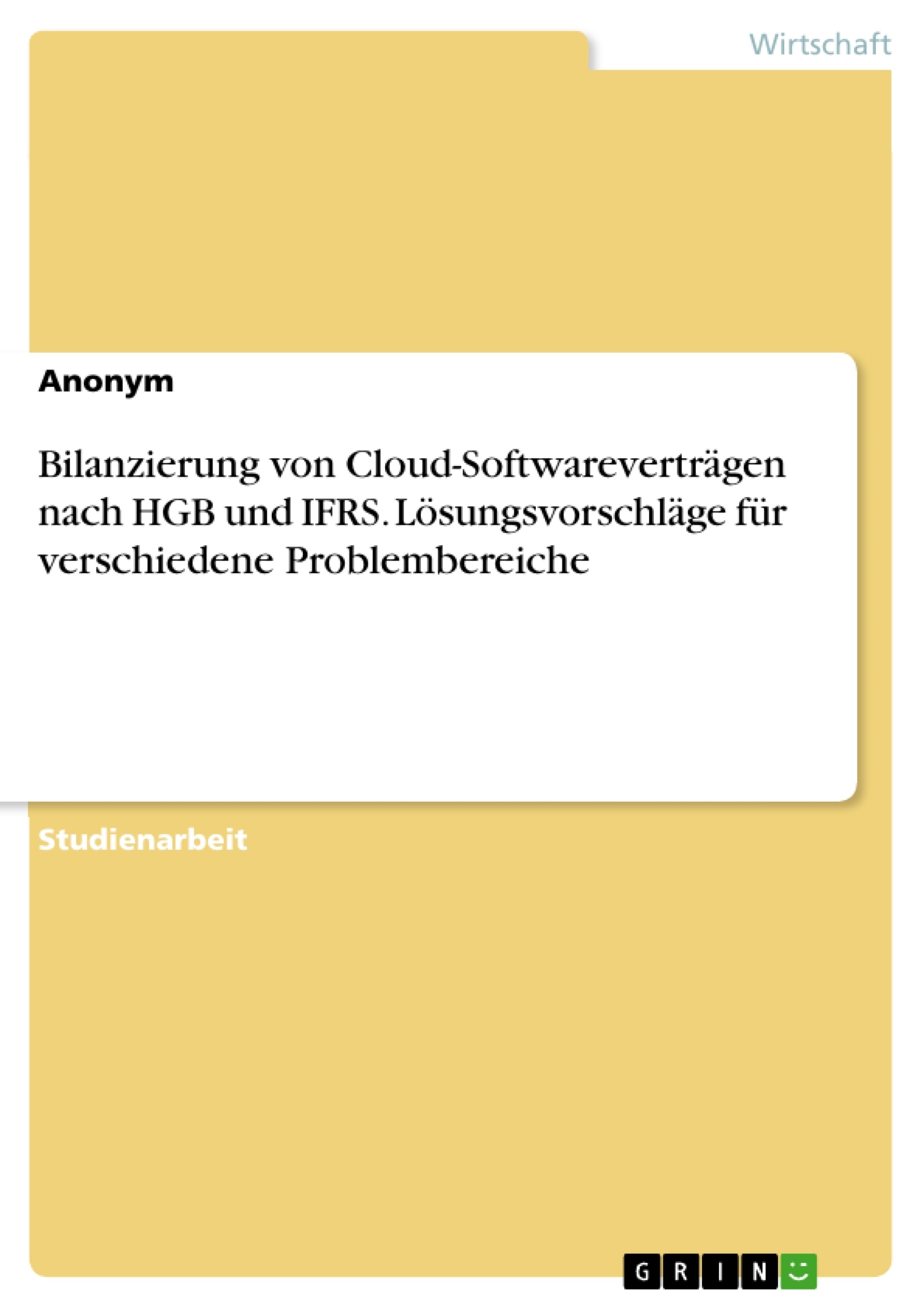In dieser Seminararbeit wird die bilanzielle Behandlung von Cloud-Softwareverträgen auf Basis der IFRS- und HGB-Rechnungslegung analysiert und mögliche Lösungen für die Problembereiche vorgeschlagen.
Durch die Wissenschaft und die stetige Weiterentwicklung der Technologie ist die Welt ein globales Dorf geworden. Mit der Globalisierung und Entwicklung vieler Schlüsselindustrien sind kreative und aufstrebende wirtschaftliche Wege zu den Hauptbedürfnissen der Zeit geworden. Die Informationstechnologie wird benötigt, um viele der heutigen Geschäftsanforderungen zu lösen, die die Rentabilität eines Marktes steigern. Unternehmen sind mit Tools ausgestattet, die unter anderem eine höhere Produktivität und effektive Nutzung und/oder Verwaltung der Zeit ermöglichen. Heutzutage verwenden viele Unternehmen und Marktführer kritische Systeme, mit denen sie verschiedene Aspekte von Ressourcen kommunizieren, verbinden und gemeinsam nutzen können, indem sie Cloud-Softwareverträge in Bezug auf die IT-Serviceabrechnung einsetzen.
Der Oberbegriff Cloud Computing erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Cloud Computing hat sich in letzter Zeit zu einem modischen Begriff entwickelt, einem der Schlagworte, die in jedem modernen Technologieaustausch auftauchen müssen. Laut einer repräsentativen Umfrage von Bitcoin Research nutzten im Jahr 2017 bereits 2/3 aller Unternehmen Rechenleistungen aus der Cloud.
Inhaltsverzeichnis
- Aufbau der Arbeit
- Einleitung
- Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit
- Cloud-Softwareverträge
- Historische Entwicklung
- Arten der Betreibermodelle
- Arten der Liefermodelle
- Vor- und Nachteile von Cloud-Softwareverträgen
- Funktionsweise von Cloud-Softwareverträgen
- Bilanzierung nach HGB
- Relevante Bilanzierungsgrundsätze nach HGB
- Grundsätzliche Ansatzkriterien
- Wirtschaftliche Zurechnung
- Bilanzierung beim Anbieter oder beim Nutzer?
- Kriterien des wirtschaftlichen Eigentümers
- Leasingvertrag oder Dienstleistungsvertrag?
- Systematisierung des Ansatzes
- Bewertung aktivierbarer Software
- Anschaffungskosten von Software nach HGB
- Folgebewertung von Software
- Bilanzierung nach IFRS
- Software Asset-Modell und Service-Modell
- Immaterielle Vermögenswerte
- Software als Leasing
- Dauerschuldverhältnis
- Implementierungskosten für SaaS-Vereinbarungen
- Praxisbeispiel zu Softwareverträgen
- Synopse HGB/IFRS
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bilanzierung von Cloud-Softwareverträgen im Rahmen der deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und der International Financial Reporting Standards (IFRS). Das Ziel ist es, die komplexen rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte dieser Verträge in Bezug auf die Bilanzierung zu beleuchten und die jeweiligen Anforderungen der beiden Rechnungslegungsstandards zu erläutern.
- Entwicklung und Funktionsweise von Cloud-Softwareverträgen
- Aktivierungsfähigkeit von Software nach HGB und IFRS
- Anwendbarkeit von Leasing- und Dienstleistungsrecht
- Bewertung und Folgebewertung von Cloud-Software
- Praxisbezogene Beispiele zur Bilanzierung von Cloud-Softwareverträgen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Cloud-Softwareverträge ein und stellt die Relevanz der Bilanzierung dieser Verträge in der heutigen Zeit dar. Die Arbeit beleuchtet die Zielsetzung und die Problemstellung der Arbeit.
- Cloud-Softwareverträge: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über die historische Entwicklung von Cloud Computing und den verschiedenen Betreiber- und Liefermodellen. Es beleuchtet die Vor- und Nachteile von Cloud-Softwareverträgen sowie die Funktionsweise dieser Verträge.
- Bilanzierung nach HGB: Dieses Kapitel befasst sich mit den relevanten Bilanzierungsgrundsätzen nach HGB, insbesondere im Hinblick auf die Aktivierungsfähigkeit von Software. Es analysiert die Kriterien für die wirtschaftliche Zurechnung, die Abgrenzung von Leasing- und Dienstleistungsverträgen sowie die Systematisierung des Ansatzes für die Bilanzierung von Cloud-Softwareverträgen.
- Bilanzierung nach IFRS: Dieses Kapitel behandelt die Bilanzierung von Cloud-Softwareverträgen nach IFRS, wobei es auf das Software Asset-Modell und das Service-Modell eingeht. Es beleuchtet die Behandlung von immateriellen Vermögenswerten und die spezifischen Anforderungen für die Bilanzierung von Software als Leasing.
- Synopse HGB/IFRS: Dieses Kapitel vergleicht die Bilanzierungsansätze nach HGB und IFRS im Kontext von Cloud-Softwareverträgen und zeigt die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themenfeldern der Bilanzierung von Cloud-Softwareverträgen nach HGB und IFRS. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen: Cloud Computing, Cloud-Softwareverträge, Aktivierungsfähigkeit von Software, Leasingrecht, Dienstleistungsrecht, immaterielle Vermögenswerte, Software Asset-Modell, Service-Modell, Bilanzierungsgrundsätze, wirtschaftliche Zurechnung, Anschaffungskosten, Folgebewertung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Bilanzierung von Cloud-Softwareverträgen nach HGB und IFRS. Lösungsvorschläge für verschiedene Problembereiche, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/944755