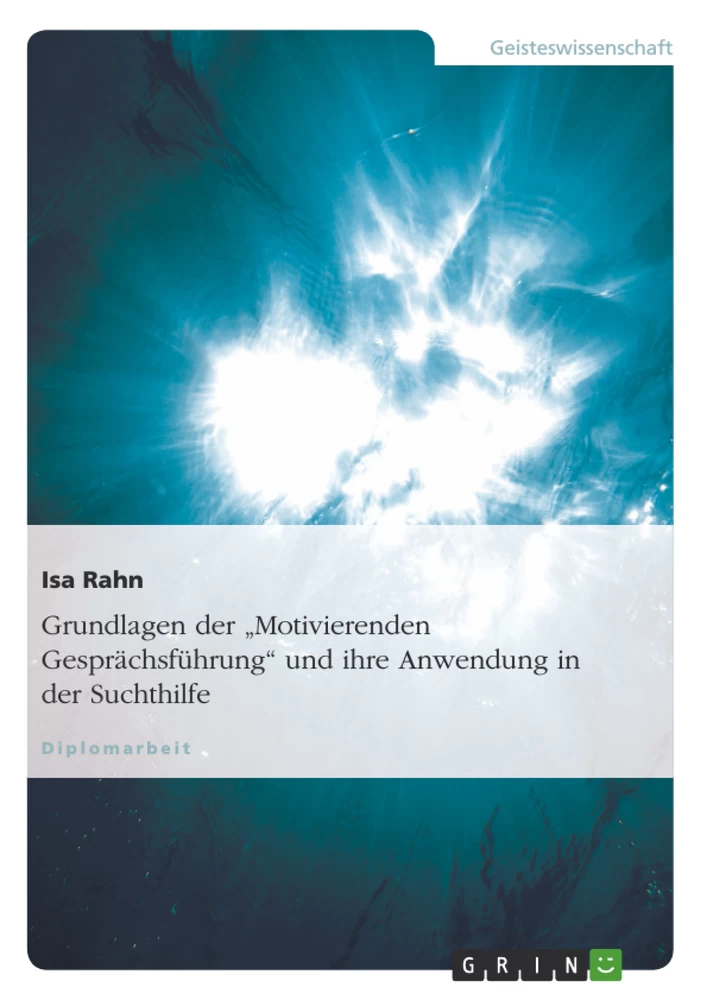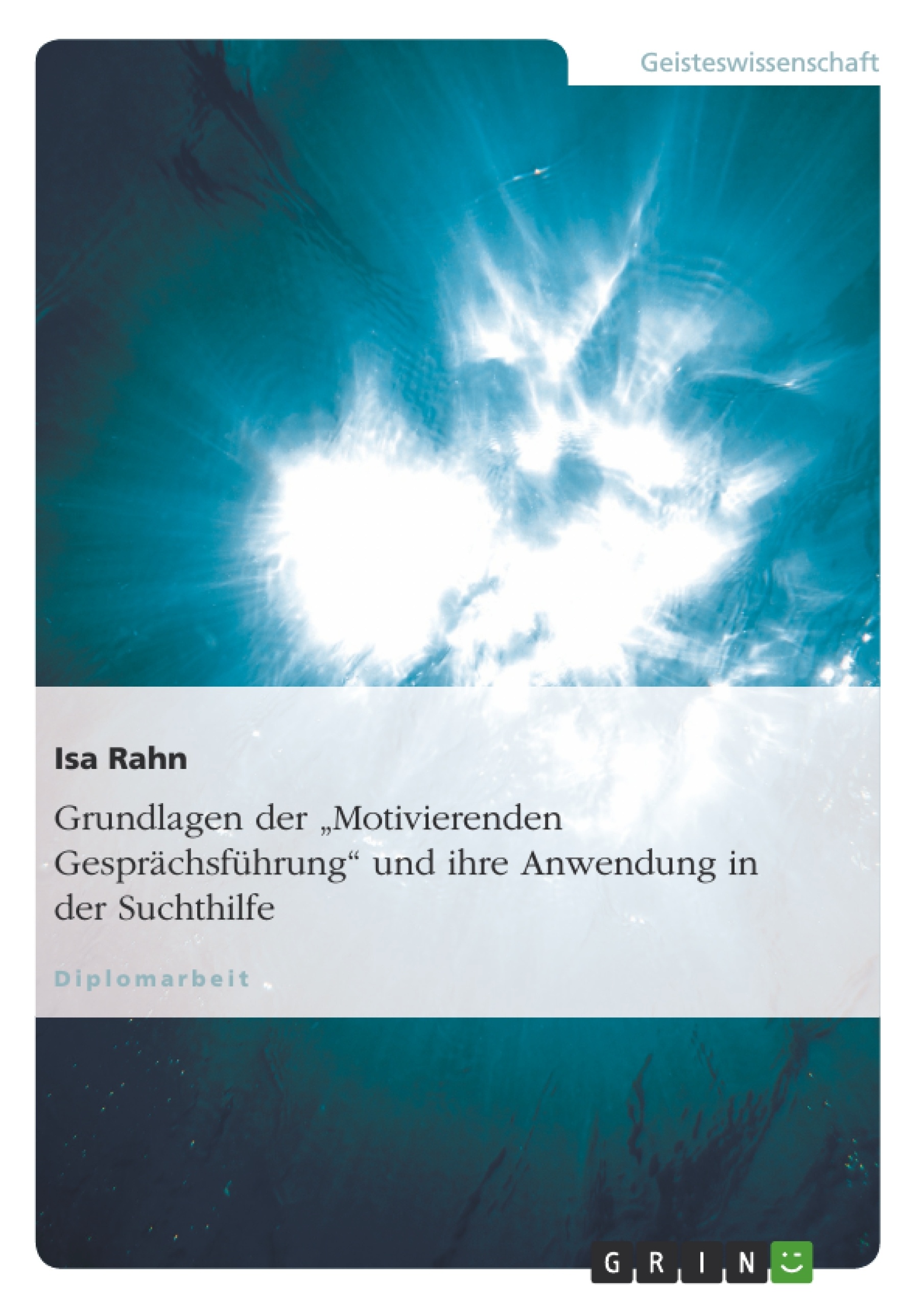Mit der Übersetzung von Millers und Rollnicks „Motivational Interviewing. Preparing people to change addictive behavior“ und Kellers Einführung des Transtheoretischen Modell der intentionalen Verhaltensänderung in den deutschsprachigen Raum (beides 1999) bekam der in Deutschland schon von einigen Suchtexperten ab Mitte der 80er Jahre angeschobene Diskurs um den Stellenwert von Veränderungsmotivation und Motivationsförderung für eine möglichst früh einsetzende effektive Behandlung von Abhängigkeitskranken und –gefährdeten Auftrieb. Ohne an dieser Stelle die vielen Für und Wider des Diskurses um Krankheits-, Bewältigungs- und Motivationsmodelle, um Abstinenz als höchstes Ziel und Zieloffenheit, um weltanschauliche und wissenschaftliche Ansichten auszuführen, sei darauf hingewiesen, dass dieser Diskurs bei weitem noch nicht beendet ist. Trotzdem kann mittlerweile von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden. Moderne Suchtprävention und –behandlung nutzt ein verändertes Motivationskonzept: Motivation wird nicht als quantitativer Status, sondern interaktioneller Prozess und Motivation nicht Behandlungsvoraussetzung, sondern als (zentraler) Teil der Behandlung angesehen. Anstelle von Motivationsprüfungen und –hürden geht es darum, Veränderungsschritte früh zu fördern und so viel Unterstützung wie möglich anzubieten unter Wahrung der Autonomie und der Würde des Klienten. In den Blick der Suchthilfe kommen nun auch Personen mit riskantem Substanzkonsumverhalten, um hier früh die Auseinandersetzung mit dem Verhalten anzuregen, um letztlich möglichen (weiteren) Störungen vorzubeugen.
Zur Förderung von Veränderungsmotivation bietet sich insbesondere der Ansatz der „Motivierenden Gesprächsführung“ an. Dieser aus der Praxis heraus entstandene und als überwiegend wirksam erprobte Ansatz zieht sozialpsychologische Theorien und sozial-kognitive Lerntheorien heran, um zu verstehen, wie sich Verhalten und Einstellungen entwickeln und sich gegenseitig beeinflussen. Ebenso wie die theoretischen Grundlagen sind auch die methodischen Umsetzungen Kombinationen aus verschiedenen Therapie- und Beratungsrichtungen. Die theoretischen Erklärungen des Ansatzes scheinen entwicklungsbedürftig in Richtung einer klareren aus den verwendeten Theorien logisch folgenden Beschreibung; in der Praxis etabliert sich „Motivierende Gesprächsführung“ auch außerhalb der Suchthilfe in weiten Teilen der Früherkennung und Frühintervention bei gesundheitsgefährdendem Verhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einführung
- 1 Theoretischer Kontext der „Motivierenden Gesprächsführung“
- 1.1 Kognitive Dissonanztheorie
- 1.2 Motivationspsychologische Überlegungen
- 1.3 Theorie der psychologischen Reaktanz
- 1.4 Selbstwirksamkeitstheorie
- 1.5 Selbstwahrnehmungstheorie
- 1.6 Selbstregulationstheorie
- 1.7 Transtheoretisches Modell der intentionalen Verhaltensänderung
- 1.8 Klientenzentrierte Therapie
- 1.9 Zusammenfassung der Grundannahmen und -haltung
- 1.9.1 Grundannahmen
- 1.9.2 Grundhaltung
- 2 Prinzipien, Methoden und Ablauf der „Motivierenden Gesprächsführung“
- 2.1 Der Ansatz im Überblick
- 2.2 Interventionsprinzipien
- 2.3 Basismethoden
- 2.4 Spezielle Methoden
- 2.5 Ablauf / Phasen
- 2.6 Grenzen des Ansatzes
- 3 Anwendung und Wirksamkeit in der Suchthilfe
- 3.1 Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten (FRED)
- 3.2 Motivational Case Management (MOCA)
- 4 Schlussfolgerungen
- 4.1 Zur Theorie und Methode
- 4.2 Zur Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung und deren Anwendung in der Suchthilfe. Ziel ist es, den theoretischen Kontext der Methode zu beleuchten und ihre praktische Wirksamkeit zu evaluieren. Die Arbeit analysiert verschiedene motivationspsychologische Theorien und Modelle, die der Motivierenden Gesprächsführung zugrunde liegen.
- Theoretische Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung
- Prinzipien und Methoden der Motivierenden Gesprächsführung
- Anwendung der Motivierenden Gesprächsführung in der Suchthilfe
- Wirksamkeit der Motivierenden Gesprächsführung
- Grenzen der Motivierenden Gesprächsführung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beschreibt den Wandel in der Suchtbehandlung, weg von den traditionellen, konfrontativen Methoden hin zu motivationsfördernden Ansätzen. Sie betont die Bedeutung frühzeitiger Interventionen und kritisiert die frühere Praxis, die eine hohe intrinsische Motivation als Voraussetzung für eine Behandlung ansah. Der Text führt das "Motivational Interviewing" und das Transtheoretische Modell als wichtige Entwicklungen in diesem Bereich ein, die den Fokus auf die Förderung der Veränderungsmotivation legen.
1 Theoretischer Kontext der „Motivierenden Gesprächsführung“: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung. Es beleuchtet verschiedene motivationspsychologische Theorien wie die Kognitive Dissonanztheorie, die Theorie der psychologischen Reaktanz, die Selbstwirksamkeitstheorie, die Selbstwahrnehmungstheorie und die Selbstregulationstheorie, um das Verständnis der menschlichen Motivation und des Veränderungsprozesses zu vertiefen. Zusätzlich wird das Transtheoretische Modell und die Klientenzentrierte Therapie als relevante Bezugstheorien eingeführt und in ihren Grundannahmen und der Grundhaltung beschrieben. Der Bezug dieser Theorien zur Motivierenden Gesprächsführung wird hergestellt.
2 Prinzipien, Methoden und Ablauf der „Motivierenden Gesprächsführung“: Dieses Kapitel beschreibt die Prinzipien, Methoden und den Ablauf der Motivierenden Gesprächsführung. Es erläutert die zentralen Interventionsprinzipien wie Empathie, das Entwickeln von Diskrepanzen, das Umlenken von Widerstand und die Förderung von Selbstwirksamkeit. Es werden sowohl Basismethoden wie aktives Zuhören, offene Fragen, Bestätigung und Zusammenfassen, als auch spezielle Methoden wie Brainstorming, Skalierungen, Reframing und das Imaginieren zukünftiger Veränderungen vorgestellt. Der Ablauf der Motivierenden Gesprächsführung wird in Phasen unterteilt und detailliert erklärt, wobei der Fokus auf dem Aufbau von Änderungsbereitschaft und der Stärkung der Selbstverpflichtung zur Veränderung liegt. Schliesslich werden die Grenzen des Ansatzes diskutiert.
3 Anwendung und Wirksamkeit in der Suchthilfe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anwendung und Wirksamkeit der Motivierenden Gesprächsführung in der Suchthilfe. Es werden konkrete Beispiele wie die Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten (FRED) und das Motivational Case Management (MOCA) vorgestellt und analysiert, um die praktische Umsetzung der Methode zu veranschaulichen und deren Wirksamkeit zu belegen. Die Kapitel beleuchten die Anwendung der Theorie aus Kapitel 1 und 2 auf den Bereich der Suchthilfe.
Schlüsselwörter
Motivierende Gesprächsführung, Suchthilfe, Motivationspsychologie, Verhaltensänderung, Kognitive Dissonanz, Selbstwirksamkeit, Transtheoretisches Modell, Klientenzentrierte Therapie, Interventionsprinzipien, Methoden, Wirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Motivierende Gesprächsführung in der Suchthilfe
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Motivierende Gesprächsführung (MG) und deren Anwendung in der Suchthilfe. Sie beleuchtet den theoretischen Kontext der MG, analysiert verschiedene motivationspsychologische Theorien, die ihr zugrunde liegen, und evaluiert ihre praktische Wirksamkeit. Die Arbeit umfasst eine Einführung, Kapitel zu den theoretischen Grundlagen der MG, ihren Prinzipien und Methoden, ihrer Anwendung in der Suchthilfe (mit Beispielen wie FRED und MOCA) und abschließende Schlussfolgerungen.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf diverse motivationspsychologische Theorien, darunter die Kognitive Dissonanztheorie, die Theorie der psychologischen Reaktanz, die Selbstwirksamkeitstheorie, die Selbstwahrnehmungstheorie, die Selbstregulationstheorie und das Transtheoretische Modell. Zusätzlich wird die klientenzentrierte Therapie als relevante Bezugstheorie eingebunden.
Welche Prinzipien und Methoden der Motivierenden Gesprächsführung werden erklärt?
Die Arbeit beschreibt zentrale Interventionsprinzipien wie Empathie, das Entwickeln von Diskrepanzen, das Umlenken von Widerstand und die Förderung von Selbstwirksamkeit. Es werden sowohl Basismethoden (aktives Zuhören, offene Fragen, Bestätigung, Zusammenfassen) als auch spezielle Methoden (Brainstorming, Skalierungen, Reframing, Imaginieren zukünftiger Veränderungen) vorgestellt. Der Ablauf der MG wird in Phasen unterteilt und detailliert erklärt.
Wie wird die Motivierende Gesprächsführung in der Suchthilfe angewendet?
Die Arbeit zeigt die Anwendung der MG in der Suchthilfe anhand konkreter Beispiele wie der Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten (FRED) und dem Motivational Case Management (MOCA). Die praktische Umsetzung der Methode wird veranschaulicht und ihre Wirksamkeit belegt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Theorie und Methode der MG sowie zu ihrer praktischen Anwendung in der Suchthilfe. Diese beziehen sich auf die Wirksamkeit, die Grenzen und den erfolgreichen Einsatz der MG in der Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Motivierende Gesprächsführung, Suchthilfe, Motivationspsychologie, Verhaltensänderung, Kognitive Dissonanz, Selbstwirksamkeit, Transtheoretisches Modell, Klientenzentrierte Therapie, Interventionsprinzipien, Methoden, Wirksamkeit.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Einführung, Theoretischer Kontext der „Motivierenden Gesprächsführung“, Prinzipien, Methoden und Ablauf der „Motivierenden Gesprächsführung“, Anwendung und Wirksamkeit in der Suchthilfe und Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel ist weiter unterteilt in Unterkapitel, die im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt sind.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung zu untersuchen und ihre Anwendung in der Suchthilfe zu beleuchten. Es soll der theoretische Kontext der Methode verdeutlicht und ihre praktische Wirksamkeit evaluiert werden.
- Quote paper
- Isa Rahn (Author), 2007, Grundlagen der "Motivierenden Gesprächsführung" und ihre Anwendung in der Suchthilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94435