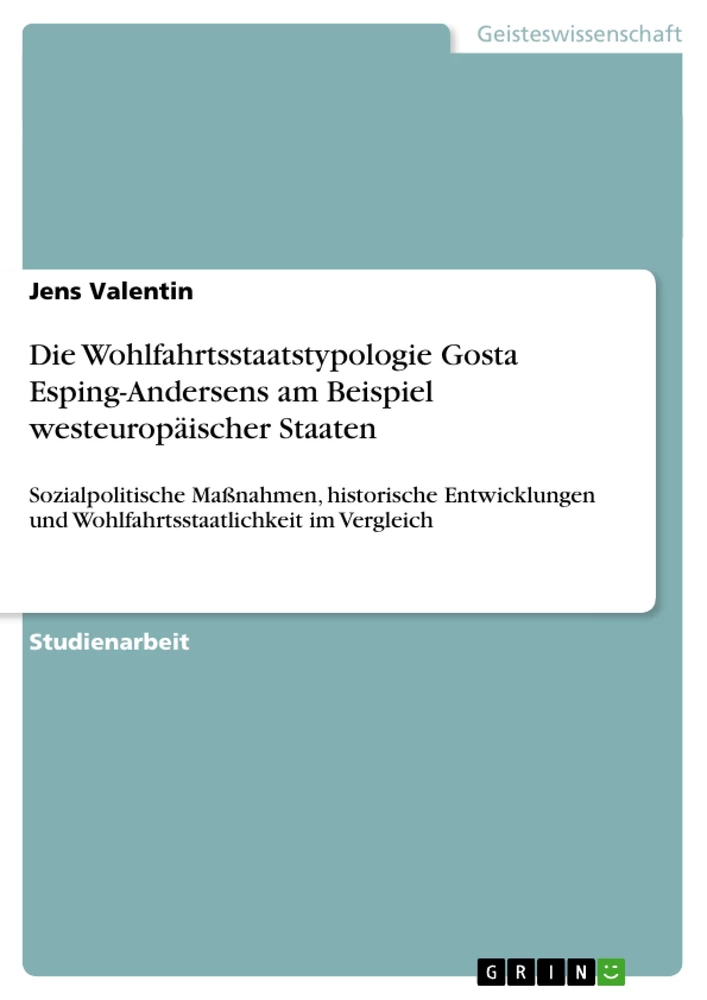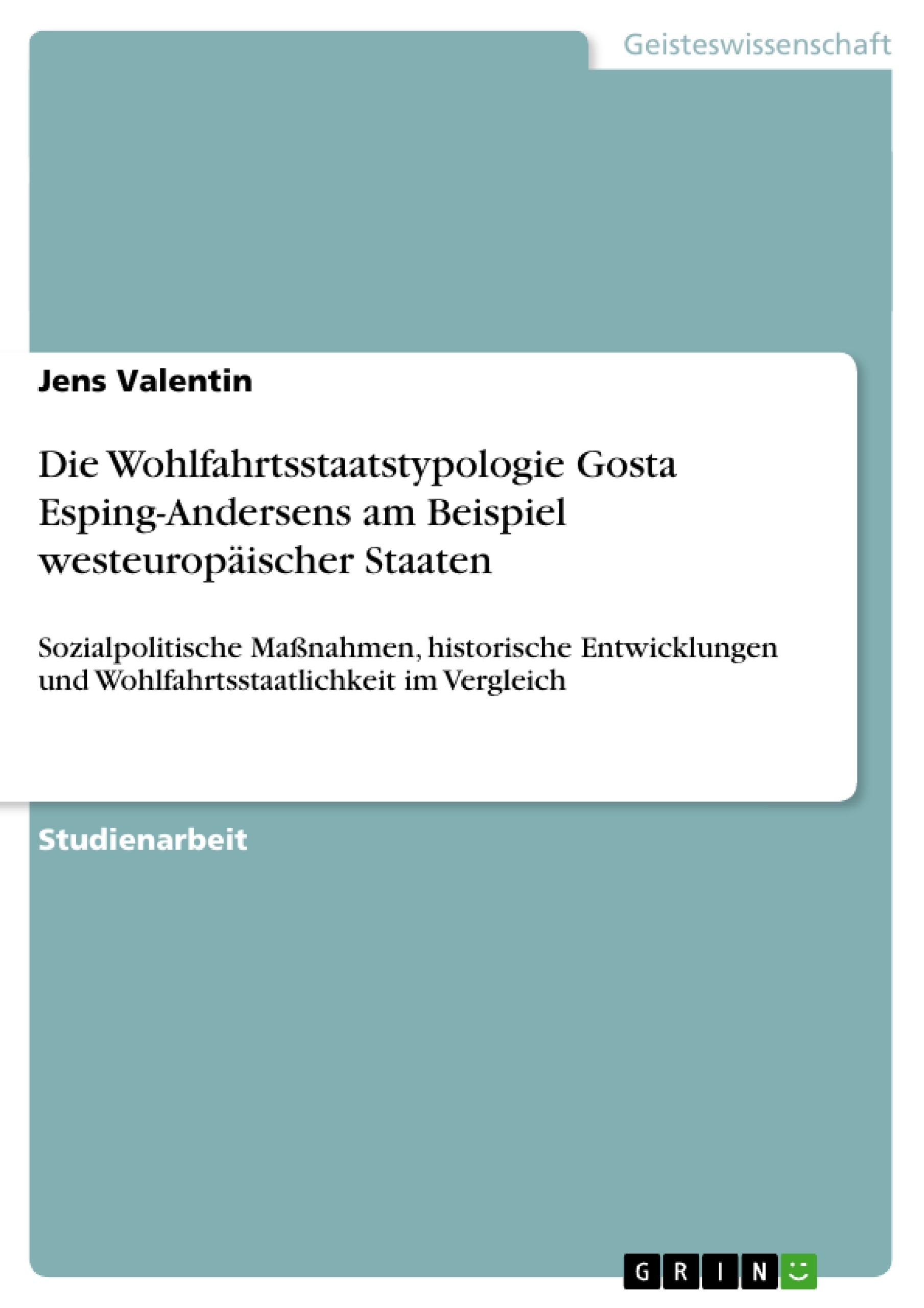Diese wissenschaftliche Arbeit widmet sich dem Thema Wohlfahrtsstaatlichkeit in europäi-schen Nationen unter dem Aspekt der Wohlfahrtsstaatstypologie des dänischen Soziologen Gosta Esping-Andersen. Innerhalb seiner Wohlfahrtsstaatstypologie unterscheidet Esping-Andersen drei Typen von Wohlfahrtsstaaten: den konservativen Typen, den liberalen Typen und den sozialdemokratischen Typen. Diese drei Wohlfahrtstypen sollen in der vorliegenden Arbeit anhand eines jeweils prototypischen Staates (Deutschland, England und Schweden) theoretisch sowie praktisch dargestellt werden.
Die wissenschaftliche Arbeit bezieht sich dabei lediglich auf Wohlfahrtsstaaten innerhalb Europas und klammert supranationale Wohlfahrtsstaatlichkeit aus. Auf komplexe politische Diskurse bezüglich der Sozialpolitik soll ebenfalls verzichtet werden, da es sich um eine so-ziologische Analyse der Wohlfahrtsstaatlichkeit handelt und eine detaillierte Beschreibung sozialpolitischer Instrumente und Prozesse wohl eher in den Bereich einer politikwissen-schaftlichen Arbeit fallen würde. Dennoch kann auch hierbei nicht komplett auf eine prägnan-te (historische sowie circa-aktuelle) Beschreibung der sozialpolitischen Instrumentatrien ver-zichtet werden, um die drei Wohlfahrtsstaattypen in ihrer Differenziertheit und Affinität zu kennzeichnen.
2 Was ist ein Wohlfahrtsstaat?
Bevor eingehender auf die Wohlfahrtsstaatstypologie Esping-Andersons eingegangen wird, soll ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand des Begriffes „Wohlfahrtsstaat“ in sozial-wissenschaftlicher Sicht dargestellt werden. Dabei ist sofort anzumerken, das bezüglich dieses Begriffes eine Fülle von diffusen Definitionen existieren. Generell aber herrscht eine Über-einstimmung darüber, „dass das Wort einen Wandel des Staatsbegriffes, genauer gesagt einen Zuwachs an Staatsaufgaben anzeigt“ .
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Wohlfahrtsstaat?
- Das Modell Esping Andersens
- Der Begriff „Wohlfahrtsstaat“ bei Esping-Andersen und konzeptionelle Vorgängermodelle:
- Typologisierende Kriterien Esping-Andersens:
- Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus:
- Vertreter der Regime-Typen:
- Deutschland als Vertreter des konservativen Wohlfahrtsstaatstyps:
- Historischer Abriss
- Strukturmerkmale des deutschen Wohlfahrtsstaates
- England als Vertreter des liberalen Wohlfahrtsstaatstyps:
- Historischer Abriss
- Strukturmerkmale des britischen Wohlfahrtsstaates
- Schweden als Vertreter des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatstyps:
- Historischer Abriss
- Strukturmerkmale des schwedischen Wohlfahrtsstaates
- Deutschland als Vertreter des konservativen Wohlfahrtsstaatstyps:
- Vergleichende methodische Darstellung der prototypischen Wohlfahrtsstaaten in Bezug auf De-Kommodifizierung und De-Stratifizierung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wohlfahrtsstaatlichkeit in westeuropäischen Nationen anhand der Typologie Gosta Esping-Andersens. Ziel ist die Darstellung der drei Wohlfahrtstypen (konservativ, liberal, sozialdemokratisch) anhand prototypischer Staaten (Deutschland, England, Schweden).
- Die Wohlfahrtsstaatstypologie Esping-Andersens
- Charakteristika der drei Wohlfahrtstypen (konservativ, liberal, sozialdemokratisch)
- Vergleichende Analyse der ausgewählten Staaten
- Historische Entwicklung der Sozialpolitik in den jeweiligen Staaten
- Konzeptionelle Ansätze zum Wohlfahrtsstaat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Wohlfahrtsstaatlichkeit in europäischen Nationen ein und beschreibt den Fokus auf Esping-Andersens Typologie mit ihren drei Wohlfahrtstypen: konservativ, liberal und sozialdemokratisch. Die Arbeit konzentriert sich auf einen Vergleich dieser Typen anhand prototypischer Staaten und klammert supranationale Aspekte und detaillierte sozialpolitische Diskurse aus, wobei dennoch eine prägnante Darstellung historischer und aktueller sozialpolitischer Instrumente erfolgt.
Was ist ein Wohlfahrtsstaat?: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene sozialwissenschaftliche Definitionen des Begriffs „Wohlfahrtsstaat“. Es werden drei Interpretationen vorgestellt: die Fokussierung auf Leistungen für die ärmsten Bevölkerungsschichten, die Betonung von Arbeitsrecht und Sozialversicherung sowie die Hervorhebung der sozialen Verantwortung des Staates für alle Bürger. Die Arbeit orientiert sich an der universalistischen Ausrichtung des Wohlfahrtsstaats, die alle drei Ansätze in gewisser Weise beinhaltet und sich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte widerspiegelt. Der Kapitel schließt mit einer eigenen Definition des Begriffs, die politische und soziale Komponenten des Wohlfahrtsstaates berücksichtigt.
Das Modell Esping Andersens: Dieses Kapitel beschreibt Esping-Andersens Wohlfahrtsstaatstypologie. Es diskutiert zunächst seine Definition des Wohlfahrtsstaates und bezieht sich auf konzeptionelle Vorgänger wie Therborn und Titmuss. Titmuss' Unterscheidung zwischen residualen, leistungsbasierten und institutionellen Wohlfahrtsstaaten bildet die Grundlage für Esping-Andersens Typologie. Das Kapitel führt anschließend die typologisierenden Kriterien von Esping-Andersen ein, die auf Titmuss' Arbeit aufbauen und diese empirisch und theoretisch erweitern.
Vertreter der Regime-Typen: Dieses Kapitel präsentiert Deutschland, England und Schweden als prototypische Vertreter der konservativen, liberalen und sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatstypen. Für jeden Staat wird ein historischer Abriss gegeben und die Strukturmerkmale des jeweiligen Wohlfahrtsstaates analysiert. Der Vergleich dieser drei Fallbeispiele soll die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Wohlfahrtssysteme verdeutlichen und die Anwendung von Esping-Andersens Typologie veranschaulichen.
Vergleichende methodische Darstellung der prototypischen Wohlfahrtsstaaten in Bezug auf De-Kommodifizierung und De-Stratifizierung: Dieses Kapitel vergleicht die drei prototypischen Wohlfahrtsstaaten bezüglich ihrer Strategien der De-Kommodifizierung (Entkopplung des Zugangs zu sozialen Gütern von Marktkriterien) und De-Stratifizierung (Reduktion sozialer Ungleichheit). Es analysiert, wie die jeweiligen Systeme den Zugang zu sozialen Leistungen gestalten und inwieweit sie soziale Unterschiede abbauen.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen, Wohlfahrtsstaatstypologie, konservativer Wohlfahrtsstaat, liberaler Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, De-Kommodifizierung, De-Stratifizierung, Sozialpolitik, Deutschland, England, Schweden, Sozialstaat, Welfare State.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse der Wohlfahrtsstaatstypen nach Esping-Andersen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Wohlfahrtsstaatlichkeit in westeuropäischen Nationen, insbesondere Deutschland, England und Schweden, anhand der Typologie von Gøsta Esping-Andersen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der drei Wohlfahrtstypen (konservativ, liberal, sozialdemokratisch) und deren charakteristischen Merkmalen.
Welche Wohlfahrtsstaatstypen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die drei Wohlfahrtsstaatstypen nach Esping-Andersen: den konservativen (vertreten durch Deutschland), den liberalen (vertreten durch England) und den sozialdemokratischen Typus (vertreten durch Schweden).
Welche Kriterien verwendet Esping-Andersen für seine Typologie?
Esping-Andersens Typologie basiert auf den Kriterien der De-Kommodifizierung (Entkopplung des Zugangs zu sozialen Gütern von Marktkriterien) und der De-Stratifizierung (Reduktion sozialer Ungleichheit). Diese bauen auf den konzeptionellen Vorgängermodellen von Therborn und Titmuss auf, insbesondere Titmuss' Unterscheidung zwischen residualen, leistungsbasierten und institutionellen Wohlfahrtsstaaten.
Wie werden die ausgewählten Länder verglichen?
Der Vergleich der drei Länder (Deutschland, England, Schweden) erfolgt anhand ihrer historischen Entwicklung der Sozialpolitik, der Strukturmerkmale ihrer jeweiligen Wohlfahrtssysteme und ihrer Strategien zur De-Kommodifizierung und De-Stratifizierung. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Wohlfahrtssysteme.
Welche Definition des Wohlfahrtsstaates wird verwendet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene sozialwissenschaftliche Definitionen des Wohlfahrtsstaates und orientiert sich an einer universalistischen Ausrichtung, die die soziale Verantwortung des Staates für alle Bürger betont. Die eigene Definition der Arbeit berücksichtigt sowohl politische als auch soziale Komponenten des Wohlfahrtsstaates.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Was ist ein Wohlfahrtsstaat?, Das Modell Esping-Andersen, Vertreter der Regime-Typen, Vergleichende methodische Darstellung der prototypischen Wohlfahrtsstaaten in Bezug auf De-Kommodifizierung und De-Stratifizierung, Fazit und Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen, Wohlfahrtsstaatstypologie, konservativer Wohlfahrtsstaat, liberaler Wohlfahrtsstaat, sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, De-Kommodifizierung, De-Stratifizierung, Sozialpolitik, Deutschland, England, Schweden, Sozialstaat, Welfare State.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Darstellung und der Vergleich der drei Wohlfahrtstypen nach Esping-Andersen anhand prototypischer Staaten. Die Arbeit soll ein Verständnis der unterschiedlichen Ausprägungen des Wohlfahrtsstaates in Westeuropa vermitteln.
Welche Aspekte werden in der Arbeit NICHT behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die drei ausgewählten Länder und ihre nationalen Wohlfahrtssysteme. Supranationale Aspekte und detaillierte sozialpolitische Diskurse werden ausgeklammert.
- Quote paper
- Jens Valentin (Author), 2007, Die Wohlfahrtsstaatstypologie Gosta Esping-Andersens am Beispiel westeuropäischer Staaten , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94411