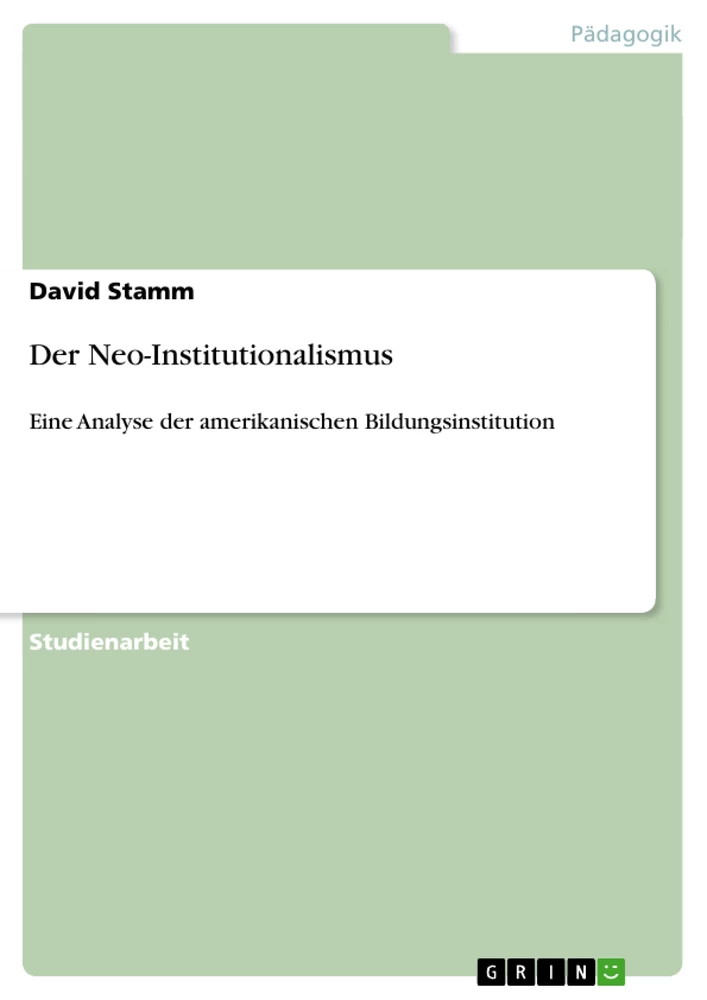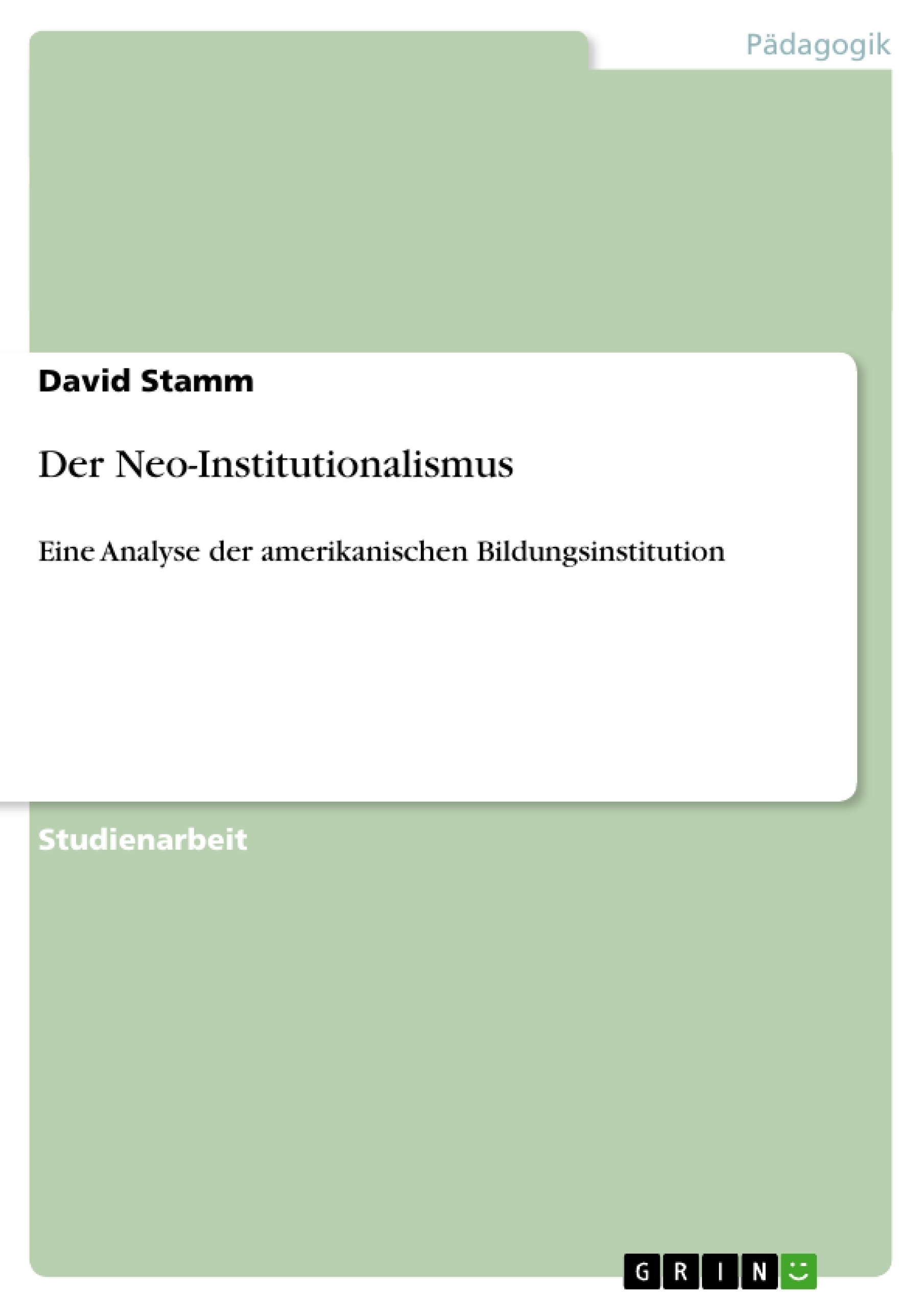Der in den 70er Jahren aufkommende Neo-Institutionalismus ist eine Weiterentwicklung der Theorie des Institutionalismus. Um die zentralen Begrifflichkeiten und Problemfelder des Neo-Institutionalismus zu verstehen ist es unabdingbar sich dessen Ursprung vor Augen zu halten.
Die Theorie des Institutionalismus findet ihre Wurzeln in der Organisationssoziologie. Der Grundstein hat Emil Durkheim gelegt. In seiner Arbeit „Die Regeln der soziologischen Methode“ werden die Institutionen als „Glaubensvorstellungen und durch die Gesellschaft festgesetzte […] Verhaltensweisen“ charakterisiert (Durkheim 1999: 100). Die Institutionen gelten seither als die Stützpfeiler der Gesellschaft. Der zweite Gründungsvater des Institutionalismus ist Max Weber. Dessen „idealtypische Darstellung der Bürokratischen Organisation gilt bis heute als die erste profunde organisationssoziologische Arbeit“ (Senge/Hellmann 2006: 9). Begriffe wie Bürokratie, Macht, Herrschaft, Autorität und Legitimität stehen im Zentrum der weberischen Organisationssoziologie. Mit diesem gesamtgesellschaftlichen Interessenspektrum schafft Weber ein neues Forschungsterrain für eine ganze Generation von Soziologen. So gewinnt in den 50er Jahren die Stellung der Organisationen für die moderne Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Gesellschafts-wissenschaftler wie Robert Merton, Philip Selznick, Talcott Parsons und andere treiben die Theorie voran. Ein neues Paradigma entsteht. Die Organisationen werden nicht mehr als von der Gesellschaft isolierte Einzelphänomene betrachtet, sondern stets in ihren komplexen und kontextuellen gesellschaftlichen Zusammenhängen (Senge/Hellmann 2006:11).
Diese in den Arbeiten der „Old Institutionalists “ dargelegten Theorien zum Gegenstand „Organisation“ wurden ihrerseits von einer neuen Generation von Wissenschaftler gegen Mitte der 70er Jahren aufgenommen und in einigen Aspekten neu formuliert. Abstand zur politischen Soziologie zeichnet der neue Ansatz aus. Konflikte und Interessensunterschiede werden weniger betont, dafür bestärkt die Homogenität zwischen Organisationen und ihrem institutionellen Umfeld.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. METHODOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN
- 2. GRAMMAR OF SCHOOLING
- 2.1 REFORMZYKLUS.
- 2.2 WIE DIE SCHULE DIE REFORMEN ÄNDERT
- 2.3 REFORMINSTITUTIONALISIERUNG
- 3. DAS BILDUNGSSYSTEM, EINE INSTITUTIONALISIERTE ORGANISATION.
- 3.1 DER RATIONALITÄTSMYTHOS IN DER BILDUNGSORGANISATION
- 3.2 ISOMORPHE PROZESSE IN DER BILDUNGSORGANISATION.....
- 4. DER INSTITUTIONELLE WANDEL IM BILDUNGSSYSTEM.
- 4.1 ZU EINER MARKTGERECHTEN BILDUNG
- 4.2 ZU EINER STANDARDISIERTEN BILDUNG
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wandel der amerikanischen Bildungsinstitution in den letzten 30 Jahren. Sie untersucht, wie sich die Institution Schule im Kontext des Neo-Institutionalismus entwickelt und wie sich die „Grammar of Schooling“ auf die Reformzyklen im Bildungssystem auswirkt.
- Der Neo-Institutionalismus und seine Entstehung
- Die „Grammar of Schooling“ und ihre Bedeutung für Reformen
- Die Rolle der kognitiven Institutionen im Bildungssystem
- Der Einfluss von Isomorphen Prozessen auf die Bildungsorganisation
- Die Herausforderungen des Wandels im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt den Leser in die Thematik des Neo-Institutionalismus und dessen Bedeutung für das Verständnis des Bildungssystems ein. Sie beleuchtet die Wurzeln des Institutionalismus und skizziert die zentralen Unterschiede zwischen dem „Old Institutionalism“ und dem Neo-Institutionalismus. Darüber hinaus wird der Begriff „Institution“ im neo-institutionalistischen Kontext erläutert und seine Bedeutung im Verhältnis von Organisation und Gesellschaft aufgezeigt.
- 1. Methodologische Überlegungen: Dieses Kapitel soll den methodischen Ansatz der vorliegenden Arbeit erläutern. Es werden die relevanten theoretischen Ansätze vorgestellt und die verwendeten Forschungsmethoden näher beleuchtet.
- 2. Grammar of Schooling: Dieses Kapitel untersucht die „Grammar of Schooling“, also die grundlegenden Regeln und Mechanismen, die das Bildungssystem prägen. Es beleuchtet die Reformzyklen im Bildungssystem und analysiert, wie die Schule selbst auf Reformen reagiert. Der Fokus liegt auf der „Reformintitutionalisierung“ und deren Einfluss auf die Organisation des Bildungssystems.
- 3. Das Bildungssystem, eine institutionalisierte Organisation: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bildungssystem als einer institutionalisierten Organisation. Es untersucht den „Rationalitätsmythos“ in der Bildungsorganisation und analysiert die isomorphen Prozesse, die zu einer zunehmenden Angleichung der Bildungseinrichtungen führen.
- 4. Der institutionelle Wandel im Bildungssystem: Dieses Kapitel untersucht den institutionellen Wandel im Bildungssystem, insbesondere die Entwicklung hin zu einer marktorientierten und standardisierten Bildung. Es analysiert die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Organisation und Struktur des Bildungssystems.
Schlüsselwörter
Neo-Institutionalismus, Bildungsinstitution, Grammar of Schooling, Reformzyklen, kognitiven Institutionen, isomorphe Prozesse, Rationalitätsmythos, Marktorientierung, Standardisierung
- Quote paper
- David Stamm (Author), 2007, Der Neo-Institutionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94252