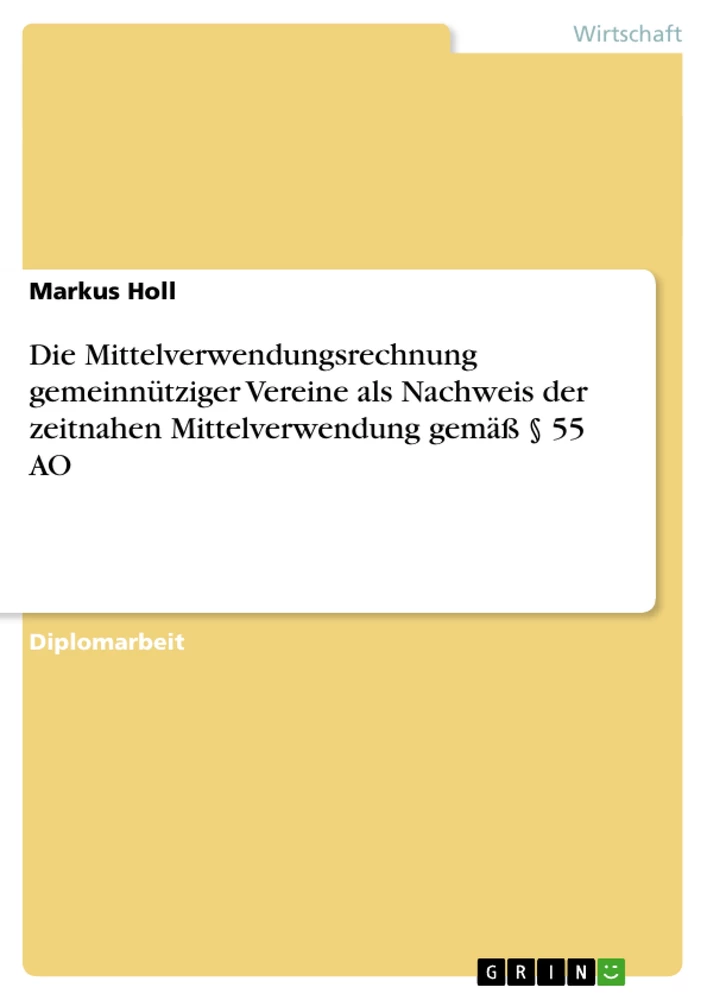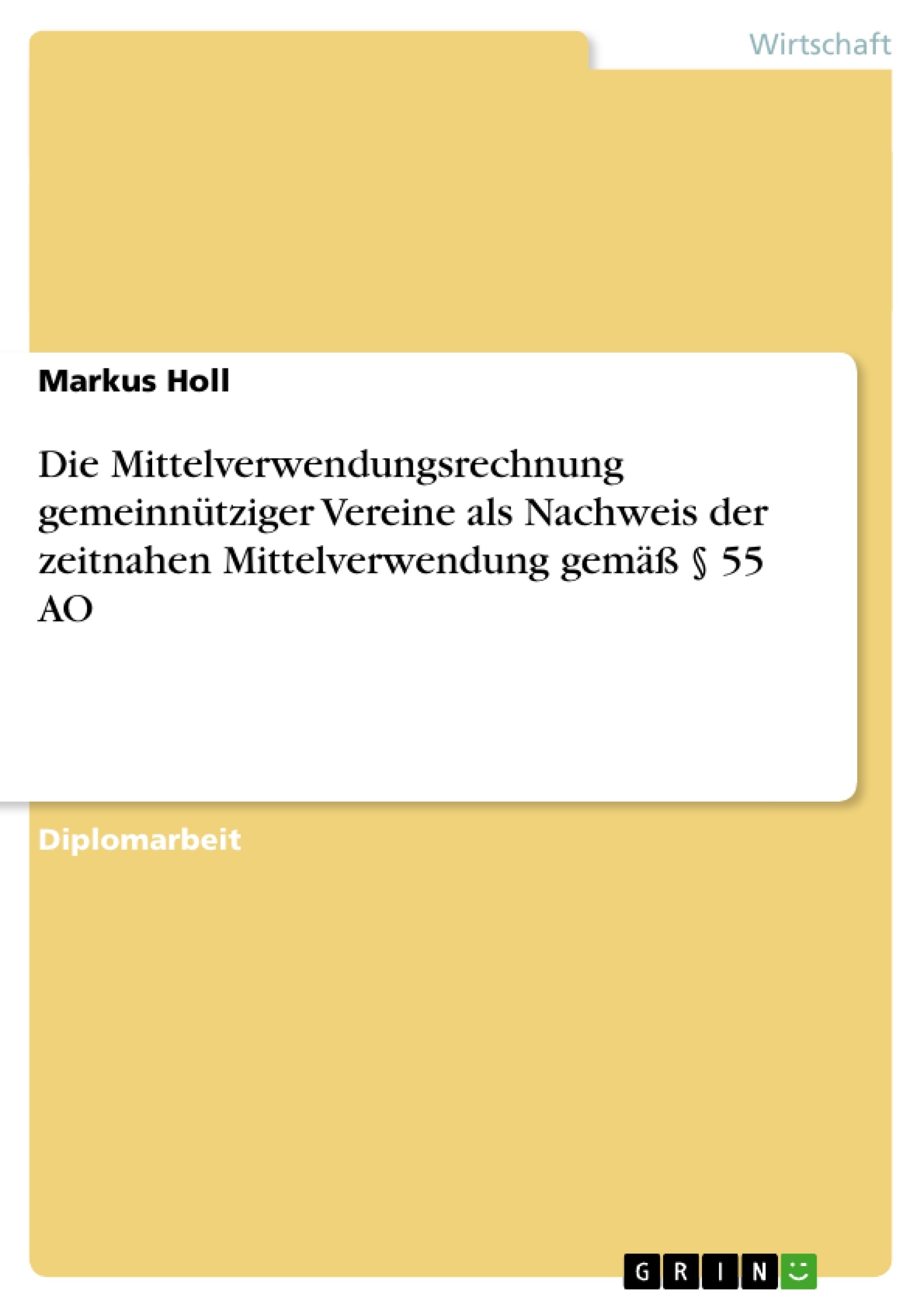Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in der BRD werden von Vereinen organisiert, gefördert oder unterstützt. Sie übernehmen überwiegend Aufgaben, die den staatlichen Aufgaben nahe stehen. Vor allem die private Förderung von Kultur, Sport, Umweltschutz und vielen anderen nicht wirtschaftlichen Bereichen wird durch Vereine organisiert. Außerdem werden Vereine in Bereichen tätig, in denen sich der Staat zurück halten muss, zum Beispiel im Bereich der Religion. Damit diese Vereine ihre Aufgaben möglichst effizient und unbürokratisch erfüllen können, haben sie die Möglichkeit vom Staat als gemeinnützig anerkannt zu werden. Ist ein Verein als gemeinnützig anerkannt, kann er einige Vorteile wie zum Beispiel Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen. Durch diese Privilegien soll verhindert werden, dass auf die Erträge des Vereins zugegriffen wird, damit die Aktivitäten des Vereins nicht eingeschränkt werden. Ein Verstoß gegen das Gebot der gleichmäßigen Besteuerung liegt hierbei nicht vor, da der Staat Steuermittel einsetzen müsste, wenn die staatliche Entlastung durch den Verein wegfallen würde1.
Die Bedeutung von Vereinen wird deutlich wenn man sich ihre Ausbreitung in Deutschland anschaut. Nach einer Erhebung der V&M Service GmbH in Konstanz gab es in Deutschland im Jahr 2005 594.277 eingetragene Vereine2. Da in dieser Erhebung nur Vereine berücksichtigt wurden, die im Vereinsregister eingetragen sind, fehlen dementsprechend nicht eingetragene Vereine, Stiftungen, Klubs, Genossenschaften und gGmbHs. Die meisten Vereine sind mit rund 225.000 im sportlichen Bereich tätig. Auch die Bereiche Freizeit/Heimatpflege/Brauchtumspflege oder Soziales/Wohlfahrt/Religion erfreuen sich in Deutschland einer großen Beliebtheit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Begriffsabgrenzung
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2. Gemeinnützige Vereine
- 2.1 Einordnung in den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang
- 2.2 Allgemeines zum Verein
- 2.2.1 Wirtschaftlicher Verein
- 2.2.2 Idealverein
- 2.2.2.1 Rechtsfähiger Verein
- 2.2.2.2 Nicht rechtsfähiger Verein
- 2.2.3 Die Tätigkeitsbereiche des Vereins
- 2.2.3.1 Ideeller Bereich
- 2.2.3.2 Vermögensverwaltung
- 2.2.3.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
- 2.2.3.4 Zweckbetrieb
- 2.3 Gemeinnützigkeit
- 2.3.1 Begünstigte Zwecke
- 2.3.1.1 Gemeinnützige Zwecke
- 2.3.1.2 Mildtätige Zwecke
- 2.3.1.3 Kirchliche Zwecke
- 2.3.2 Allgemeinheit
- 2.3.3 Ausschließlichkeit
- 2.3.4 Unmittelbarkeit
- 2.3.5 Selbstlosigkeit
- 2.4 Die Rechnungslegung
- 2.4.1 Gesetzliche Vorschriften
- 2.4.2 Bestandteile des Jahresabschlusses
- 2.4.2.1 Gewinnermittlung
- 2.4.2.2 Vermögensdarstellung
- 2.4.2.3 Sonstiges
- 3. Die Mittelverwendungsrechnung
- 3.1 Der Begriff der Mittel
- 3.2 Zeitnahe Mittelverwendung
- 3.3 Ausnahmen der zeitnahen Mittelverwendung
- 3.3.1 Ausstattungskapital (Zuführung zum Vermögen)
- 3.3.2 Nutzungsgebundenes Kapital
- 3.3.3 Rücklagen
- 3.3.3.1 Ermittlung des Rücklagenvolumens
- 3.3.3.2 Qualifizierung von Rücklagen
- 3.3.3.3 Abzinsung von Rücklagen
- 3.3.3.4 Rücklagen nach § 58 Nr. 6 AO
- 3.3.3.5 Rücklagen nach § 58 Nr. 7 a AO
- 3.3.3.6 Rücklagen nach § 58 Nr. 7 b AO
- 3.3.3.7 Sonstige Rücklagen
- 3.3.3.7.1 Rücklage in der Vermögensverwaltung
- 3.3.3.7.2 Rücklage im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
- 3.3.3.7.3 Rücklage für Steuern
- 3.3.3.7.4 Rücklage für Satzungsdarlehen
- 3.3.4 Sonstige Ausnahmen
- 3.4 Besondere Probleme der Mittelverwendungsrechnung
- 3.4.1 Zufluss-Abfluss-Prinzip
- 3.4.2 Verwaltungskosten
- 3.4.3 Abschreibungen / Zuschreibungen
- 3.4.4 Verluste im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
- 3.4.5 Verluste in der Vermögensverwaltung
- 3.5 Rechnerische Darstellung der Mittelverwendungsrechnung
- 3.5.1 Darstellung nach Buchna
- 3.5.2 Darstellung nach Thiel
- 3.5.3 Beispielfall
- 3.5.3.1 Sachverhalt
- 3.5.3.2 Berechnung nach Buchna
- 3.5.3.3 Berechnung nach Thiel
- 3.5.3.4 Alternative Berechnung
- 3.6 Folgen fehlerhafter Mittelverwendung
- 3.6.1 Verlust der Gemeinnützigkeit
- 3.6.2 Aberkennung des Spendenabzuges
- 3.6.3 Steuerbelastungen
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Mittelverwendungsrechnung gemeinnütziger Vereine als Nachweis der zeitnahen Mittelverwendung gemäß § 55 AO. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen und praktischen Herausforderungen bei der Erstellung und Interpretation dieser Rechnung zu beleuchten.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Gemeinnützigkeit
- Definition und Bedeutung der zeitnahen Mittelverwendung
- Ausnahmen von der zeitnahen Mittelverwendung (z.B. Rücklagenbildung)
- Praktische Probleme bei der Erstellung der Mittelverwendungsrechnung
- Konsequenzen fehlerhafter Mittelverwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein, definiert zentrale Begriffe und beschreibt die Problemstellung sowie den methodischen Ablauf der Untersuchung. Sie legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Auseinandersetzung mit der Mittelverwendungsrechnung gemeinnütziger Vereine im Kontext des § 55 AO.
2. Gemeinnützige Vereine: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über gemeinnützige Vereine, ihre Einordnung in den gesamtwirtschaftlichen Kontext und die rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit. Es differenziert zwischen verschiedenen Vereinsarten und beleuchtet die Kriterien der Gemeinnützigkeit, wie Begünstigte Zwecke, Allgemeinheit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit und Selbstlosigkeit. Der Abschnitt zur Rechnungslegung von Vereinen liefert den notwendigen Rahmen für das Verständnis der Mittelverwendungsrechnung.
3. Die Mittelverwendungsrechnung: Das Kernstück der Arbeit. Dieses Kapitel analysiert detailliert den Begriff der Mittelverwendung, die Bedeutung der zeitnahen Mittelverwendung und die Ausnahmen davon. Es untersucht verschiedene Problemfelder wie das Zufluss-Abfluss-Prinzip, die Behandlung von Verwaltungskosten und Abschreibungen, sowie Verluste in wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und Vermögensverwaltung. Verschiedene rechnerische Darstellungsweisen werden verglichen und anhand eines Beispielfalls erläutert. Die möglichen Folgen fehlerhafter Mittelverwendung (Verlust der Gemeinnützigkeit, Aberkennung des Spendenabzugs, Steuerbelastungen) runden das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Gemeinnützige Vereine, Mittelverwendungsrechnung, § 55 AO, Zeitnahe Mittelverwendung, Rücklagen, Gemeinnützigkeit, Rechnungslegung, Steuerrecht, Spendenabzug, Jahresabschluss.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Mittelverwendungsrechnung gemeinnütziger Vereine
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich umfassend mit der Mittelverwendungsrechnung gemeinnütziger Vereine. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen und die praktischen Herausforderungen bei der Erstellung und Interpretation dieser Rechnung im Kontext des § 55 AO (Abgabenordnung).
Welche Themen werden in der Diplomarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die rechtlichen Rahmenbedingungen der Gemeinnützigkeit, die Definition und Bedeutung der zeitnahen Mittelverwendung, Ausnahmen von der zeitnahen Mittelverwendung (z.B. Rücklagenbildung), praktische Probleme bei der Erstellung der Mittelverwendungsrechnung, und die Konsequenzen fehlerhafter Mittelverwendung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (Begriffsabgrenzung, Problemstellung, Gang der Untersuchung), Gemeinnützige Vereine (Einordnung, Vereinsarten, Gemeinnützigkeitskriterien, Rechnungslegung), Die Mittelverwendungsrechnung (Begriff der Mittel, zeitnahe Mittelverwendung, Ausnahmen, Problemfelder, rechnerische Darstellungen, Folgen fehlerhafter Mittelverwendung), und Fazit und Ausblick.
Was versteht man unter "zeitnaher Mittelverwendung"?
Die zeitnahe Mittelverwendung ist ein zentrales Element der Gemeinnützigkeit und im § 55 AO geregelt. Sie beschreibt die Verpflichtung gemeinnütziger Vereine, die erhaltenen Mittel zeitnah für die satzungsgemäßen Zwecke zu verwenden.
Welche Ausnahmen von der zeitnahen Mittelverwendung gibt es?
Es gibt verschiedene Ausnahmen von der zeitnahen Mittelverwendung, beispielsweise die Bildung von Rücklagen (Ausstattungskapital, nutzungsgebundenes Kapital, Rücklagen nach § 58 Nr. 6, 7a, 7b AO und sonstige Rücklagen). Die Arbeit untersucht diese Ausnahmen detailliert.
Welche Probleme können bei der Erstellung der Mittelverwendungsrechnung auftreten?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene praktische Probleme, wie z.B. das Zufluss-Abfluss-Prinzip, die Behandlung von Verwaltungskosten und Abschreibungen, sowie Verluste im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und in der Vermögensverwaltung.
Welche Folgen hat eine fehlerhafte Mittelverwendung?
Eine fehlerhafte Mittelverwendung kann schwerwiegende Folgen haben, darunter der Verlust der Gemeinnützigkeit, die Aberkennung des Spendenabzugs und Steuerbelastungen.
Welche Arten von Vereinen werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen wirtschaftlichen Vereinen und Idealvereinen, wobei letztere weiter in rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine unterteilt werden. Die Arbeit fokussiert sich aber vor allem auf die gemeinnützigen Aspekte.
Welche Kriterien definieren Gemeinnützigkeit?
Die Arbeit erläutert die Kriterien der Gemeinnützigkeit: Begünstigte Zwecke (gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zwecke), Allgemeinheit, Ausschließlichkeit, Unmittelbarkeit und Selbstlosigkeit.
Wie wird die Mittelverwendungsrechnung rechnerisch dargestellt?
Die Arbeit vergleicht verschiedene rechnerische Darstellungsweisen der Mittelverwendungsrechnung, z.B. nach Buchna und Thiel, und erläutert diese anhand eines Beispielfalls.
- Quote paper
- Markus Holl (Author), 2008, Die Mittelverwendungsrechnung gemeinnütziger Vereine als Nachweis der zeitnahen Mittelverwendung gemäß § 55 AO, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/94111