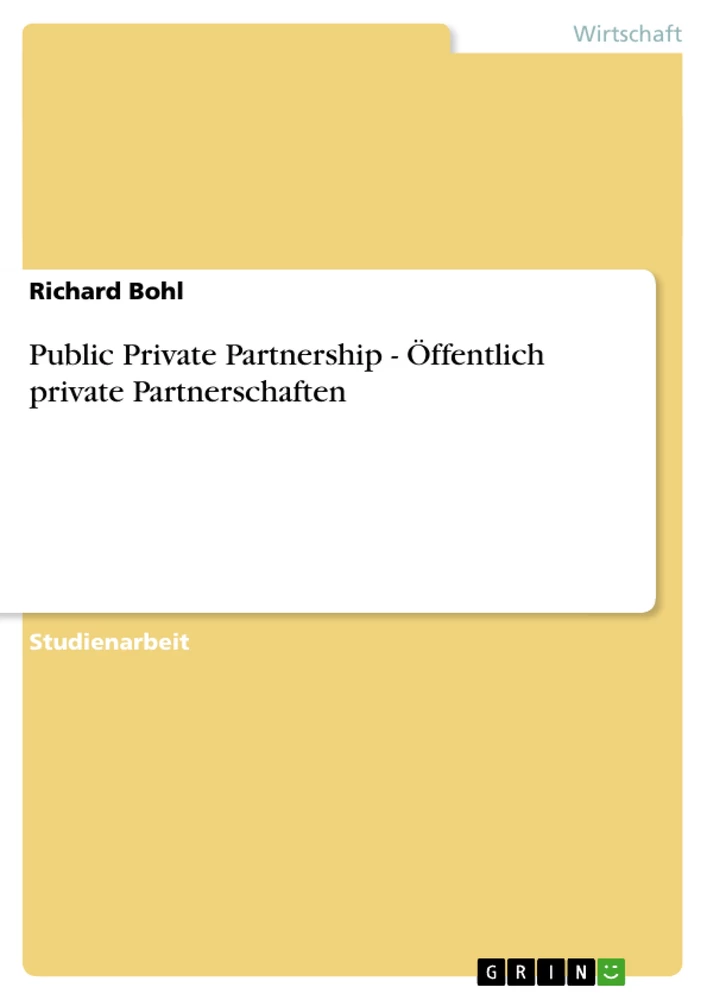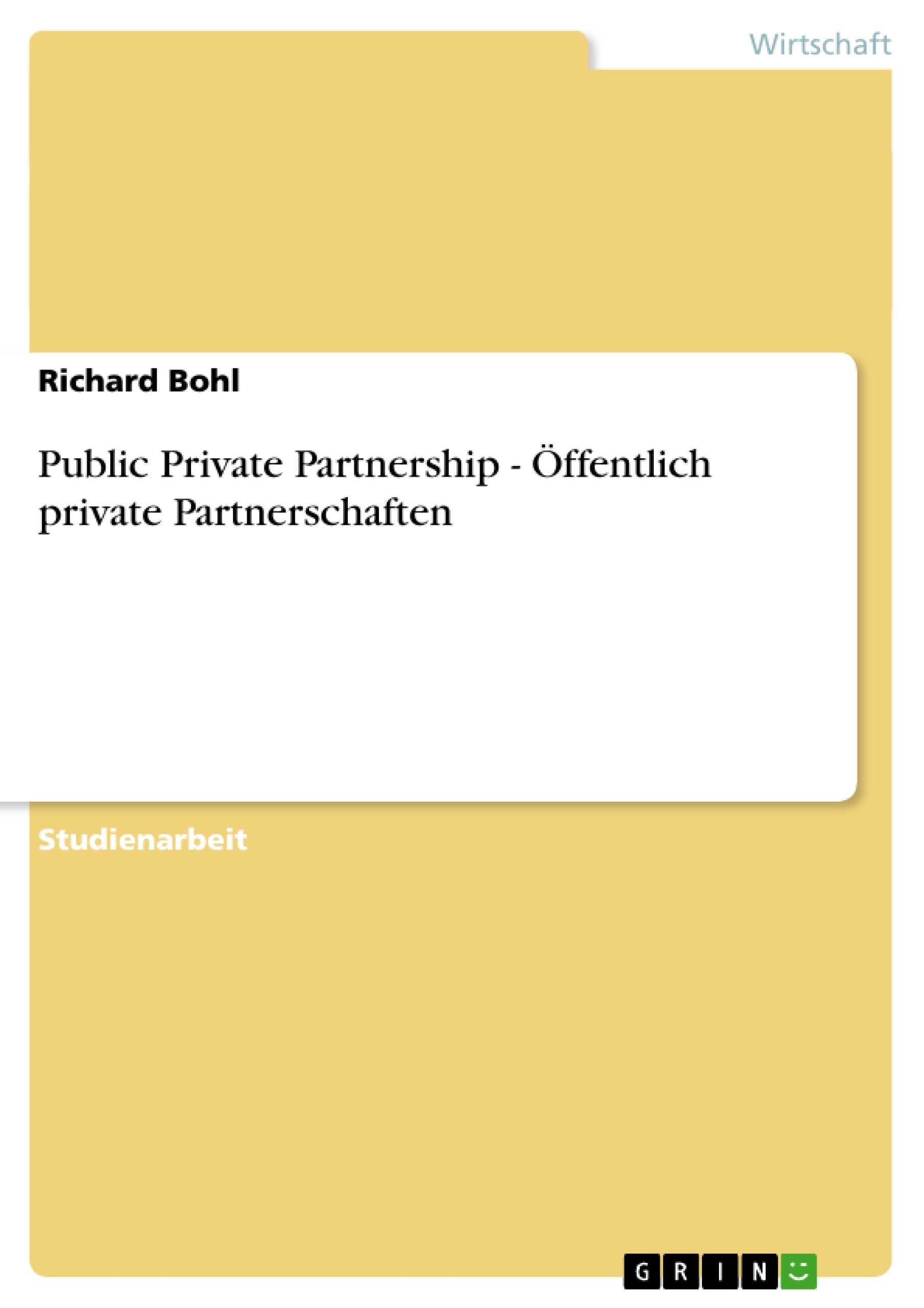In den letzten Jahren nahm die finanziell angespannte Situation der öffentlichen Haushalte zu. Sowohl Bund und Länder als auch Kommunen haben sich zunehmend verschuldet, woraus geringere Investitionen der öffentlichen Hand resultierten. Dabei „droht die Gefahr, dass wichtige Investitionen in die öffentliche Infrastruktur unterbleiben, wirtschaftliche Wachstums- und Entwicklungschancen vertan werden und Deutschland im internationalen Standortwettbewerb zurückfällt.“
Der größte Investitionsbedarf wird bei Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen geschätzt. Stecker und Boll gehen davon aus, dass der Investitionsstau mittlerweile auf 150 Milliarden EUR angewachsen ist und weiter zunimmt. Das Problem aus diesem Sachverhalt wird durch die Aussage des Bundesverbandes deutscher Banken ersichtlich: „Eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur ist im internationalen Standortwettbewerb ein wichtiger Faktor, der im Zeitalter der Informations- und Kommunikationstechnologie noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.“ Diese Situation wird ebenfalls von Lippold fundiert: „Deutschland befindet sich in einem immensen Investitionsstau und ist dadurch in eine bedenkliche Infrastrukturkrise hineingeraten. Ausbau und Instandhaltung von Verkehrswegen halten nicht Schritt [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 PPP als alternative Beschaffungsform des Staates
- 2 Charakterisierung PPP
- 2.1 Definition und Merkmale
- 2.2 Ziele
- 2.3 Einsatzmöglichkeiten
- 2.4 PPP-Modelle
- 3 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 4 Phasen eines PPP
- 5 Ausgewählte Beispiele aus der Praxis
- 5.1 JVA Hünfeld
- 5.2 Die britische Botschaft in Berlin
- 6 Kritische Würdigung
- 7 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Public Private Partnerships (PPP) als alternative Beschaffungsform für den Staat. Die Arbeit beleuchtet die Charakteristika von PPP, die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen und die verschiedenen Phasen eines solchen Projekts. Anhand konkreter Beispiele werden die Anwendung und die kritischen Aspekte von PPP beleuchtet. Der Ausblick betrachtet zukünftige Entwicklungen im Kontext von PPP.
- Charakterisierung von Public Private Partnerships (PPP)
- Rechtliche Rahmenbedingungen von PPP in Deutschland
- Phasen eines PPP-Projekts
- Beispiele für PPP aus der Praxis
- Kritische Würdigung und zukünftige Entwicklungen von PPP
Zusammenfassung der Kapitel
1 PPP als alternative Beschaffungsform des Staates: Das Kapitel beschreibt die finanzielle Notlage öffentlicher Haushalte in Deutschland und die daraus resultierende Notwendigkeit alternativer Investitionsmodelle. Es argumentiert, dass PPP eine Möglichkeit bietet, wichtige Infrastrukturprojekte trotz knapper öffentlicher Mittel umzusetzen und Einsparungen von bis zu 25% zu erzielen. Die zunehmende Bedeutung von PPP wird anhand der Gründung einer Bundeseigenen PPP-Task-Force verdeutlicht.
2 Charakterisierung PPP: Dieses Kapitel definiert und charakterisiert PPP. Es beleuchtet verschiedene Merkmale wie langfristige Zusammenarbeit, gemeinsame Aufgabenerfüllung, Risikoverteilung und leistungsorientierte Vergütung. Die Bedeutung komplementärer Zielsetzungen der Partner für den Erfolg wird hervorgehoben. Unterschiedliche PPP-Modelle wie Betreibermodelle, Konzessionsmodelle und Contractingmodelle werden erläutert und anhand von Beispielen illustriert.
3 Rechtliche Rahmenbedingungen: Das Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen von PPP im deutschen Vergaberecht, insbesondere mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV). Es erklärt die relevanten Paragraphen und Schwellenwerte und erläutert die Anwendung der Verdingungsordnungen für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen (VOB/A, VOL/A). Die Bedeutung des FstrPrivFinG und des ÖPP-Beschleunigungsgesetzes wird hervorgehoben.
4 Phasen eines PPP: Dieses Kapitel beschreibt die fünf Phasen eines typischen PPP-Projekts: Bedarfsfeststellung und Maßnahmenidentifizierung, Aufbau der Projektorganisation und Beschaffungsvariantenvergleich, Ausschreibung und Vergabe, Projektrealisation und Verwertung. Die kontinuierliche Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen, Risikomanagement und Finanzierbarkeitsprüfungen über alle Phasen hinweg wird betont.
5 Ausgewählte Beispiele aus der Praxis: Das Kapitel präsentiert zwei Fallstudien: die JVA Hünfeld als Beispiel für ein PPP-Projekt im Strafvollzug und die britische Botschaft in Berlin als Beispiel für ein PPP-Projekt im Bereich öffentlicher Bauten. Es werden die jeweiligen Projektinhalte, die involvierten Akteure, die erzielten Ergebnisse und die damit verbundenen Herausforderungen detailliert analysiert. Beide Beispiele unterstreichen die Möglichkeit von Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen durch PPP.
6 Kritische Würdigung: Dieses Kapitel analysiert die Risiken und Herausforderungen von PPP. Es diskutiert die Kosten- und Zeitintensität, die Komplexität von Ausschreibungsverfahren und Verträgen, Probleme bei der Transparenz und die potenzielle Benachteiligung kleinerer Unternehmen. Kritische Punkte im deutschen Vergaberecht und Steuerrecht werden erläutert und mögliche Lösungsansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Public Private Partnership (PPP), alternative Beschaffungsform, öffentlicher Sektor, privater Sektor, Risikoteilung, Vergaberecht, GWB, VgV, Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit, Infrastruktur, JVA Hünfeld, Britische Botschaft Berlin, Kosten-Nutzen-Analyse, Contracting, Konzessionsmodell, Betreibermodell, Rechtliche Rahmenbedingungen, ÖPP-Beschleunigungsgesetz, FstrPrivFinG.
Häufig gestellte Fragen zu: Public Private Partnerships (PPP) als alternative Beschaffungsform des Staates
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht Public Private Partnerships (PPP) als alternative Beschaffungsform für den Staat. Sie beleuchtet die Charakteristika von PPP, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Phasen eines solchen Projekts und analysiert anhand konkreter Beispiele die Anwendung und kritische Aspekte von PPP. Der Ausblick betrachtet zukünftige Entwicklungen im Kontext von PPP.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Charakterisierung von PPP, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, die Phasen eines PPP-Projekts, Praxisbeispiele und eine kritische Würdigung sowie zukünftige Entwicklungen von PPP.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 behandelt PPP als alternative Beschaffungsform des Staates vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Mittel. Kapitel 2 charakterisiert PPP, definiert Merkmale und Modelle. Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im deutschen Vergaberecht. Kapitel 4 beschreibt die Phasen eines PPP-Projekts. Kapitel 5 präsentiert Praxisbeispiele (JVA Hünfeld und die britische Botschaft in Berlin). Kapitel 6 bietet eine kritische Würdigung, und Kapitel 7 gibt einen Ausblick.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die relevanten Paragraphen und Schwellenwerte des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Vergabeverordnung (VgV), der Verdingungsordnungen für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen (VOB/A, VOL/A), sowie die Bedeutung des FstrPrivFinG und des ÖPP-Beschleunigungsgesetzes.
Welche Phasen eines PPP-Projekts werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt fünf Phasen: Bedarfsfeststellung und Maßnahmenidentifizierung, Aufbau der Projektorganisation und Beschaffungsvariantenvergleich, Ausschreibung und Vergabe, Projektrealisation und Verwertung. Die Bedeutung von Wirtschaftlichkeitsanalysen, Risikomanagement und Finanzierbarkeitsprüfungen wird hervorgehoben.
Welche Praxisbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die JVA Hünfeld als Beispiel für ein PPP-Projekt im Strafvollzug und die britische Botschaft in Berlin als Beispiel für ein PPP-Projekt im Bereich öffentlicher Bauten. Es werden Projektinhalte, Akteure, Ergebnisse und Herausforderungen detailliert untersucht.
Welche kritischen Aspekte von PPP werden diskutiert?
Die kritische Würdigung analysiert Risiken und Herausforderungen wie Kosten- und Zeitintensität, Komplexität von Ausschreibungsverfahren und Verträgen, Transparenzprobleme und die potenzielle Benachteiligung kleinerer Unternehmen. Kritische Punkte im deutschen Vergaberecht und Steuerrecht werden erläutert und Lösungsansätze diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Public Private Partnership (PPP), alternative Beschaffungsform, öffentlicher Sektor, privater Sektor, Risikoteilung, Vergaberecht, GWB, VgV, Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit, Infrastruktur, JVA Hünfeld, Britische Botschaft Berlin, Kosten-Nutzen-Analyse, Contracting, Konzessionsmodell, Betreibermodell, Rechtliche Rahmenbedingungen, ÖPP-Beschleunigungsgesetz, FstrPrivFinG.
Welche Vorteile bieten PPP laut der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass PPP eine Möglichkeit bietet, wichtige Infrastrukturprojekte trotz knapper öffentlicher Mittel umzusetzen und Einsparungen von bis zu 25% zu erzielen.
Welche Risiken und Herausforderungen werden mit PPP verbunden?
Die Arbeit nennt Risiken wie Kosten- und Zeitintensität, komplexe Ausschreibungsverfahren und Verträge, Transparenzprobleme und die mögliche Benachteiligung kleinerer Unternehmen.
- Quote paper
- Richard Bohl (Author), 2007, Public Private Partnership - Öffentlich private Partnerschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/93757