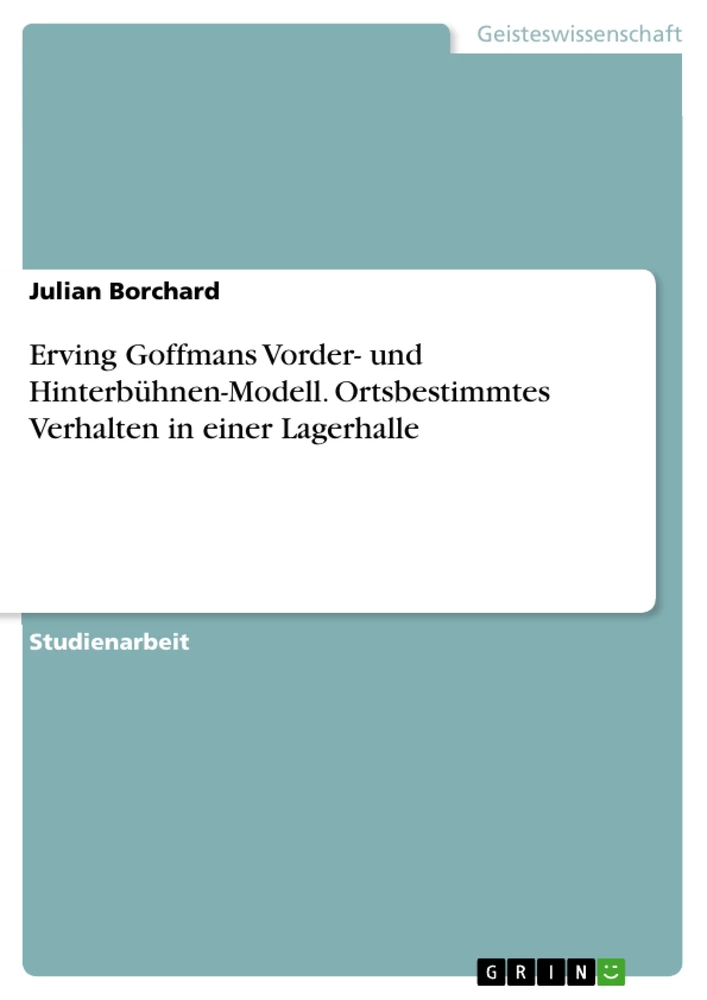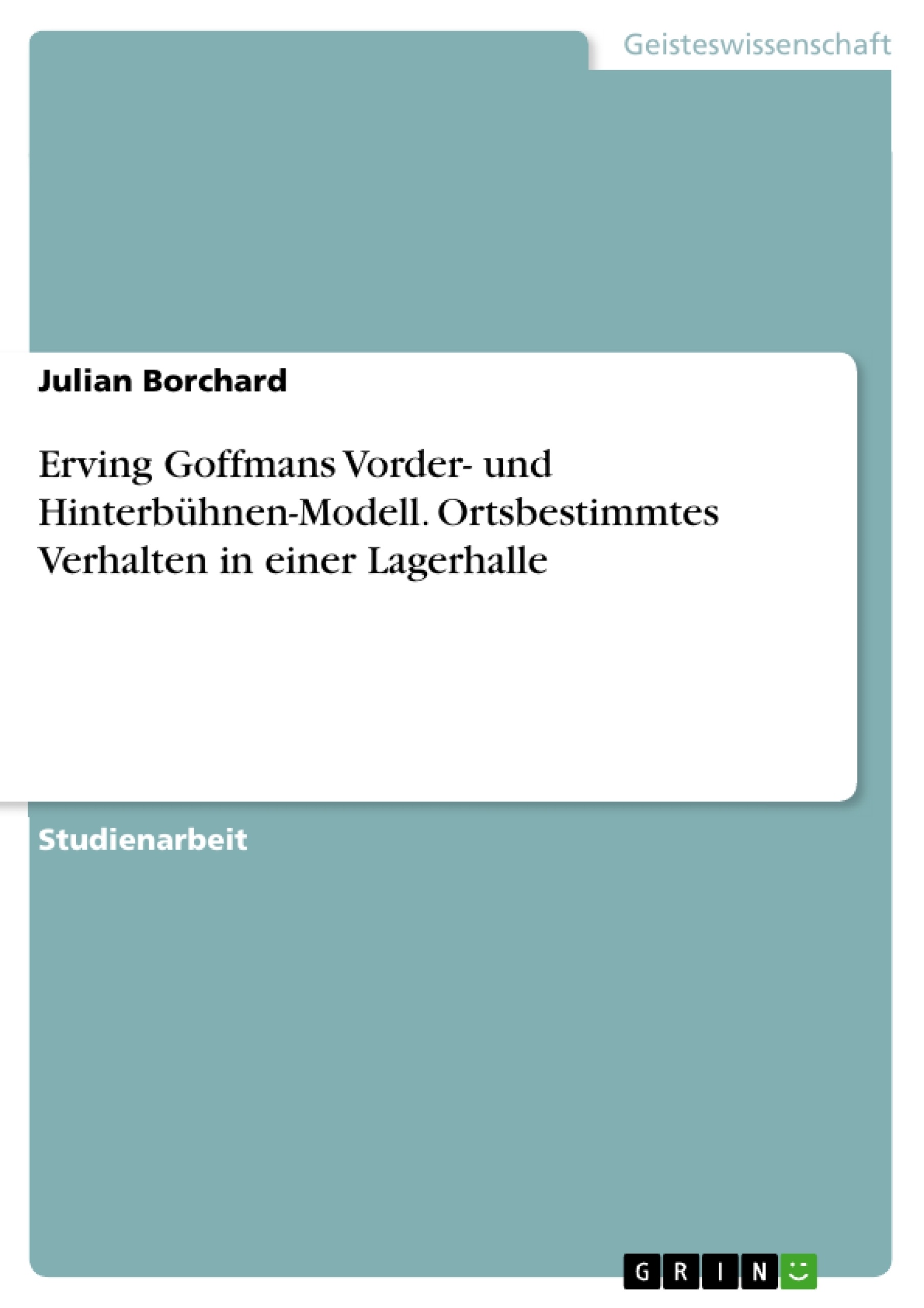Individuen seien in Anwesenheit von anderen durchgehend damit beschäftigt, ein bestimmtes Bild von sich zu vermitteln. Sie seien der Situationsdynamik von Interaktionen unterworfen und würden bewusst oder unbewusst durchgehend damit beschäftigt sein, Situationsnormen zu entsprechen und die Handlungen anderer zu deuten und auf diese zu reagieren (Ringel 2017). Doch Individuen würden sich vor anderen in einem stärkeren Maße als sonst darum bemühen, die offiziell anerkannten Werte der Gesellschaft zu verkörpern (Goffman 1988). Das impliziert, dass es auch Raum-Zeit-Kontinuen gibt, in denen Individuen sich nicht so stark an anerkannten Werten der Gesellschaft orientieren. Goffman entwickelte innerhalb seiner Interaktionstheorie ein Modell, welches sich mit genau dieser Thematik beschäftigt. Sein Modell bestehend aus „Vorderbühne“ und „Hinterbühne“ wird das Thema dieser Ausarbeitung werden.
Dazu wird zuerst im Sinne Goffmans Interaktionstheorie erklärt, wie und wieso Individuen ein Bild von sich produzieren und wieso sie dazu tendieren ihre Darstellungen räumlich zu trennen. Daran anknüpfend wird das „Vorder- und Hinterbühnen-Modell“ erklärt und kurz auf seine Aktualität überprüft. Im Anschluss daran wird anhand eines Beispiels, die Vorder- und Hinterbühnen-Thematik erläutert. Es wird erklärt werden, wie „Lagerarbeiter“ gemeinsam und im Einzelnen, eine normorientierte Darstellung für ihre „Vorgesetzten“ konstruieren und zu welchen Inkonsistenzen es kommt. Die Beobachtungen aus dem Beispiel stützen sich dabei auf persönliche Beobachtungen, welche in einem Zentrallager von einer Kette von Schuhfachgeschäften, produziert wurden. Abschließend folgt eine kurze Zusammenfassung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Goffmans Vorder- und Hinterbühnen-Modell
- 2.1. Das Selbstdarstellungsdilemma
- 2.2. räumliche Trennung
- 2.3. Kritik
- 3. Ortsbestimmtes Verhalten in der „Lagerhalle“
- 3.1. Ursprung der Daten und Ausgangslage
- 3.2. Situationsbestimmung auf der Vorderbühne
- 3.3. Die Hinterbühne
- 3.4. Störungen und Fehler / Brüche zwischen Vorder- und Hinterbühne
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Erving Goffmans Vorder- und Hinterbühnen-Modell, indem sie die Theorie des Selbstdarstellungsdilemmas erläutert und anhand eines praktischen Beispiels aus einer Lagerhalle illustriert. Das Ziel ist es, die Bedeutung räumlicher Trennung von Vorder- und Hinterbühne für das Verhalten von Individuen in sozialen Interaktionen zu verstehen.
- Das Konzept der Selbstdarstellung und das Dilemma der Konsistenz
- Die Trennung von Vorder- und Hinterbühne als Raum für verschiedene Verhaltensweisen
- Die Rolle von Normen und Erwartungen in der Gestaltung von Interaktionen
- Die Auswirkungen von Störungen und Fehlern auf die Selbstdarstellung
- Die Bedeutung des Beispiels der Lagerhalle für die Anwendung des Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstdarstellung und Goffmans Grundannahme ein. Sie stellt den Romanausschnitt aus „Wir alle spielen Theater“ vor, der die Grundidee des Modells verdeutlicht. Das zweite Kapitel erläutert Goffmans Vorder- und Hinterbühnen-Modell im Detail. Es beschreibt das Selbstdarstellungsdilemma, die räumliche Trennung von Vorder- und Hinterbühne und die damit verbundenen Herausforderungen. Im dritten Kapitel wird das Modell anhand eines Beispiels aus einer Lagerhalle veranschaulicht. Es beleuchtet, wie „Lagerarbeiter“ ein normorientiertes Bild für ihre Vorgesetzten konstruieren und welche Inkonsistenzen auftreten können. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Selbstdarstellung, Vorder- und Hinterbühne, soziale Interaktion, Normen, Erwartungen, räumliche Trennung, Inkonsistenz, Lagerhalle, Verhaltensbeobachtung.
- Quote paper
- Julian Borchard (Author), 2020, Erving Goffmans Vorder- und Hinterbühnen-Modell. Ortsbestimmtes Verhalten in einer Lagerhalle, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/936724