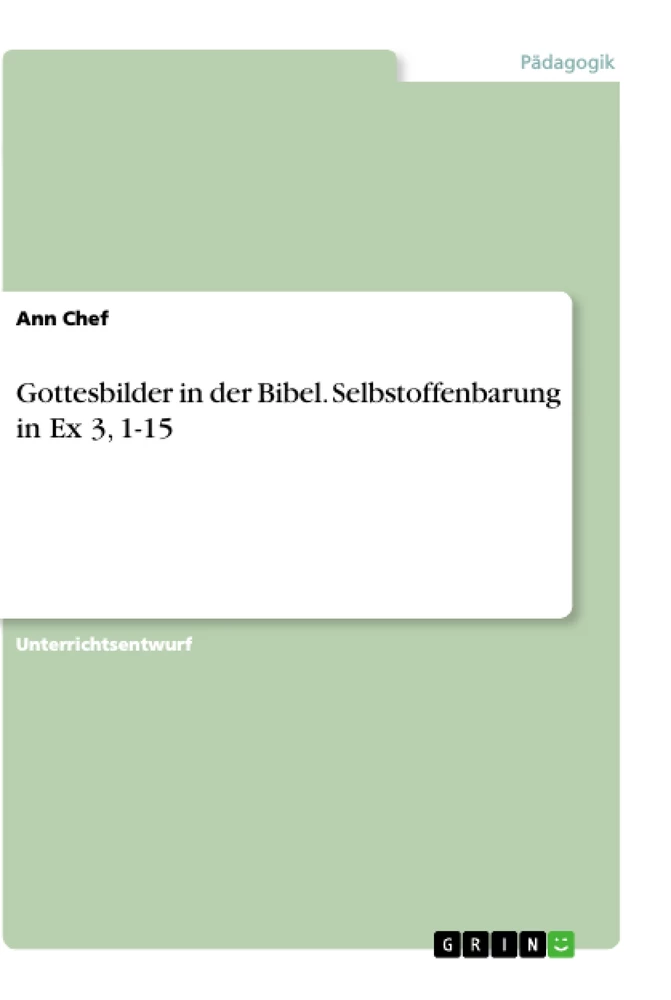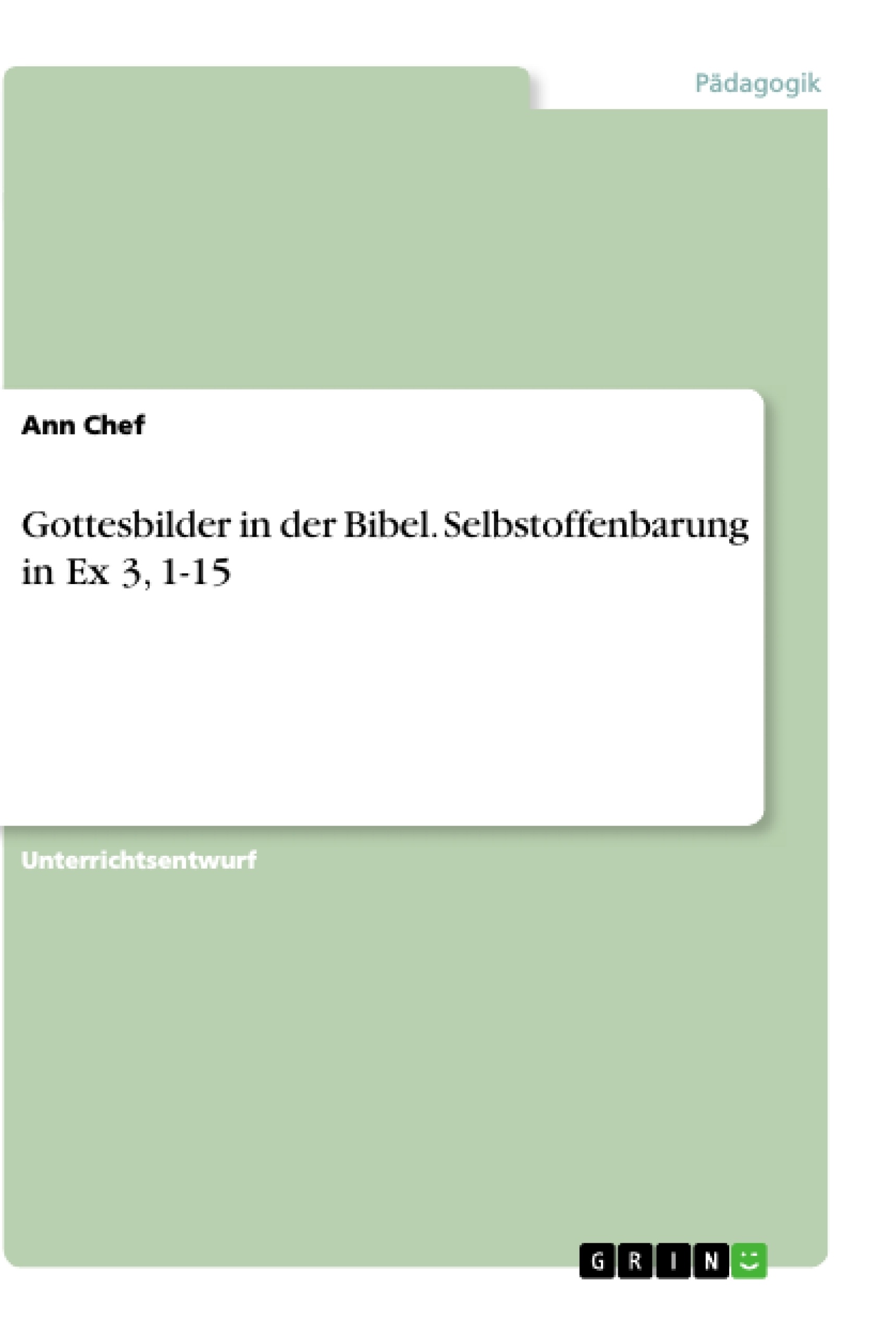Indem die Schülerinnen und Schüler in dieser Unterrichtsstunde den biblischen Text Ex 3, 1-15 hinsichtlich Gottes Selbstoffenbarung deuten, reflektieren sie die Ambivalenz der Offenbarung und Verborgenheit Gottes. Sie erweitern somit ihre Fähigkeiten, theologische Texte zu erschließen und werden schwerpunktmäßig in ihrer Deutungsfähigkeit gefördert.
Der theologische Begriff "Offenbarung" lässt sich religionswissenschaftlich als eine Realität, einen Inhalt, im engeren Sinn als eine Botschaft verstehen, die zuvor dem Menschen verborgen war. Das Verborgene wird also in diesem Sinne religiös offenbar. Im Alten Testament fungiert das Wort Gottes als Mittel für eine Offenbarung, welche ebenfalls von Auditionen und Visionen begleitet werden kann. In Ex 3, 1-15 beruft Gott Mose dazu, das Volk der Israeliten aus Ägypten herauszuführen und Gott offenbart sich mit seinem Namen im brennenden Dornbusch.
Inhaltsverzeichnis
- Eigene Gottesvorstellungen und die Bedeutung der eigenen Biographie (Modell Oser/ Gmünder)
- Gottesbilderflut oder Gottes Bilderflucht? - Gottesbilder und Bilderverbot
- Offenbar und doch verborgen - Gottes Selbstoffenbarung in Ex 3, 1-15
- „Mose am brennenden Dornbusch“ - eine Erzählung mit szenischem Rollenspiel
- JHWH - Die sprachliche Herleitung des Eigennamens und seine Bedeutung für die jüdische Frömmigkeit
- Gott als Schöpfer und als Gegenüber
- „Agape“ – Gott ist Liebe (Joh 4,16)
- Liebender und richtender Gott zugleich? – Spannungen in biblischen Gottesbildern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtseinheit zielt darauf ab, die Ambivalenz von Gottes Offenbarung und Verborgenheit im Alten Testament zu erkunden. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Fähigkeiten zur Interpretation theologischer Texte verbessern und ihre Deutungsfähigkeiten erweitern. Dies geschieht anhand der Analyse von Gottes Selbstoffenbarung im Buch Exodus, Kapitel 3, Verse 1-15.
- Gottes Selbstoffenbarung im Alten Testament
- Die Ambivalenz von Offenbarung und Verborgenheit Gottes
- Interpretation biblischer Texte und Entwicklung von Deutungsfähigkeiten
- Anwendung religionspsychologischer Modelle (Oser/Gmünder)
- Die Bedeutung des Gottesnamens JHWH
Zusammenfassung der Kapitel
Eigene Gottesvorstellungen und die Bedeutung der eigenen Biographie (Modell Oser/Gmünder): Diese Stunde untersucht die individuellen Gottesvorstellungen der Schüler im Kontext des religionspsychologischen Modells von Oser/Gmünder. Es wird analysiert, wie die persönlichen Erfahrungen und die Biographie der Schüler ihre Interpretation von biblischen Gottesbildern prägen und wie sie sich auf den Stufen des religiösen Urteils befinden (Stufe 3 und 4). Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen persönlicher Erfahrung und der Begegnung mit dem Göttlichen, was für die spätere Auseinandersetzung mit der Offenbarung in Exodus relevant ist.
Gottesbilderflut oder Gottes Bilderflucht? - Gottesbilder und Bilderverbot: Diese Einheit befasst sich mit der Vielfalt an Gottesbildern und dem Bilderverbot im Alten Testament. Sie analysiert den Spannungsbogen zwischen der Notwendigkeit, Gott darzustellen und dem Verbot, Ihn in Bildern festzuhalten. Die Stunde untersucht, wie diese scheinbare Widersprüchlichkeit mit der Komplexität Gottes in Einklang gebracht werden kann und welche Bedeutung dies für das Verständnis der göttlichen Offenbarung hat. Dies bildet eine wichtige Grundlage für das Verständnis der folgenden Stunde, die sich mit der Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch auseinandersetzt.
Offenbar und doch verborgen - Gottes Selbstoffenbarung in Ex 3, 1-15: Die zentrale Stunde analysiert die Offenbarung Gottes an Mose im brennenden Dornbusch (Ex 3,1-15). Der Fokus liegt auf dem Paradoxon des brennenden, aber unverbrannten Busches als Symbol für Gottes Zeitlosigkeit und die Ambivalenz von Offenbarung und Verborgenheit. Der Gottesname JHWH und seine Bedeutung werden eingehend untersucht, ebenso wie die Reaktionen Moses auf die göttliche Offenbarung. Die Stunde verbindet theologische Interpretation mit der Anwendung der immanenten Bibeldidaktik, wobei die persönlichen Erfahrungen der Schüler mit dem Thema Offenbarung im Mittelpunkt stehen.
Schlüsselwörter
Gottesbilder, Offenbarung, Verborgenheit, Exodus 3,1-15, JHWH, Ambivalenz, Bibelinterpretation, Religionspsychologie (Oser/Gmünder), Immanente Bibeldidaktik, Deutungsfähigkeiten, Altes Testament.
Häufig gestellte Fragen zu "Gottesbilder im Alten Testament"
Was ist der Inhalt dieses Lehrmaterials?
Dieses Lehrmaterial bietet einen umfassenden Überblick über die Thematik der Gottesbilder im Alten Testament. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Lernziele und Schwerpunktthemen, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ambivalenz von Gottes Offenbarung und Verborgenheit, insbesondere anhand des Buches Exodus, Kapitel 3, Verse 1-15.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen umfassen die individuellen Gottesvorstellungen der Schüler im Kontext des religionspsychologischen Modells von Oser/Gmünder, die Vielfalt und das Verbot von Gottesbildern im Alten Testament, Gottes Selbstoffenbarung im brennenden Dornbusch (Ex 3,1-15), die Bedeutung des Gottesnamens JHWH und die Interpretation biblischer Texte. Es wird die Ambivalenz von Offenbarung und Verborgenheit Gottes beleuchtet und die Entwicklung von Deutungsfähigkeiten gefördert.
Welche Methoden werden eingesetzt?
Das Lehrmaterial nutzt verschiedene Methoden, darunter die Analyse theologischer Texte, die Anwendung religionspsychologischer Modelle (Oser/Gmünder), szenisches Rollenspiel ("Mose am brennenden Dornbusch") und die immanente Bibeldidaktik. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen persönlicher Erfahrung und der Begegnung mit dem Göttlichen.
Welche Kapitel sind enthalten?
Das Lehrmaterial umfasst Kapitel zu folgenden Themen: Eigene Gottesvorstellungen und die Bedeutung der eigenen Biographie (Modell Oser/Gmünder); Gottesbilderflut oder Gottes Bilderflucht? - Gottesbilder und Bilderverbot; Offenbar und doch verborgen - Gottes Selbstoffenbarung in Ex 3, 1-15; „Mose am brennenden Dornbusch“ - eine Erzählung mit szenischem Rollenspiel; JHWH - Die sprachliche Herleitung des Eigennamens und seine Bedeutung für die jüdische Frömmigkeit; Gott als Schöpfer und als Gegenüber; „Agape“ – Gott ist Liebe (Joh 4,16); Liebender und richtender Gott zugleich? – Spannungen in biblischen Gottesbildern.
Welche Lernziele werden verfolgt?
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Fähigkeiten zur Interpretation theologischer Texte verbessern, ihre Deutungsfähigkeiten erweitern und die Ambivalenz von Gottes Offenbarung und Verborgenheit im Alten Testament erkunden. Sie sollen religionspsychologische Modelle anwenden und das Verständnis des Gottesnamens JHWH vertiefen.
Für wen ist dieses Material geeignet?
Dieses Material ist für den Einsatz im Religionsunterricht konzipiert, insbesondere für Schüler*innen, die sich mit dem Thema Gottesbilder im Alten Testament auseinandersetzen möchten. Die Anwendung religionspsychologischer Modelle (Oser/Gmünder) deutet auf einen Einsatz im Sekundarbereich hin.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gottesbilder, Offenbarung, Verborgenheit, Exodus 3,1-15, JHWH, Ambivalenz, Bibelinterpretation, Religionspsychologie (Oser/Gmünder), Immanente Bibeldidaktik, Deutungsfähigkeiten, Altes Testament.
- Arbeit zitieren
- Ann Chef (Autor:in), 2020, Gottesbilder in der Bibel. Selbstoffenbarung in Ex 3, 1-15, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/936652