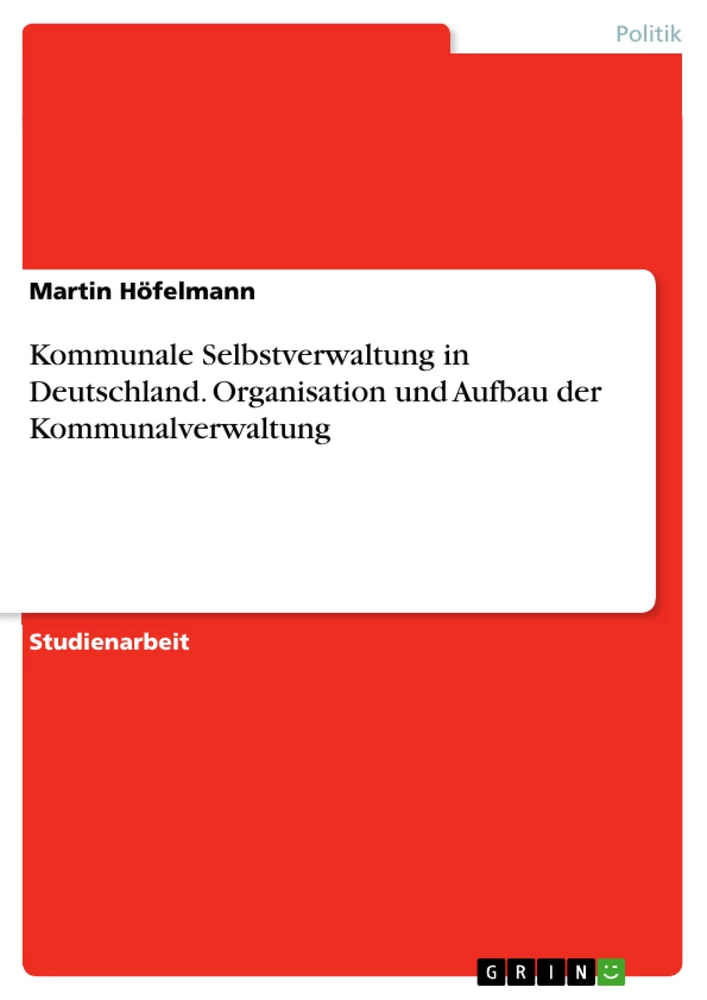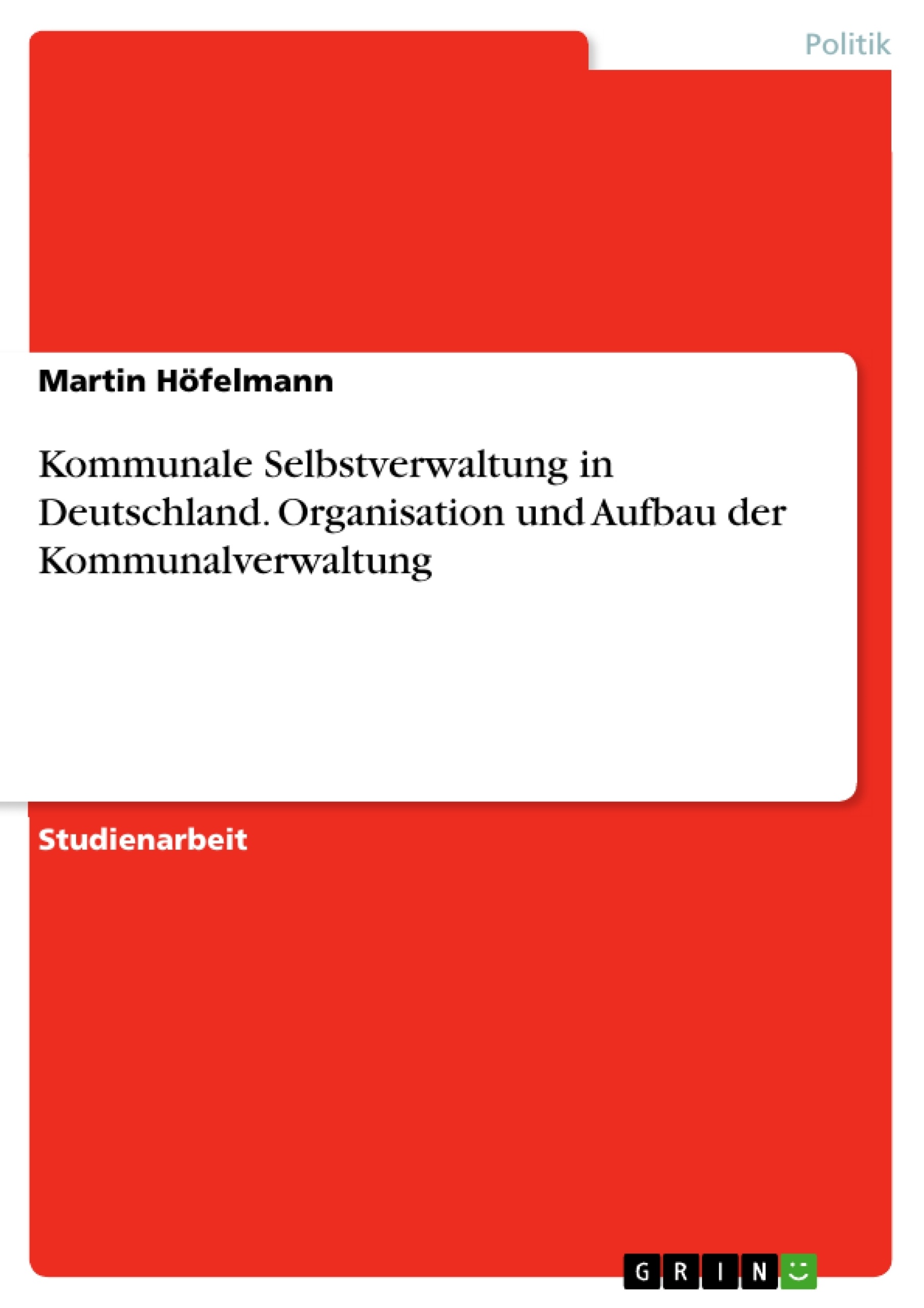„Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ (Artikel 28, Absatz 2 Grundgesetz)
Wie im Gesetztestext beschrieben sind die Kommunen nach der förderalstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland als Träger der kommunalen Selbstverwaltung eine eigenständige Ebene des Verwaltungsaufbaus. So ist die Kommune in ihrem Einzugsgebiet Träger der gesamten örtlichen Verwaltung und gehört somit neben Bund und Ländern zu den sogenannten öffentlichen Gebietskörperschaften. Nach Bogumil und Holtkamp sind Kommunen jedoch vielmehr als die beschriebene Ebene im Verwaltungsaufbau, nämlich „Schulen der Demokratie“. (vgl. Bogumil & Holtkamp 2006: 9) „Hier können demokratische Verhaltensweisen und politische Fähigkeiten ausgebildet werden, nämlich das Erlernen von Zusammenarbeit, die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen, die Austragung von Meinungsverschiedenheiten, die Suche nach Kompromissen und die Ausübung von Einfluss.“ (Bogumil & Holtkamp 2006: 9)
Mit der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland beschäftigt sich diese Arbeit. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die Kommunalverwaltung, ihre Aufgaben und ihren Aufbau gelegt. Als Grundlage und Einführung widmet sich der erste Abschnitt den institutionellen Rahmenbedingungen des kommunalen Handelns in der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Zusammenhang werden zunächst die staatsrechtliche Legitimation geklärt und weiterführend verschiedene Kommunalverfassungen vorgestellt. Hierbei darf der Reformprozess, der sich seit den 1990er Jahren vollzogen hat, nicht außer Acht gelassen werden.
Auf dieser Basis wird im zweiten Teil auf den Aufbau und die Handlungsspielräume deutscher Kommunalverwaltungen näher eingegangen. Deren Aufgaben, die sich in übertragenen und eigenen Wirkungskreis aufteilen, werden zu Beginn vorgestellt, ehe dann auf den konkreten organisatorischen Aufbau von Kommunalverwaltungen eingegangen wird. Mit dem neuen Steuerungsmodell wird ein bundesdeutscher Reformtrend vorgestellt, der direkten Einfluss auf die Organisation der Verwaltung hat. Abschließend widmet sich dieser Abschnitt noch den Verfahren innerhalb der Verwaltung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Institutionelle Rahmenbedingungen kommunalen Handelns
- 2.1 Kommunale Selbstverwaltung im föderalistischen System der Bundesrepublik und ihre staatsrechtliche Legitimation
- 2.2 Die unterschiedlichen Kommunalverfassungssysteme
- 2.3 Reformen der Kommunalverfassungen seit den 1990er Jahren und ihre heutige Anwendung
- 3. Aufgaben und Organisation der Kommunalverwaltung
- 3.1 Die kommunalen Verwaltungsaufgaben
- 3.2 Der organisatorische Aufbau von Kommunalverwaltungen
- 3.3 Reformen im Aufbau der Kommunalverwaltung: Das Neue Steuerungsmodell
- 3.4 Verfahren der Kommunalverwaltung
- 4. Die Organisation und Aufgaben von Stadtverwaltungen am vergleichenden Beispiel der Landeshauptstädte Hannover und Erfurt
- 4.1 Daten und Fakten
- 4.1.1 Hannover
- 4.1.2 Zum Vergleich: Erfurt
- 4.2 Vergleich der Elemente kommunaler Selbstverwaltung
- 4.2.1 Niedersachsen
- 4.2.2 Zum Vergleich: Thüringen
- 4.3 Vergleich der Organisation und Aufgaben von Hannoverscher und Erfurter Stadtverwaltung
- 4.3.1 Aufbau und Aufgaben der Hannoverschen Stadtverwaltung
- 4.3.2 Exkurs: Region Hannover – ein Kommunalverband besonderer Art
- 4.3.3 Zum Vergleich: Aufbau und Aufgaben der Erfurter Stadtverwaltung im Vergleich
- 5. Abschlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Organisation und den Aufbau der Kommunalverwaltung. Ein Vergleich der Landeshauptstädte Hannover und Erfurt dient als Fallbeispiel. Die Arbeit beleuchtet die institutionellen Rahmenbedingungen, die Aufgaben und die organisatorischen Strukturen der Kommunalverwaltung, sowie Reformen in diesem Bereich.
- Staatsrechtliche Legitimation der kommunalen Selbstverwaltung im föderalen System Deutschlands
- Unterschiede und Entwicklung der Kommunalverfassungssysteme in den Bundesländern
- Aufgaben und organisatorischer Aufbau deutscher Kommunalverwaltungen
- Reformen der Kommunalverwaltung, insbesondere das Neue Steuerungsmodell
- Vergleichender Analyse der Stadtverwaltungen von Hannover und Erfurt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Kommunalverwaltung, ihre Aufgaben und ihren Aufbau. Sie stellt die Gliederung der Arbeit vor und betont die Bedeutung des Artikels 28, Absatz 2 des Grundgesetzes, der den Gemeinden das Recht zur Regelung örtlicher Angelegenheiten in eigener Verantwortung gewährleistet. Die Arbeit wird als eine Untersuchung der institutionellen Rahmenbedingungen, des Aufbaus und der Handlungsspielräume kommunaler Verwaltungen vorgestellt, die mit einem Vergleich der Stadtverwaltungen von Hannover und Erfurt abschließt.
2. Institutionelle Rahmenbedingungen kommunalen Handelns: Dieses Kapitel untersucht die institutionellen Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung. Es beleuchtet die staatsrechtliche Legitimation der kommunalen Selbstverwaltung im föderalen System Deutschlands, basierend auf dem Subsidiaritätsprinzip und der Dezentralisierung. Die verschiedenen Kommunalverfassungssysteme der Bundesländer werden erörtert, wobei die Unterschiede zwischen monistischen und dualistischen Systemen hervorgehoben werden. Der Einfluss von Reformen seit den 1990er Jahren auf die heutigen Kommunalverfassungen wird ebenfalls analysiert, unter Berücksichtigung der Rolle von Bund und Ländern in der Aufsicht und der Gewaltenteilung auf kommunaler Ebene.
3. Aufgaben und Organisation der Kommunalverwaltung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Aufgaben und dem organisatorischen Aufbau der Kommunalverwaltung. Es beschreibt die kommunalen Verwaltungsaufgaben, differenziert zwischen eigenen und übertragenen Aufgabenbereichen. Der organisatorische Aufbau von Kommunalverwaltungen wird detailliert dargestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vorstellung des "Neuen Steuerungsmodells" als ein Beispiel für bundesdeutsche Reformen, welche die Organisation der Verwaltung beeinflusst. Schließlich werden die Verfahren innerhalb der Kommunalverwaltung behandelt.
4. Die Organisation und Aufgaben von Stadtverwaltungen am vergleichenden Beispiel der Landeshauptstädte Hannover und Erfurt: Dieses Kapitel vergleicht die Organisation und Aufgaben der Stadtverwaltungen von Hannover und Erfurt. Es beginnt mit einer Darstellung der Daten und Fakten beider Städte, gefolgt von einem Vergleich der Elemente kommunaler Selbstverwaltung in Niedersachsen und Thüringen, jeweils auf Grundlage der entsprechenden Gemeindeordnungen. Der Vergleich konzentriert sich auf den Aufbau und die Aufgaben der Stadtverwaltungen, wobei auch die Region Hannover als Kommunalverband besonderer Art betrachtet wird. Die unterschiedlichen Strukturen und Aufgaben werden analysiert und gedeutet.
Schlüsselwörter
Kommunale Selbstverwaltung, Kommunalverwaltung, Föderalismus, Kommunalverfassung, Hannover, Erfurt, Niedersachsen, Thüringen, Neues Steuerungsmodell, Aufgabenhoheit, Organisationsstruktur, Vergleichende Analyse, Staatsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland - Ein Vergleich von Hannover und Erfurt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland, insbesondere die Organisation und den Aufbau der Kommunalverwaltung. Im Mittelpunkt steht ein vergleichender Fallstudienansatz, der die Landeshauptstädte Hannover und Erfurt in den Fokus nimmt.
Welche Aspekte der Kommunalen Selbstverwaltung werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die institutionellen Rahmenbedingungen, die Aufgaben und die organisatorischen Strukturen der Kommunalverwaltung. Sie untersucht die staatsrechtliche Legitimation, die verschiedenen Kommunalverfassungssysteme der Bundesländer, die Aufgabenhoheit der Kommunen und Reformen wie das „Neue Steuerungsmodell“. Der Vergleich von Hannover und Erfurt umfasst Daten, Fakten, den Aufbau der Verwaltungen und die Rolle von Kommunalverbänden.
Welche Rechtsgrundlagen sind relevant?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes, der die kommunale Selbstverwaltung gewährleistet. Sie berücksichtigt auch die Gemeindeordnungen von Niedersachsen und Thüringen, um den Vergleich von Hannover und Erfurt fundiert zu gestalten. Das Subsidiaritätsprinzip und die Prinzipien des Föderalismus bilden den verfassungsrechtlichen Rahmen.
Wie wird der Vergleich zwischen Hannover und Erfurt durchgeführt?
Der Vergleich zwischen den beiden Landeshauptstädten erfolgt auf mehreren Ebenen: Zunächst werden Daten und Fakten der Städte gegenübergestellt. Anschließend werden die Elemente der kommunalen Selbstverwaltung in Niedersachsen und Thüringen verglichen. Schließlich wird der Aufbau und die Aufgaben der jeweiligen Stadtverwaltungen detailliert analysiert, inklusive der Betrachtung der Region Hannover als Kommunalverband.
Welche Reformen der Kommunalverwaltung werden thematisiert?
Die Arbeit behandelt Reformen der Kommunalverfassungen seit den 1990er Jahren und analysiert insbesondere das „Neue Steuerungsmodell“ und dessen Einfluss auf den Aufbau und die Organisation der Kommunalverwaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit treffend?
Schlüsselwörter sind: Kommunale Selbstverwaltung, Kommunalverwaltung, Föderalismus, Kommunalverfassung, Hannover, Erfurt, Niedersachsen, Thüringen, Neues Steuerungsmodell, Aufgabenhoheit, Organisationsstruktur, Vergleichende Analyse, Staatsrecht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Institutionelle Rahmenbedingungen kommunalen Handelns, Aufgaben und Organisation der Kommunalverwaltung, Die Organisation und Aufgaben von Stadtverwaltungen am vergleichenden Beispiel der Landeshauptstädte Hannover und Erfurt, sowie eine Abschlussbemerkung und einen Ausblick.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland und vergleicht die Organisation und den Aufbau der Kommunalverwaltung am Beispiel von Hannover und Erfurt. Sie beleuchtet die institutionellen Rahmenbedingungen, Aufgaben und organisatorischen Strukturen sowie Reformen in diesem Bereich.
- Quote paper
- Martin Höfelmann (Author), 2008, Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland. Organisation und Aufbau der Kommunalverwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/92946