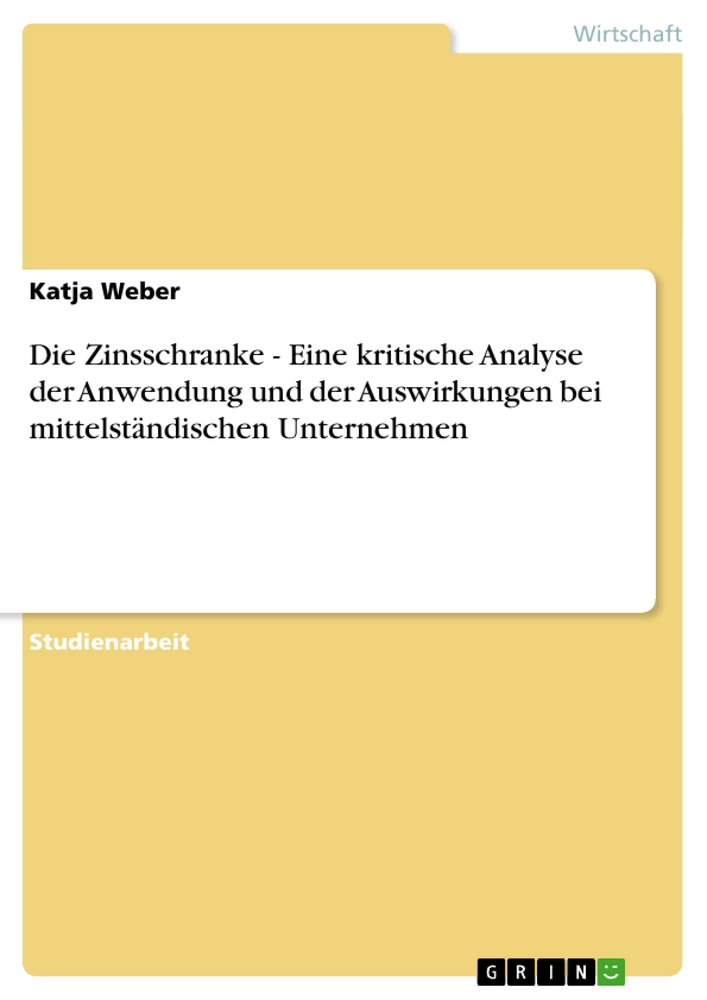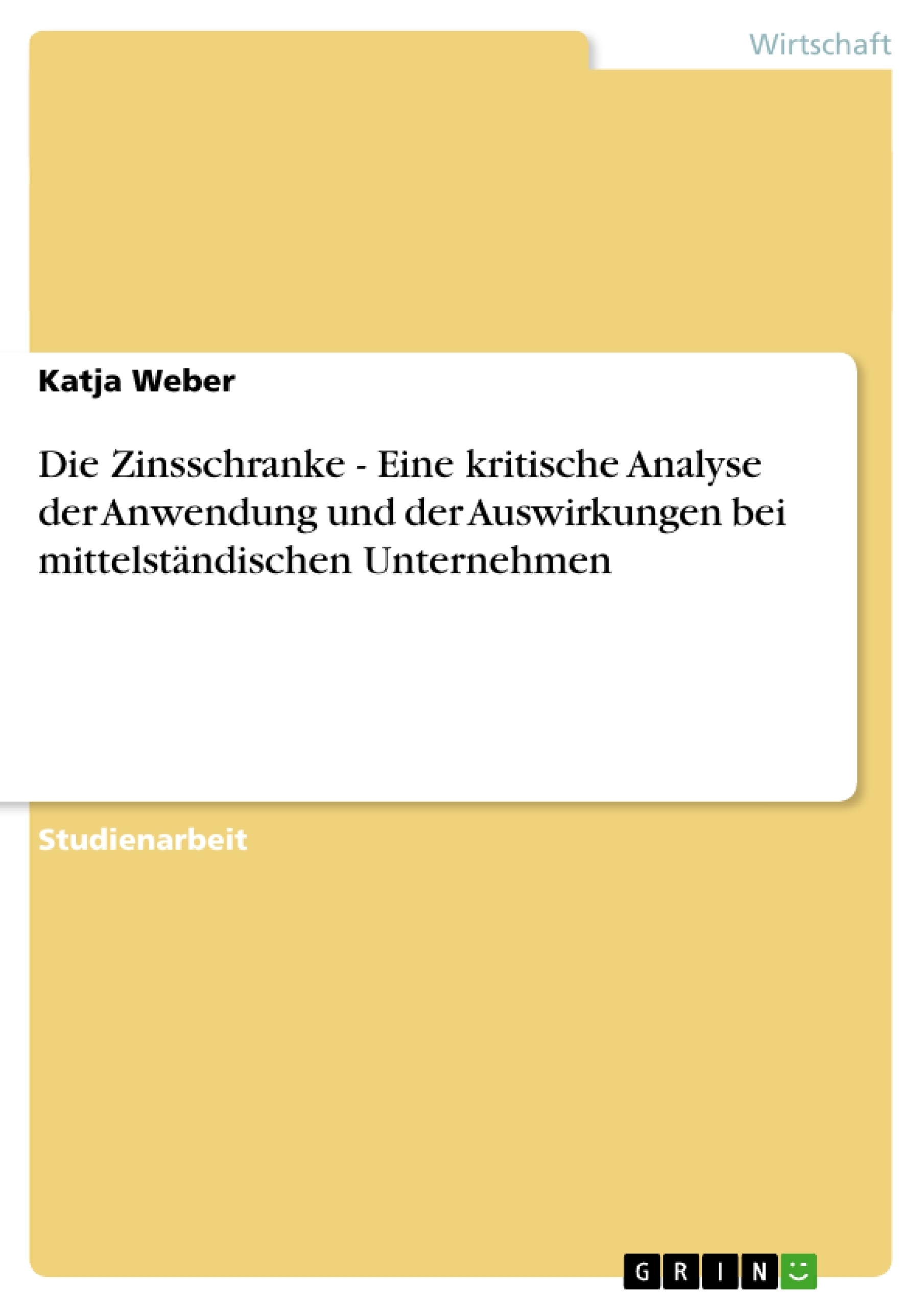Viele in Deutschland ansässige Unternehmen gründen, auf Grund der schnell
voranschreitenden Globalisierung und der Einbindung in den internationalen
Wettbewerb, Tochtergesellschaften oder Betriebstätten jenseits der eigenen
Landesgrenzen. Der Gesetzgeber sieht in der Globalisierung zunehmend die
Gefahr, dass Steuerzahlungen ins Ausland verlagert werden. Er wirkt durch die
Einführung der Zinsschranke den Versuchen von Unternehmen entgegen, ihre
erwirtschafteten Erträge ins niedriger besteuerte Ausland zu verlagern um
Steuerausfälle in Millionenhöhe zu vermeiden. Finanziert sich beispielsweise
ein im Inland ansässiges Unternehmen durch Kredite einer im Ausland ansässigen
Tochter oder Betriebstätte, sind die Zinsaufwendungen im Inland Betriebsausgaben,
die den Gewinn und dadurch die Steuerlast des inländischen
Unternehmens mindern. Dem Gesetzgeber entgehen Steuern, da der Gewinn
des inländischen Unternehmens durch den Abzug der Zinsaufwendungen als
Betriebsausgaben geringer ist und dadurch auch die Höhe der Steuerzahlung
im Inland geringer ausfällt. Die Zinserträge hingegen sind bei dem im Ausland
ansässigen Tochterunternehmen oder Betriebstätte Erträge, die dann auch im
Ausland der niedrigeren Steuer unterliegen. Diese Erträge entgehen dem deutschen
Gesetzgeber. Durch die Einführung der Zinsschranke will der Gesetzgeber
diese grenzüberschreitenden Gestaltungen verhindern und einer Gewinnverlagerung
ins niedriger besteuerte Ausland entgegenwirken.
Außerdem muss der Gesetzgeber die Senkung des Körperschaftsteuersatzes
von 25 % auf 15 % bzw. die Einführung einer einheitlichen Gewerbesteuermesszahl
i. H. von 3,5 % kompensieren. Die Zinsschranke soll als Gegenfinanzierungsmaßnahme
der Steuerentlastungsmaßnahmen greifen, „… das deutsche
Steueraufkommen sichern…“ und dazu beitragen „… dass die Finanzierungslasten
in einem internationalen Konzern fairer verteilt würden…“ Diese Studienarbeit soll einen Einblick in die Anwendung der Zinsschranke geben
und anhand einer Vergleichsrechung zeigen, wie sich die Einführung der
Zinsschranke auf die Steuerlast mittelständischer Unternehmen auswirkt. Es
wird vor allem auf die unter die Zinsschrankenregelungen fallenden Zinsaufwendungen,
die Abgrenzung der Konzernzugehörigkeit i. S. d. Zinsschranke
und auf einen möglichen Untergang des Zinsvortrags eingegangen. Umwandlungsrechtliche
Probleme werden nicht betrachtet. Auswirkungen auf Seiten von
Anteilseignern sollen nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gesetzliche Grundlagen
- 3 Begriffserläuterungen
- 3.1 Betrieb i. S. d. § 4h EStG
- 3.2 Maßgeblicher Gewinn / Maßgebliches Einkommen i. S. d. § 4h EStG / § 8a KStG
- 3.3 Fremdfinanzierungsaufwendungen i. S. d. § 4h EStG
- 4 Grundprinzip der Zinsschranke
- 4.1 Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungsaufwendungen
- 4.2 Ermittlung des Schuldzinsenüberhangs
- 4.3 Befreiungen von der Zinsschranke
- 4.3.1 Freigrenze
- 4.3.2 Konzernzugehörigkeitskriterium
- 4.3.2.1 Nicht konzernzugehörige Betriebe
- 4.3.2.2 Konzernzugehörige Betriebe
- 4.3.4 Escape-Klausel (Eigenkapitalquotenvergleich)
- 4.3.5 Befreiungsverbote
- 4.4 Prüfungsschema der Zinsschranke
- 5 Zinsvortrag
- 5.1 Anwendungsvorschriften
- 5.2 Ermittlung
- 5.3 Probleme
- 5.3.1 Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit
- 5.3.2 Untergang durch Aufgabe des Betriebs
- 5.3.3 Untergang bei Ausscheiden eines Gesellschafters
- 5.3.4 Untergang bei Übertragung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
- 6 Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen
- 6.1 Anwendung des § 4h EStG auf Körperschaften
- 6.2 Vergleichsrechnung
- 6.2.1 Ohne Anwendung der Zinsschrankenregelungen
- 6.2.2 Mit Anwendung der Zinsschrankenregelungen
- 6.2.3 Vergleich der Steuerbelastung mit und ohne Anwendung der Zinsschrankenregelungen
- 6.3 Auswirkungen auf die Gewerbesteuer
- 7 Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit analysiert kritisch die Anwendung und Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen. Ziel ist es, einen Einblick in die praktische Umsetzung der gesetzlichen Regelung und deren Folgen für die Steuerlast dieser Unternehmen zu geben. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl die gesetzlichen Grundlagen als auch konkrete Beispiele und Vergleichsrechnungen.
- Anwendung der Zinsschranke (§ 4h EStG) auf mittelständische Unternehmen
- Auswirkungen der Zinsschranke auf die Steuerlast mittelständischer Unternehmen
- Vergleich der Steuerbelastung mit und ohne Anwendung der Zinsschranke
- Konkrete Beispiele und Vergleichsrechnung zur Veranschaulichung der Auswirkungen
- Diskussion relevanter Problematiken im Zusammenhang mit der Zinsschranke
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Zinsschranke im Kontext der Unternehmensteuerreform 2008 ein und beschreibt die Notwendigkeit der Gegenfinanzierung von Steuersenkungen. Sie skizziert die Problematik der Zinsschranke und die Zielsetzung der vorliegenden Studienarbeit, die darin besteht, die Anwendung und Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen zu untersuchen.
2 Gesetzliche Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die relevanten gesetzlichen Grundlagen, die die Zinsschranke regeln und deren Anwendung definieren. Es liefert den rechtlichen Rahmen für das Verständnis der folgenden Analysen und erörtert die gesetzlichen Bestimmungen, die für die Berechnung und Anwendung der Zinsschranke relevant sind. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Grundlage der Einschränkung des Abzugs von Zinsaufwendungen.
3 Begriffserläuterungen: In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe im Kontext der Zinsschranke definiert und erläutert. Dies dient dem Verständnis der folgenden Kapitel und stellt sicher, dass alle relevanten Fachausdrücke klar definiert sind. Die Klärung von Begriffen wie "Betrieb", "maßgeblicher Gewinn" und "Fremdfinanzierungsaufwendungen" ist essentiell für eine korrekte Anwendung der Zinsschrankenregelung.
4 Grundprinzip der Zinsschranke: Dieses Kapitel beschreibt das Kernprinzip der Zinsschranke, ihre Berechnungsmethode und die Möglichkeiten, sich von ihr zu befreien. Es erläutert die Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungsaufwendungen, die Ermittlung des Schuldzinsenüberhangs und die verschiedenen Ausnahmeregelungen (Freigrenze, Konzernzugehörigkeit, Escape-Klausel). Die Ausführungen beleuchten die komplexe Struktur und die verschiedenen Ausnahmeregelungen der Zinsschranke.
5 Zinsvortrag: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Thema Zinsvortrag, der sich aus der Anwendung der Zinsschranke ergibt. Es erklärt die Anwendungsvorschriften, die Ermittlung des Zinsvortrags und die damit verbundenen Probleme, wie z.B. den Konflikt mit dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit oder den Untergang des Zinsvortrags bei bestimmten Ereignissen. Die verschiedenen Szenarien und ihre Auswirkungen auf die Steuerbelastung werden detailliert dargestellt.
6 Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen: Dieses Kapitel analysiert die konkreten Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen. Es beinhaltet eine Vergleichsrechnung, die die Steuerbelastung mit und ohne Anwendung der Zinsschranke gegenüberstellt. Zusätzlich wird der Einfluss auf die Gewerbesteuer beleuchtet. Die Analyse zeigt anhand konkreter Beispiele die potenziellen Auswirkungen der Zinsschranke auf die Finanzlage mittelständischer Unternehmen.
Schlüsselwörter
Zinsschranke, Unternehmensteuerreform 2008, § 4h EStG, mittelständische Unternehmen, Steuerlast, Fremdfinanzierung, Abzugsfähigkeit, Zinsaufwendungen, Gewerbesteuer, Vergleichsrechnung, Steuerbelastung, Leistungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Studienarbeit: Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit analysiert kritisch die Anwendung und Auswirkungen der Zinsschranke (§ 4h EStG) auf mittelständische Unternehmen. Sie untersucht die praktische Umsetzung der gesetzlichen Regelung und deren Folgen für die Steuerlast dieser Unternehmen. Die Arbeit beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, liefert konkrete Beispiele und Vergleichsrechnungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Anwendung der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen, Auswirkungen auf die Steuerlast, Vergleich der Steuerbelastung mit und ohne Zinsschranke, konkrete Beispiele und Vergleichsrechnung, und die Diskussion relevanter Problematiken im Zusammenhang mit der Zinsschranke.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Zielsetzung), Gesetzliche Grundlagen (rechtlicher Rahmen der Zinsschranke), Begriffserläuterungen (Definition zentraler Begriffe wie "Betrieb" und "maßgeblicher Gewinn"), Grundprinzip der Zinsschranke (Erklärung der Berechnungsmethode und Ausnahmeregelungen), Zinsvortrag (Anwendungsvorschriften, Ermittlung und Probleme), Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen (konkrete Analyse und Vergleichsrechnung), und Zusammenfassung.
Wie wird die Zinsschranke berechnet und welche Ausnahmeregelungen gibt es?
Das Kapitel "Grundprinzip der Zinsschranke" beschreibt die Berechnungsmethode und die Möglichkeiten, sich von der Zinsschranke zu befreien. Es erläutert die Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Fremdfinanzierungsaufwendungen, die Ermittlung des Schuldzinsenüberhangs und verschiedene Ausnahmeregelungen wie die Freigrenze, das Konzernzugehörigkeitskriterium und die Escape-Klausel.
Welche Auswirkungen hat die Zinsschranke auf die Steuerlast mittelständischer Unternehmen?
Das Kapitel "Auswirkungen der Zinsschranke auf mittelständische Unternehmen" analysiert die konkreten Auswirkungen. Es enthält eine Vergleichsrechnung, die die Steuerbelastung mit und ohne Anwendung der Zinsschranke gegenüberstellt und beleuchtet den Einfluss auf die Gewerbesteuer. Konkrete Beispiele veranschaulichen die potenziellen Auswirkungen auf die Finanzlage mittelständischer Unternehmen.
Was ist der Zinsvortrag und welche Probleme sind damit verbunden?
Der Zinsvortrag, der sich aus der Anwendung der Zinsschranke ergibt, wird im entsprechenden Kapitel erklärt. Die Anwendungsvorschriften, die Ermittlung und die damit verbundenen Probleme, wie z.B. der Konflikt mit dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit oder der Untergang des Zinsvortrags bei bestimmten Ereignissen, werden detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Zinsschranke, Unternehmensteuerreform 2008, § 4h EStG, mittelständische Unternehmen, Steuerlast, Fremdfinanzierung, Abzugsfähigkeit, Zinsaufwendungen, Gewerbesteuer, Vergleichsrechnung, Steuerbelastung, Leistungsfähigkeit.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Das HTML-Dokument enthält ein vollständiges Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln, welches den Aufbau und die Struktur der Arbeit detailliert darstellt. Es beginnt mit einem "Inhaltsverzeichnis"-Abschnitt, der eine Übersicht aller Abschnitte bietet.
- Quote paper
- Katja Weber (Author), 2008, Die Zinsschranke - Eine kritische Analyse der Anwendung und der Auswirkungen bei mittelständischen Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/92729