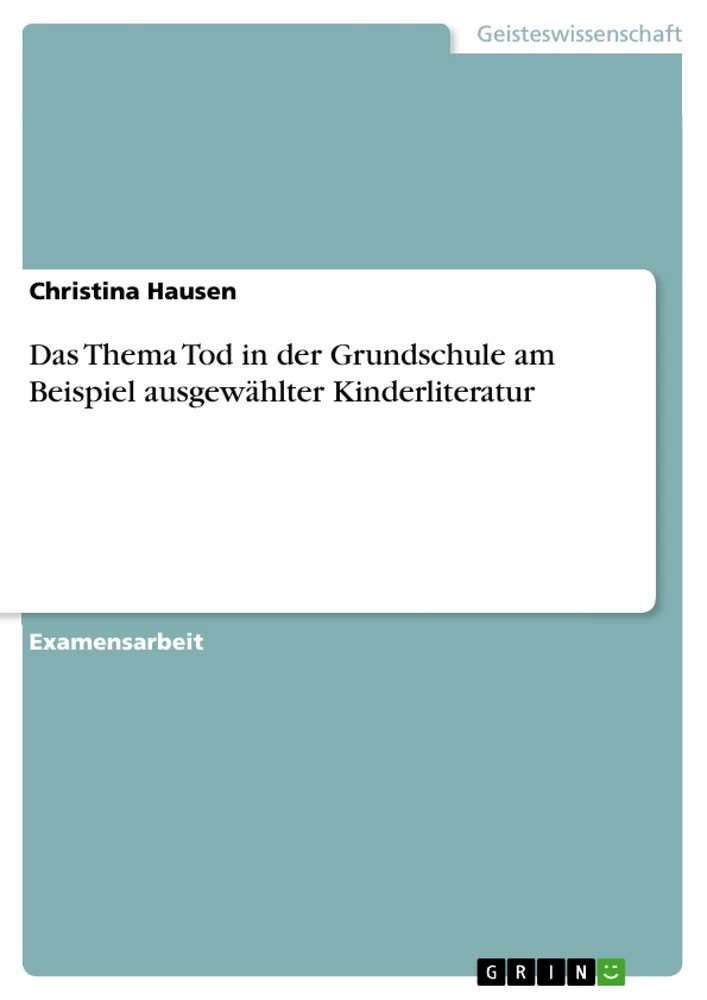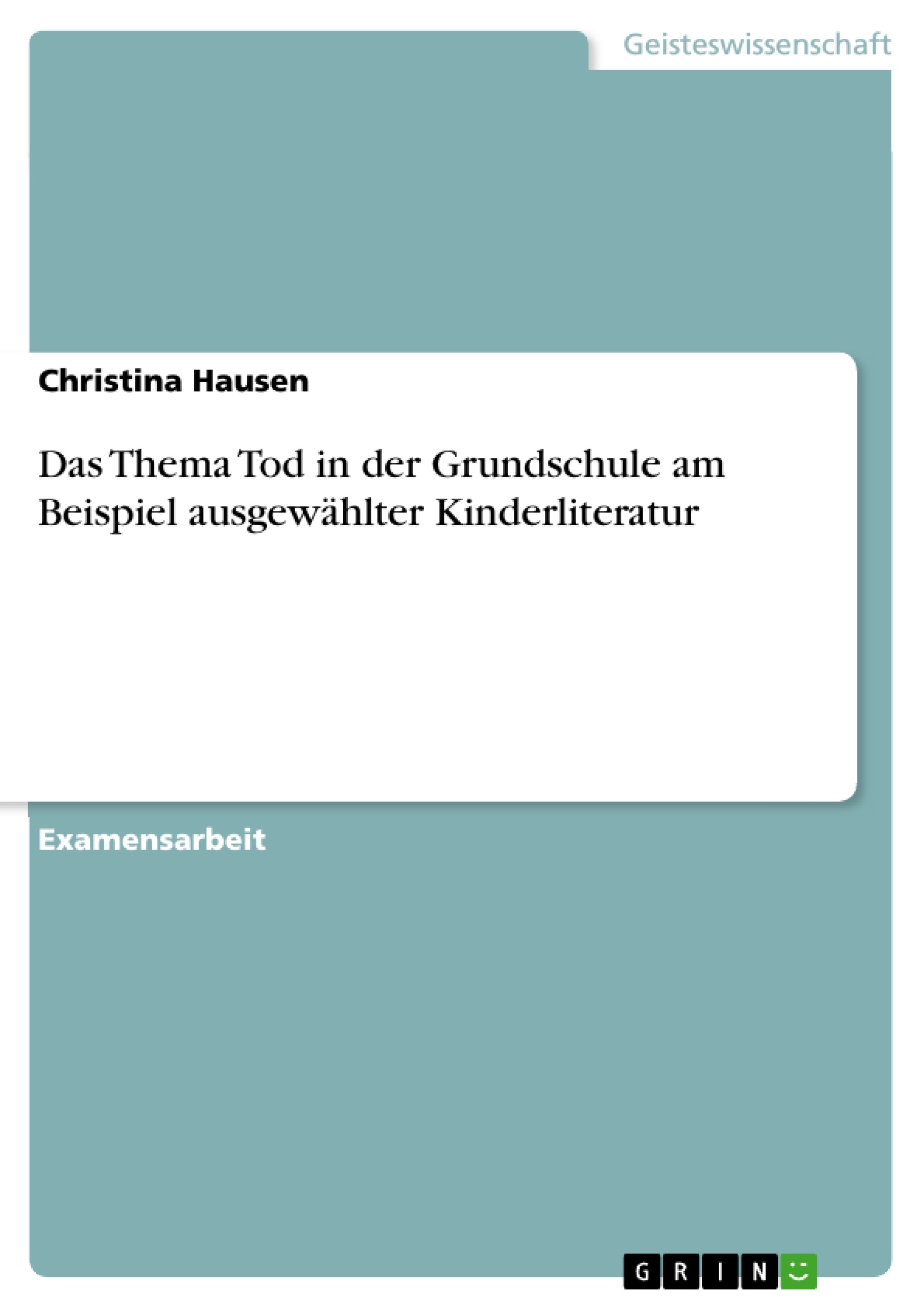Kinder stellen viele Fragen. Sie sind sehr wissbegierig und wollen lernen. Dennoch sind manche Fragen auch für Erwachsene schwer zu beantworten, teilweise, weil sie nicht wissen, wie sie antworten sollen, teilweise aber auch, weil sie selbst keine Antwort wissen. Zu diesen Fragen gehören auch Fragen nach dem Tod. Sie möchten wissen, was mit ihnen geschieht, wenn sie tot sind und warum Menschen überhaupt sterben müssen. Auch die Frage, was jemand tut, wenn er tot ist, beschäftigt sie . Viele Erwachsene vertreten die Meinung, dass Kinder von diesem Thema ferngehalten werden sollten, dass sie noch zu klein seien und nicht damit belastet werden sollten. Kleinkinder können jedoch frühzeitig Erfahrungen mit dem Tod sammeln (im Fernsehen, Tod der Oma, Tod des Haustieres) und gehen meist vollkommen unbefangen mit dem Thema um. Ihr Umgang mit dem Tod hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie die Menschen in ihrer Umgebung mit dem Tod umgehen. Die Grundschule, und besonders der Religionsunterricht, müssen daher Raum für Gespräche über den Tod schaffen. Die Schüler müssen dazu ermutigt werden, weitere Fragen zu stellen und so ihre Erfahrungen mit Sterben und Tod verarbeiten. Auf diese Weise kann der Religionsunterricht einer Tabuisierung des Todesthemas entgegenwirken. Er setzt an der Lebenswirklichkeit der Kinder an, da diese vielfach schon Erfahrungen mit dem Tod gesammelt haben, ohne eine Möglichkeit zur Bewältigung angeboten bekommen zu haben. Somit wird auch in den Lehrplänen bewusst ein Zugang zur Thematik „Leid und Tod“ gewählt, bei dem sich vielfältige Fragen der Schülerinnen und Schüler entfalten können. Die Schulkinder sollen Aufmerksamkeit dafür entwickeln, wie andere Menschen mit Leid und Vergänglichkeit umgehen, und sich dadurch angeregt mit ihren eigenen Fragen und Antwortversuchen auseinander setzen. In dieser Auseinandersetzung können sie erkennen, dass es letztlich keine tragfähige Antwort für die Fragen nach Leid und Tod gibt und dass der Menschen sie letztlich nicht begreifen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Bilderbuch
- Die Priorität des Bildes im Vergleich zum Text
- Die Bildungsfunktion des Bilderbuches
- Die Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen
- Definition „Tod“
- Entwicklung der Todesvorstellungen im Kindesalter
- Säuglinge von der Geburt bis zum 12. Monat
- Babys zwischen 10 Monaten und 2 Jahren
- Vorschulkinder 3 bis 6 Jahre
- Grundschulkinder von 6 bis 9 Jahren
- Jugendliche
- Christliche Eschatologie - Hilfe für die Kinder?
- Vergleich biblischer und kindlicher Todesimaginationen
- Christliche Hoffnung über den Tod hinaus
- Himmel, Hölle
- Seele
- Psychologische Vorstellungen
- Philosophische Vorstellungen
- Theologischen Vorstellungen
- Die heutige Situation
- Was tut Kindern gut?
- Kriterien zur Analyse der Bilderbücher
- Vorbemerkung
- Kriterien
- Analyse ausgewählter Bilderbücher
- Olbrich, Hiltraud: Abschied von Tante Sofia
- Øyen/ Kaldhol: Abschied von Rune
- Essen/Schuler: Von Tod und Auferstehung den Kindern erzählt
- Fried/Gleich: Hat Opa einen Anzug an?
- Erlbruch, Wolf: Ente, Tod und Tulpe
- Varley, Susan: Leb wohl, lieber Dachs
- Unterrichtsentwurf zum Thema „Tod“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht, wie das Thema „Tod“ im Religionsunterricht der Grundschule mithilfe von ausgewählter Kinderliteratur kindgerecht vermittelt werden kann. Ziel ist es, die Bedeutung des Bilderbuchs für die Auseinandersetzung mit dem Tod im Kindesalter zu beleuchten und pädagogische Ansätze für die Behandlung dieses sensiblen Themas im Unterricht zu entwickeln.
- Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen
- Christliche Eschatologie und ihre Relevanz für Kinder
- Analyse ausgewählter Bilderbücher zum Thema Tod
- Entwicklung eines Unterrichtsentwurfs zum Thema Tod
- Pädagogische und theologische Aspekte der Todesthematik im Grundschulalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Tod“ im Religionsunterricht der Grundschule dar und verdeutlicht den Bedarf an einer kindgerechten Auseinandersetzung mit diesem Thema. Kapitel 2 befasst sich mit der Bedeutung des Bilderbuchs als pädagogisches Instrument im Kontext der Todesthematik. In Kapitel 3 werden die verschiedenen Phasen der Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen analysiert und die Bedeutung des Alters und der Reife für die Verarbeitung des Themas hervorgehoben. Kapitel 4 beleuchtet die christliche Eschatologie und ihre Relevanz für Kinder. Hier werden verschiedene christliche Vorstellungen von Tod, Himmel, Hölle und Seele dargestellt und in Bezug zu kindlichen Todesvorstellungen gesetzt. Kapitel 5 stellt Kriterien zur Analyse von Bilderbüchern zum Thema Tod vor. In Kapitel 6 werden ausgewählte Bilderbücher analysiert und in ihrer Eignung für den Religionsunterricht der Grundschule bewertet. Kapitel 7 präsentiert einen Unterrichtsentwurf zum Thema „Tod“, der exemplarisch die Umsetzung der in der Hausarbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigt.
Schlüsselwörter
Todesthematik, Kinderliteratur, Bilderbuch, Religionsunterricht, Grundschule, Entwicklung kindlicher Todesvorstellungen, Christliche Eschatologie, Himmel, Hölle, Seele, Pädagogik, Theologie, Unterrichtsentwurf
- Quote paper
- Christina Hausen (Author), 2008, Das Thema Tod in der Grundschule am Beispiel ausgewählter Kinderliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/92555