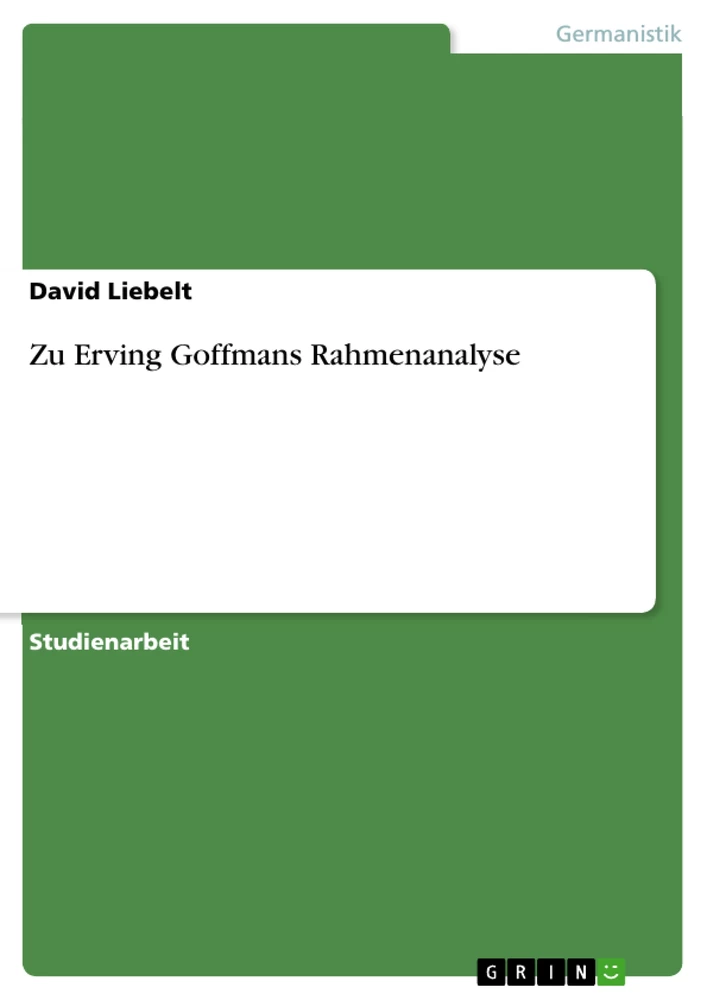Goffman partizipiert an keiner kennzeichnenden Schule innerhalb der Soziologie, und auch anhand seiner Arbeiten lässt sich keine direkte Tradition festmachen. Die Auffassungen über ihn sind daher so kontrovers wie nur irgend möglich. Er galt als ‚der’ Soziologe, der in geschliffenen Sätzen – manchmal komisch, manchmal zynisch - ganz ohne ‚theoretic talk’ Romane schreibe. Und auch wenn es paradox erscheint: sein populärer Stil führte und führt eher dazu, seine Bücher zu ‚konsumieren’ anstatt sich intensiv mit ihren Inhalten zu befassen und hinter den kuriosen Details die Komplexität seines Forschungsprogramms zu entdecken. Daher halten viele Leser sein Werk für abgehackt und auch vulgär. Abgehackt und unzusammenhängend, weil Goffmans Bücher nicht den üblichen formellen Anforderungen an gelehrte Publikationen entsprechen, und vulgär, weil sie sich mit Dingen beschäftigen, über die man - nach allgemeinem Ermessen - nicht spricht und schon gar nicht in der unempfindlichen Art und Weise, wie Goffman dies tut. Goffmans Reputation, so jedenfalls erläuterte es Collins, rühre vornehmlich von einer ‚popularistic audience’, die ihn bejubele, weil er sage, was andere sich nicht trauen – was aber trotzdem gesagt werden müsse. Während ihm schon zu Lebzeiten eine ausnehmend große Reputation in der Philosophie, bei den Anthropologen, bei Sprachwissenschaftlern, Psychiatern und Politikwissenschaftlern zu attestieren ist, haben ihn seine wissenschaftlichen Zeitgenossen, die sich dem strengen systematischen Denken verschrieben hatten, mehr oder weniger geschnitten. Um die Waage zu halten muss aber auch gesagt werden, dass es Goffman dem soziologischen Establishment schwer gemacht hat, ihn zu mögen – so versuchte er sich eher dem akademischen Zirkel zu entziehen. Der andere Grund, weshalb Goffman nicht in das Zentrum einer Theoriediskussion gerückt ist, hat damit zu tun, dass er selbst nie versucht hat, seine Theorien zu explizieren oder gar zu erläutern. Er liess es einfach darauf ankommen, dass man ihn verstand - oder auch nicht. Wenn er überhaupt das Anliegen gehabt hat, die Theoriediskussion zu befruchten, dann höchstens in der Weise, dass er die Soziologen neu sehen lehren wollte
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Goffman
- III. Goffmans Interaktionsbegriff: ,Was' macht der Mensch? - Er interagiert!
- IV. Goffmans Rollenverständnis: ,Wo' interagiert er? - Er interagiert in einer Rolle!
- V. Rahmenstruktur: ,Wie' verhält sich der Mensch zu seiner Rolle?
- V.1. Rahmenkonzept
- V.2. Spontane und geplante Rahmenbrüche
- V.3. Primäre Rahmen
- V.4. Transformation primärer Rahmen - Modulation
- V.5. Täuschung
- V. 6. Klammern
- V.7. Kommunikation außerhalb des Rahmens
- V. 8. Engagement
- VI. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit widmet sich Goffmans „Rahmenanalyse“, einem Werk, das die Organisation von Alltagserfahrungen aus der Perspektive der Interaktion untersucht. Goffman analysiert die Frage: „Was geht hier eigentlich vor?“, die Menschen in sozialen Situationen unbewusst oder bewusst stellen. Die Arbeit beleuchtet die vielgestaltigen Ausdrucksweisen von Menschen in sozialen Interaktionen und die gesellschaftlichen Grundsätze, auf die sie zurückgreifen, um ihre Identität gegenüber den markierten Rollen abzugrenzen.
- Goffmans Interaktionsbegriff
- Goffmans Rollenverständnis
- Rahmenanalyse als Konzept
- Spontane und geplante Rahmenbrüche
- Engagement in sozialen Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Goffmans „Rahmenanalyse“ als „Essay on the organization of experience“ vor und erläutert die zentrale Frage des Buches: „Was geht hier eigentlich vor?". Sie hebt Goffmans Interesse an den vielfältigen Ausdrucksformen von Menschen in sozialen Interaktionen und deren Orientierung an gesellschaftlichen Prinzipien hervor. Im zweiten Kapitel werden Goffmans Lebenswerk und seine Positionierung in der Soziologie beleuchtet. Die folgenden Kapitel behandeln Goffmans Interaktionsbegriff, sein Rollenverständnis und die Rahmenstruktur, die Menschen zur Orientierung in sozialen Situationen nutzen. Besondere Aufmerksamkeit wird den spontanen und geplanten Rahmenbrüchen sowie der Kommunikation außerhalb des Rahmens geschenkt.
Schlüsselwörter
Die „Rahmenanalyse“ von Erving Goffman beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Interaktion, Rolle, Rahmenkonzept, Rahmenbruch, Täuschung und Engagement. Goffman untersucht die Organisation von Alltagserfahrungen und die Bedeutung von sozialen Interaktionen für die Konstruktion von Identität. Seine Analyse fokussiert auf die Techniken, mit denen sich Menschen in sozialen Situationen präsentieren und ihre Handlungen an das Gegenüber anpassen.
- Quote paper
- David Liebelt (Author), 2007, Zu Erving Goffmans Rahmenanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/92322