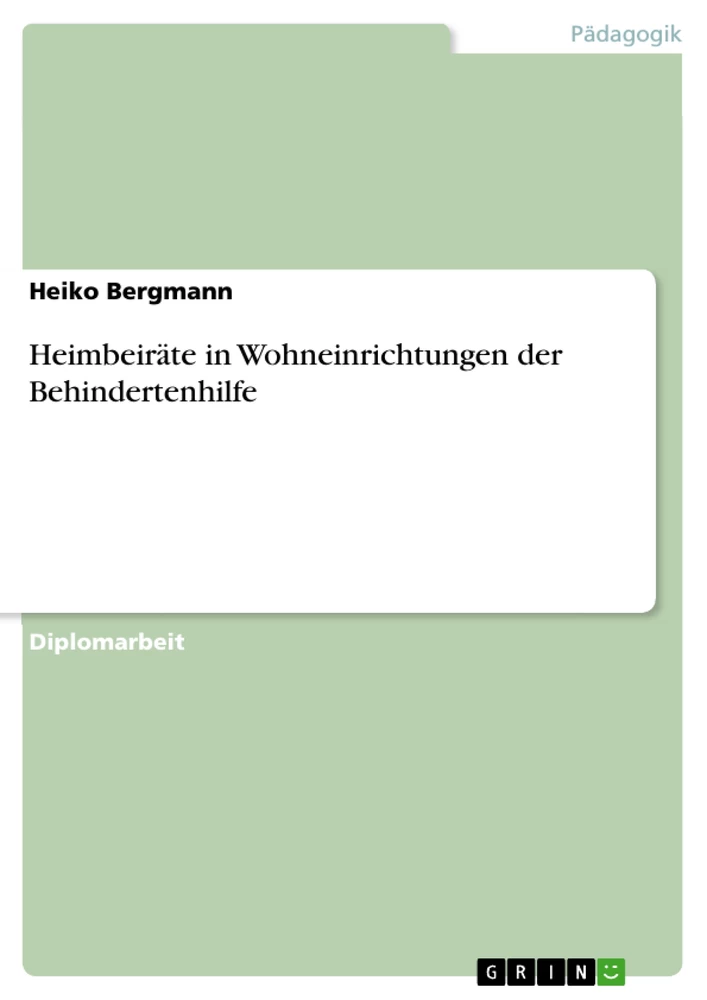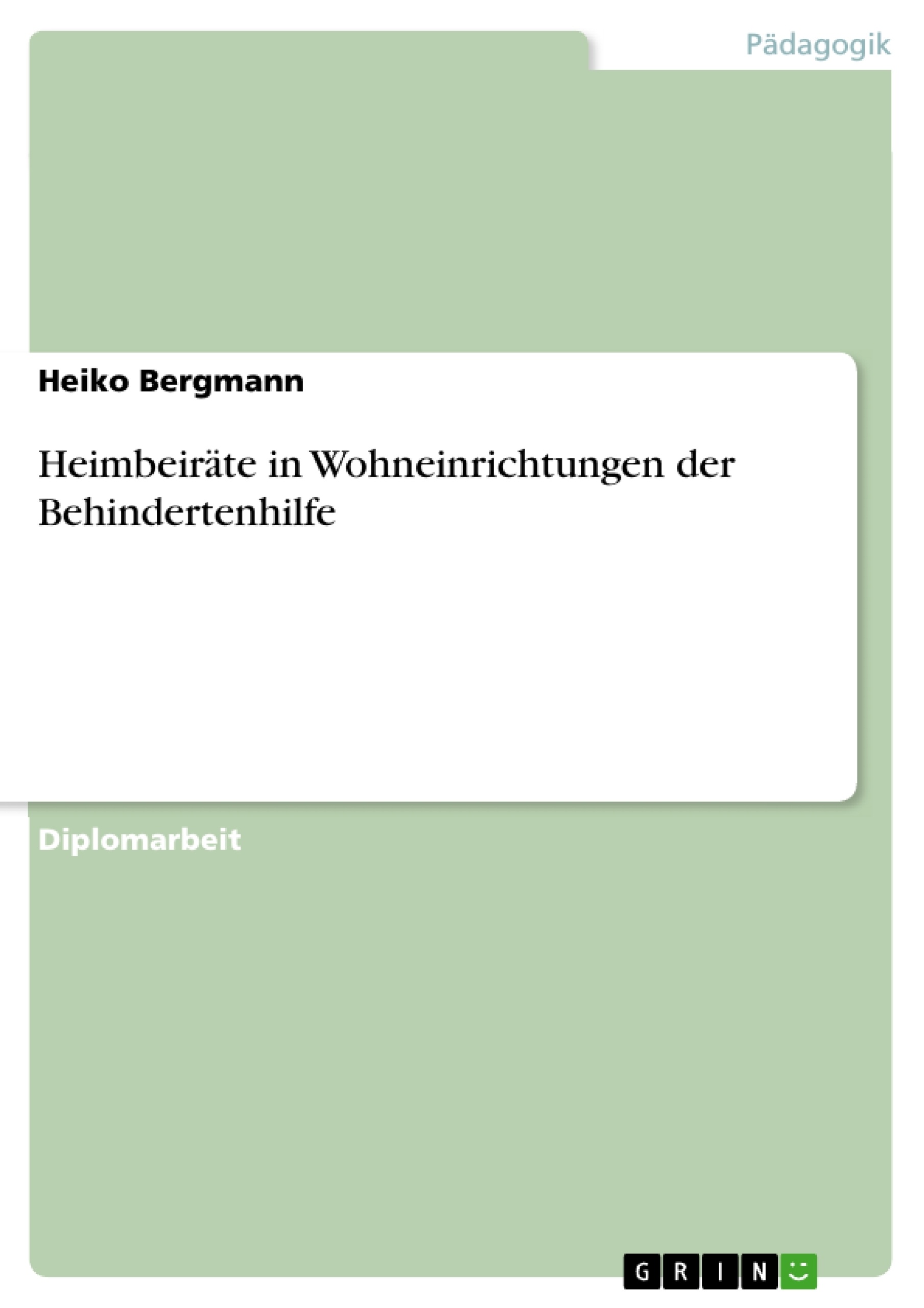In der vorliegenden Diplomarbeit beschäftige ich mich mit geistig behinderten Menschen, die in stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe leben. >Gegenstand< dieser Arbeit sind somit Menschen mit geistigen Behinderungen. Im ersten Kapitel entscheide ich mich für eine potentialorientierte Menschenbildannahme als Grundlage dieser Abeit. Da ein Großteil der erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in stationären Wohneinrichtungen lebt, ergibt sich die Frage, welche Möglichkeiten oder Angebote für sie bestehen, ihre Lebenswelt >Heim< aktiv zu gestalten. Eine Möglichkeit zur aktiven Gestaltung des Heimalltag für die Nutzer ist durch die ehrenamtliche Mitwirkung in einem gewählten Heimbeirat gegeben. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Um diese Fragestellung bearbeiten zu können, wird in Kapitel 3 ein Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit angeboten. In Kapitel 4 wird auf die Mitwirkungspraxis eingegangen. Wie sich in Kapitel 4 herausstellt, werden Heimbeiräte derzeit meist gewählt. Hinter dem hohen Insttutionalisierungsgrad verbirgt sich jedoch eine sehr große Heterogenität, wenn nach der Umsetzung der rechtlichen Forderungen gefragt wird. Im Kapitel 4.5 werde ich deshalb auf die Spannungsfelder zwischen den gesetzlchen Vorgaben und der Mitwirkungspraxis eingehen.
Im Zentrum der Heimbeiratsarbeit liegen die gesetzlich vorgeschriebenen Heimbeiratssitzungen. Hier laufen alle >Fäden< zusammen. Auf den regel-mäßigen Treffen werden Informationen ausgetauscht, aktuelle Themen besprochen und Entscheidungen getroffen usw.. In der Praxis werden die Heimbeiratsmitglieder von Mitarbeitern, die sich vorwiegend aus dem Stammpersonal der Einrichtungen rekrutieren, dauerhaft unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt deshalb in der Beantwortung der Frage, welche Bedingungen erfolgreiche Heimbeiratssitzungen fördern. Als erfolgreich werden in diesem Abschnitt solche Bedingungen bezeichnet, die die unterstellten Potentiale der Sitzungsteilnehmer fördern. In Kapitel 5 wer-den Vorschläge zur Gestaltung von Heimbeiratssitzungen gemacht, die dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Menschenbild entsprechen. In Kapitel 5.5 wird ein Beispiel für die praktische Umsetzung angeboten. Die Arbeit schließt in Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung und einer abschließenden Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung und Fragestellung
- 1. Theoretischer Standpunkt dieser Arbeit
- 1.1 Anthropologische Grundannahmen
- 1.1.1 Menschenbildannahmen
- 1.1.2 Die Verwendung des Begriffs >Menschenbild<
- 1.2 Pädagogische Grundannahmen
- 1.2.1 Folgen für die Sichtweise von Behinderung
- 1.2.2 Konsequenzen für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen
- 2. Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
- 2.1 Der Begriff >Wohneinrichtung<
- 2.2 Zur Bedeutung von Mitwirkung und Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen
- 2.2.1 Wohnen unter erschwerten Bedingungen
- 2.3 Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung im Heimalltag
- 2.3.1 Mitwirkung und Selbstbestimmung über Heimbeiräte
- 3. Gesetzliche Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit
- 3.1 Das neue Heimgesetz
- 3.2 Die neue Heimmitwirkungsverordnung
- 3.2.1 Begriffbestimmung >Heimbeirat<
- 3.2.2 Begriffsbestimmung >Mitwirkung<
- 3.2.3 Tätigkeiten und Aufgaben des Heimbeirates
- 3.2.4 Bildung des Heimbeirates / alternative Mitwirkungsformen
- 4. >Mitwirkungspraxis< in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe
- 4.1 Mitwirkungsformen
- 4.2 Heimaufsichtsbehörden
- 4.3 Unterstützung durch Einrichtungsträger
- 4.3.1 Kostenübernahme der Heimbeiratstätigkeit
- 4.3.2 Personelle Unterstützung des Heimbeirates
- 4.3.2.1 Aufgabenbereiche der Unterstützungspersonen
- 4.4 Konkrete Inhalte der Heimbeiratstätigkeit
- 4.4.1 Heimbeiratssitzungen
- 4.4.2 Mitwirkungsbereiche
- 4.5 Spannungsfelder zwischen gesetzlichen Vorgaben und Mitwirkungspraxis
- 5. Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Gestaltung von Heimbeiratssitzungen
- 5.1 Carl Rogers - Klientenzentrierte Gesprächspsychologie
- 5.2 Ruth Cohn – Themenzentrierte Interaktion (TZI)
- 5.3 Friedemann Schulz von Thun - Kommunikationspsychologie
- 5.4 Konsequenzen für die Gestaltung von Heimbeiratssitzungen
- 5.4.1 Gruppenregeln und visualisierte Symbole
- 5.4.2 Aufgabenverteilung
- 5.4.3 Einfachheit, Verständlichkeit und angemessenes Tempo
- 5.4.4 Selbstkundgabe
- 5.4.5 Innere Einstellung bzw. Haltung
- 5.5 Beispiel für die praktische Umsetzung
- 5.5.1 Tagesordnung
- 5.5.2 Unterstützende Hilfsmittel
- 5.5.2.1 Der Sprechball
- 5.5.2.2 Aufgabenverteilung durch Aufgabenkarten
- 5.5.2.3 Mottokarten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Rolle von Heimbeiräten in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Ziel ist es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die praktische Umsetzung und die Gelingensbedingungen für erfolgreiche Heimbeiratssitzungen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Mitwirkung und Selbstbestimmung für diese Personengruppe.
- Rechtliche Grundlagen der Heimbeiratsarbeit
- Praktische Umsetzung der Mitwirkung in Wohneinrichtungen
- Kommunikations- und Interaktionsmethoden in Heimbeiratssitzungen
- Herausforderungen und Spannungsfelder in der Mitwirkungspraxis
- Gelingensbedingungen für effektive Heimbeiräte
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf geistig behinderte Menschen in stationären Wohneinrichtungen und die Notwendigkeit einer potentialorientierten Menschenbildannahme. Die zentrale Frage ist, welche Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung des Heimalltags bestehen, wobei der Heimbeirat als eine zentrale Möglichkeit hervorgehoben wird. Die Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen, die praktische Umsetzung und die Gelingensbedingungen für erfolgreiche Heimbeiratssitzungen.
1. Theoretischer Standpunkt dieser Arbeit: Dieses Kapitel legt die anthropologischen und pädagogischen Grundannahmen der Arbeit dar. Es wird ein potentialorientiertes Menschenbild vertreten, das von der Gleichwertigkeit aller Menschen ausgeht und die subjektive Wahrnehmung und die aktive Gestaltung der Lebenswelt betont. Die Konsequenzen dieser Annahme für den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung werden erläutert.
2. Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Wohneinrichtung" und die Bedeutung von Mitwirkung und Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden Möglichkeiten zur Mitwirkung im Heimalltag untersucht, mit dem Fokus auf die Rolle des Heimbeirats als Instrument der Selbstbestimmung.
3. Gesetzliche Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit: Hier werden das neue Heimgesetz und die Heimmitwirkungsverordnung detailliert analysiert. Die Begriffsbestimmungen von "Heimbeirat" und "Mitwirkung" werden erläutert, ebenso die Aufgaben und die Bildung des Heimbeirats sowie alternative Mitwirkungsformen.
4. >Mitwirkungspraxis< in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung der Mitwirkung in Wohneinrichtungen. Es analysiert verschiedene Mitwirkungsformen, die Rolle der Heimaufsichtsbehörden und die Unterstützung durch Einrichtungsträger. Konkrete Inhalte der Heimbeiratstätigkeit, wie Sitzungen und Mitwirkungsbereiche, werden beleuchtet, sowie Spannungsfelder zwischen gesetzlichen Vorgaben und Praxis.
5. Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Gestaltung von Heimbeiratssitzungen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene kommunikationspsychologische Ansätze (Rogers, Cohn, Schulz von Thun) und leitet daraus Konsequenzen für die Gestaltung von Heimbeiratssitzungen ab. Es werden konkrete Maßnahmen wie Gruppenregeln, Aufgabenverteilung, und die Verwendung von Hilfsmitteln (Sprechball, Aufgabenkarten, Mottokarten) vorgestellt.
Schlüsselwörter
Heimbeirat, Behindertenhilfe, Wohneinrichtung, Mitwirkung, Selbstbestimmung, Menschen mit geistiger Behinderung, gesetzliche Rahmenbedingungen, Kommunikation, Interaktion, Gelingensbedingungen, potentialorientiertes Menschenbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Mitwirkung und Selbstbestimmung im Heimbeirat
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Rolle von Heimbeiräten in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Im Fokus stehen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die praktische Umsetzung und die Gelingensbedingungen für erfolgreiche Heimbeiratssitzungen. Ein zentrales Thema ist die Bedeutung von Mitwirkung und Selbstbestimmung für diese Personengruppe.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Heimbeiratsarbeit, die praktische Umsetzung der Mitwirkung in Wohneinrichtungen, Kommunikations- und Interaktionsmethoden in Heimbeiratssitzungen, Herausforderungen und Spannungsfelder in der Mitwirkungspraxis und schließlich die Gelingensbedingungen für effektive Heimbeiräte.
Welche anthropologischen und pädagogischen Grundannahmen liegen der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit basiert auf einem potentialorientierten Menschenbild, das von der Gleichwertigkeit aller Menschen ausgeht und die subjektive Wahrnehmung und die aktive Gestaltung der Lebenswelt betont. Die Konsequenzen dieser Annahme für den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung werden ausführlich erläutert.
Wie werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Heimbeiratstätigkeit dargestellt?
Das neue Heimgesetz und die Heimmitwirkungsverordnung werden detailliert analysiert. Die Begriffsbestimmungen von "Heimbeirat" und "Mitwirkung", die Aufgaben und die Bildung des Heimbeirats sowie alternative Mitwirkungsformen werden erläutert.
Wie wird die Mitwirkungspraxis in Wohneinrichtungen beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die praktische Umsetzung der Mitwirkung in Wohneinrichtungen. Sie analysiert verschiedene Mitwirkungsformen, die Rolle der Heimaufsichtsbehörden und die Unterstützung durch Einrichtungsträger. Konkrete Inhalte der Heimbeiratstätigkeit, wie Sitzungen und Mitwirkungsbereiche, werden beleuchtet, ebenso Spannungsfelder zwischen gesetzlichen Vorgaben und Praxis.
Welche kommunikationspsychologischen Ansätze werden zur Gestaltung erfolgreicher Heimbeiratssitzungen herangezogen?
Die Arbeit untersucht die Ansätze von Carl Rogers (Klientenzentrierte Gesprächspsychologie), Ruth Cohn (Themenzentrierte Interaktion – TZI) und Friedemann Schulz von Thun (Kommunikationspsychologie). Daraus werden Konsequenzen für die Gestaltung von Heimbeiratssitzungen abgeleitet.
Welche konkreten Maßnahmen zur Gestaltung erfolgreicher Heimbeiratssitzungen werden vorgeschlagen?
Konkrete Maßnahmen umfassen Gruppenregeln, visualisierte Symbole, Aufgabenverteilung, Einfachheit, Verständlichkeit und angemessenes Tempo, Selbstkundgabe, die richtige innere Einstellung und die Verwendung von Hilfsmitteln wie Sprechball, Aufgabenkarten und Mottokarten.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind Heimbeirat, Behindertenhilfe, Wohneinrichtung, Mitwirkung, Selbstbestimmung, Menschen mit geistiger Behinderung, gesetzliche Rahmenbedingungen, Kommunikation, Interaktion, Gelingensbedingungen und potentialorientiertes Menschenbild.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung und Fragestellung, Theoretischer Standpunkt, Möglichkeiten zur Mitwirkung und Selbstbestimmung, Gesetzliche Rahmenbedingungen und Gelingensbedingungen für erfolgreiche Heimbeiratssitzungen. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert. Ein Inhaltsverzeichnis und ein Stichwortverzeichnis sind ebenfalls enthalten.
- Quote paper
- Heiko Bergmann (Author), 2005, Heimbeiräte in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/92262