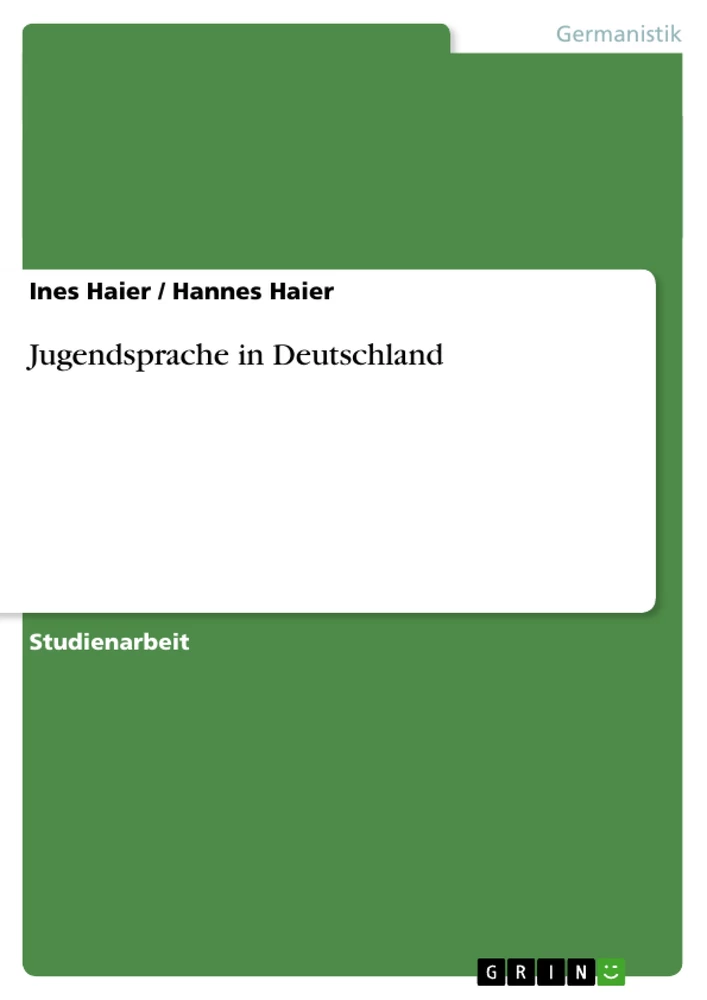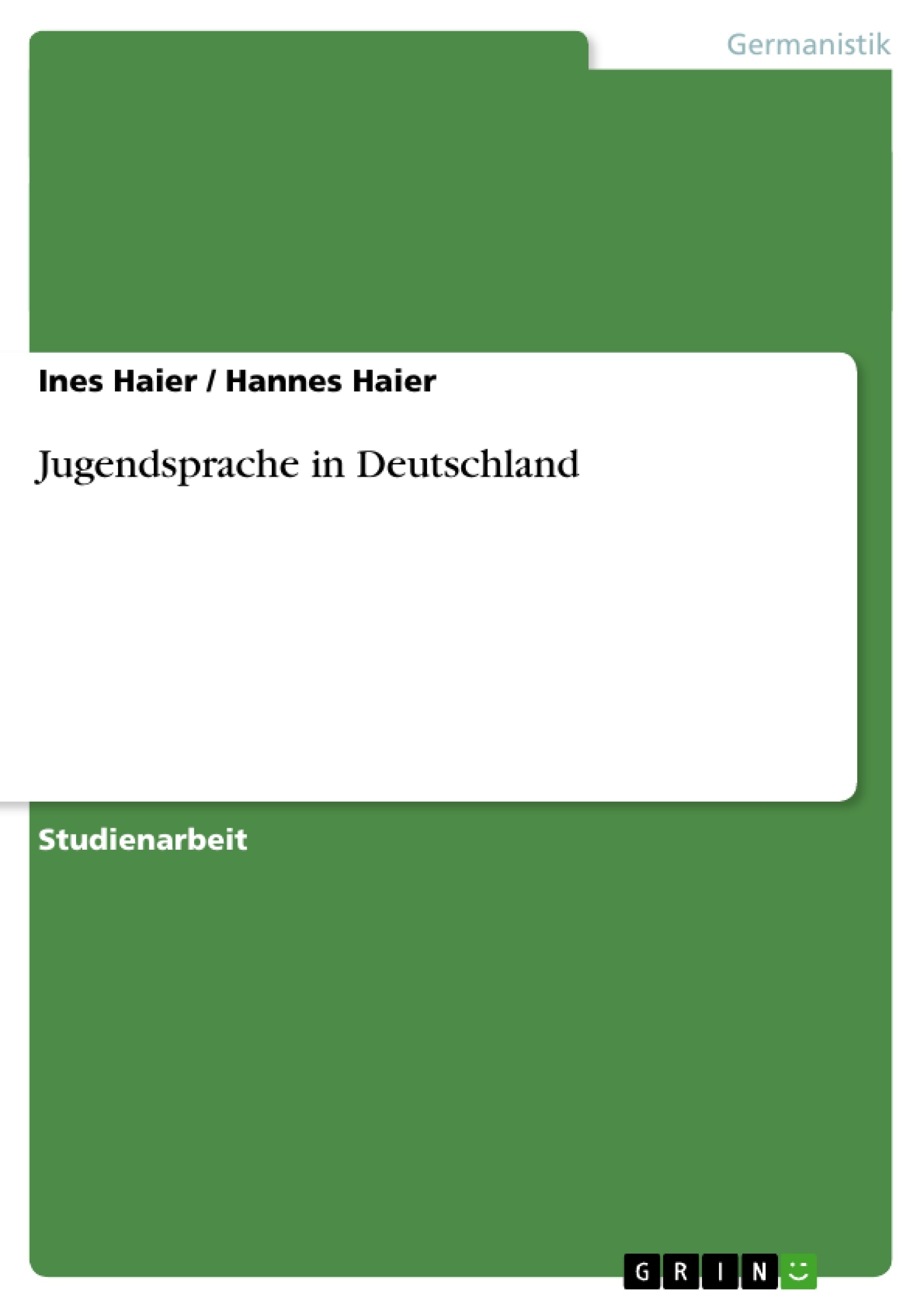Das Interesse an der Jugend, an ihrer Sprache und ihrer Kommunikation seitens der Gesellschaft ist hoch. In vielerlei Bereichen unseres alltäglichen Lebens begegnen uns die sog. „jugendsprachlichen Ausdrücke“, im Fernsehen, im Radio, in der Schule, auf der Straße. Immer wieder wird dabei von „einer Jugendsprache“ oder „der Sprache der Jugend“ gesprochen. Doch kann man wirklich von „einer Jugendsprache Sprechen? Und wer spricht eigentlich diese Sprache? Nur die Jugendlichen? Sprechen Jugendliche denn tatsächlich eine andere Sprache als die Erwachsenen? Und wenn ja, woher kommt diese Sprache? Ist sie eine Erfindung der Jugendlichen oder wird sie ihnen durch die Medien in den Mund gelegt. Wollen sich Jugendliche tatsächlich nur von den Erwachsenen durch ihre Sprache abheben oder gibt es dafür vielleicht noch andere Gründe? Und auf welchem Stand steht die Forschung hinsichtlich der Jugendsprache? Mit diesen Fragen und auch einem gewissen Interesse an der eigenen Jugendsprache sind wir an das Thema herangegangen und wollen nun im weiteren Verlauf versuchen, die uns gestellten Fragen weitgehend auf dem Hintergrund der vorhandenen Forschungsergebnisse zu beantworten.
Im ersten Teil der Arbeit geht es darum einen Überblick zu schaffen, was man überhaupt unter dem Begriff Jugend versteht Als nächstes wird versucht zwei als typische jugendsprachlich angesehene Merkmale zu untersuchen. Des Weiteren werden wir die Forschungsmethoden und Ergebnisse Helmut Hennes (1986) und Schlobinski, Kohl und Ludwig (1993) betrachten. Um dann die Frage zu klären, ob den Jugendlichen ihrer Sprache durch die Medien in den Mund gelegt wird, betrachten wir den Aspekt der „Jugendsprache und Medien“. Ebenso richten wir ein Merkmal auf die regionalen Unterschiede am Beispiel der Ost – West Jugend sowie die auf gruppenspezifischen Aspekte der Jugendsprache
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Jugend und welcher Personenkreis zählt dazu?
- 3. Merkmale der Jugendsprache
- 4. Ein Überblick über zwei verschiedene Forschungsansätze
- 4.1 Forschungsansätze Helmut Hennes um 1986
- 4.2 Forschungsansätze von Schlobinski, Kohl und Ludwig um 1993
- 5. Der Einfluss von Medien auf den Sprachgebrauch von Jugendlichen
- 6. Jugendsprache als Gruppensprache
- 6.1 Das Bricolage-Prinzip als zentrales Merkmal von Jugendlicher Gruppenkommunikation
- 6.2 Parallelen des Bricolage-Kommunikationsstils zu anderen Phänomenen der „Jugendkultur“
- 6.2.1 Stilbastelei in der HipHop Musik
- 7. Regionale Unterschiede im Jugendlichen Sprachgebrauch
- 8. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache in Deutschland. Ziel ist es, die Frage nach der Existenz einer einheitlichen Jugendsprache zu beantworten und verschiedene Forschungsansätze zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Medien und regionalen Faktoren auf den Sprachgebrauch von Jugendlichen.
- Definition von Jugend und zugehöriger Personengruppe
- Charakteristische Merkmale der Jugendsprache (Anglizismen und Lautwörter)
- Einfluss der Medien auf die Jugendsprache
- Jugendsprache als Gruppenphänomen und das Bricolage-Prinzip
- Regionale Unterschiede in der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Jugendsprache ein und stellt zentrale Fragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Autoren beleuchten das breite Interesse der Gesellschaft an Jugendsprache und hinterfragen die Annahme einer einheitlichen Jugendsprache. Sie skizzieren den Aufbau der Arbeit und kündigen die Auseinandersetzung mit verschiedenen Forschungsansätzen an. Der Fokus liegt auf der Klärung der Frage, ob Jugendsprache ein eigenständiges Phänomen ist oder durch Medien beeinflusst wird.
2. Was ist Jugend und welcher Personenkreis zählt dazu?: Dieses Kapitel befasst sich mit der schwierigen Definition von Jugend. Es wird deutlich, dass die Abgrenzung zwischen Kindheit und Erwachsensein fließend ist und von verschiedenen Faktoren, wie biologischer Reife, sozialer Reife und finanzieller Unabhängigkeit, beeinflusst wird. Die Autoren diskutieren die Herausforderungen bei der Festlegung einer eindeutigen Altersgruppe und zitieren verschiedene Studien und Definitionen, die die Komplexität des Themas unterstreichen. Der Fokus liegt auf der Schwierigkeit, eine allgemeingültige Definition zu finden, da der Begriff "Jugend" sowohl biologische als auch soziale und kulturelle Aspekte umfasst.
3. Merkmale der Jugendsprache: Dieses Kapitel untersucht zwei Merkmale, die oft als typisch für Jugendsprache gelten: Anglizismen und Lautwörter. Es werden die unterschiedlichen Ansätze von Henne und Schlobinski verglichen. Während Henne die Bedeutung von Lautwörtern betont, fokussiert Schlobinski auf die Integration von Anglizismen in die deutsche Grammatik und Semantik. Das Kapitel analysiert die Verwendung von Anglizismen in verschiedenen Kontexten wie Musik, Werbung und Jugendzeitschriften und hinterfragt, ob diese allein als Kennzeichen der Jugendsprache betrachtet werden können. Es wird gezeigt, dass die Einordnung von Wörtern als "Jugendsprache" von Kontext und Bedeutung abhängig ist.
4. Ein Überblick über zwei verschiedene Forschungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert und vergleicht zwei unterschiedliche Forschungsansätze zur Jugendsprache. Der erste Ansatz von Helmut Hennes aus dem Jahr 1986 wird vorgestellt, ebenso wie der Ansatz von Schlobinski, Kohl und Ludwig aus dem Jahr 1993. Die Kapitel untersuchen die Methodik und Ergebnisse beider Studien, und beleuchtet die Unterschiede in ihren Schwerpunkten und Interpretationen. Die Gegenüberstellung soll dem Leser ein umfassenderes Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven und methodischen Ansätze in der Forschung zur Jugendsprache vermitteln.
5. Der Einfluss von Medien auf den Sprachgebrauch von Jugendlichen: Hier wird der Einfluss der Medien auf die Jugendsprache untersucht. Es wird analysiert, inwieweit Medien jugendsprachliche Ausdrücke prägen und verbreiten. Beispiele aus verschiedenen Medien wie Fernsehen, Radio, Werbung und Musik werden herangezogen, um diesen Einfluss zu veranschaulichen. Das Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Medien die Jugendsprache formen oder lediglich reflektieren.
6. Jugendsprache als Gruppensprache: Dieses Kapitel betrachtet Jugendsprache als ein Phänomen der Gruppenkommunikation. Es wird das Bricolage-Prinzip als zentrales Merkmal dieser Kommunikation erläutert und durch Beispiele aus der Hip-Hop-Musik illustriert. Der Fokus liegt auf der kreativen Aneignung und Umgestaltung von Sprachelementen innerhalb von Jugendgruppen und deren Bedeutung für die Gruppenidentität. Die Analyse zeigt Parallelen zwischen dem sprachlichen Bricolage und anderen Aspekten der Jugendkultur.
7. Regionale Unterschiede im Jugendlichen Sprachgebrauch: Der siebte Kapitel widmet sich regionalen Variationen in der Jugendsprache. Es wird untersucht, ob und wie sich die Jugendsprache in verschiedenen Regionen Deutschlands unterscheidet, möglicherweise am Beispiel Ost-West-Jugend. Der Fokus liegt auf den Einflussfaktoren, die zu regionalen Unterschieden führen können und wie diese Unterschiede die Gesamtlandschaft der Jugendsprache beeinflussen.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Deutschland, Forschungsansätze, Anglizismen, Lautwörter, Medien, Gruppensprache, Bricolage-Prinzip, regionale Unterschiede, Ost-West-Jugend.
Häufig gestellte Fragen zur Jugendsprache in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache in Deutschland. Sie befasst sich mit der Frage nach der Existenz einer einheitlichen Jugendsprache, vergleicht verschiedene Forschungsansätze und beleuchtet den Einfluss von Medien und regionalen Faktoren auf den Sprachgebrauch Jugendlicher.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Jugend und zugehöriger Personengruppe; charakteristische Merkmale der Jugendsprache (Anglizismen und Lautwörter); Einfluss der Medien auf die Jugendsprache; Jugendsprache als Gruppenphänomen und das Bricolage-Prinzip; regionale Unterschiede in der Jugendsprache; Vergleich verschiedener Forschungsansätze zur Jugendsprache (Hennes, Schlobinski, Kohl und Ludwig).
Welche Forschungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Forschungsansätze von Helmut Hennes (um 1986) und Schlobinski, Kohl und Ludwig (um 1993). Der Vergleich umfasst die Methodik, die Ergebnisse und die unterschiedlichen Schwerpunkte der Studien.
Wie wird der Einfluss der Medien auf die Jugendsprache untersucht?
Die Arbeit analysiert, inwieweit Medien jugendsprachliche Ausdrücke prägen und verbreiten. Es werden Beispiele aus Fernsehen, Radio, Werbung und Musik herangezogen, um den Einfluss der Medien zu veranschaulichen. Die Frage, ob Medien die Jugendsprache formen oder lediglich reflektieren, wird diskutiert.
Welche Rolle spielt das Bricolage-Prinzip?
Die Arbeit betrachtet Jugendsprache als Gruppenkommunikation und erläutert das Bricolage-Prinzip als zentrales Merkmal. Das kreative Aneignen und Umgestalten von Sprachelementen innerhalb von Jugendgruppen und deren Bedeutung für die Gruppenidentität werden untersucht. Parallelen zum sprachlichen Bricolage in anderen Aspekten der Jugendkultur (z.B. Hip-Hop Musik) werden aufgezeigt.
Gibt es regionale Unterschiede in der Jugendsprache?
Die Arbeit untersucht regionale Variationen in der Jugendsprache und die Einflussfaktoren, die zu diesen Unterschieden führen können. Möglicherweise wird der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland in Bezug auf die Jugendsprache beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Jugend, Merkmalen der Jugendsprache, Forschungsansätzen, Medieneinfluss, Jugendsprache als Gruppensprache, regionale Unterschiede und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Deutschland, Forschungsansätze, Anglizismen, Lautwörter, Medien, Gruppensprache, Bricolage-Prinzip, regionale Unterschiede, Ost-West-Jugend.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
Welche Definition von Jugend wird verwendet?
Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeit, Jugend eindeutig zu definieren, da der Begriff biologische, soziale und kulturelle Aspekte umfasst. Es werden verschiedene Studien und Definitionen zitiert, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
- Arbeit zitieren
- Ines Haier (Autor:in), Hannes Haier (Autor:in), 2004, Jugendsprache in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/91849