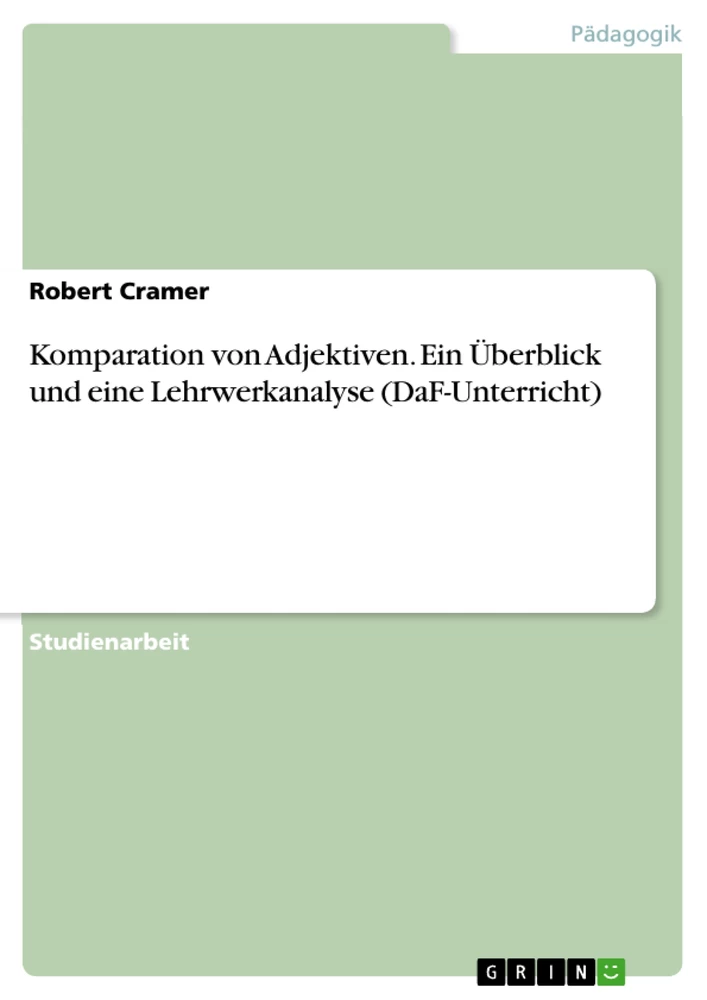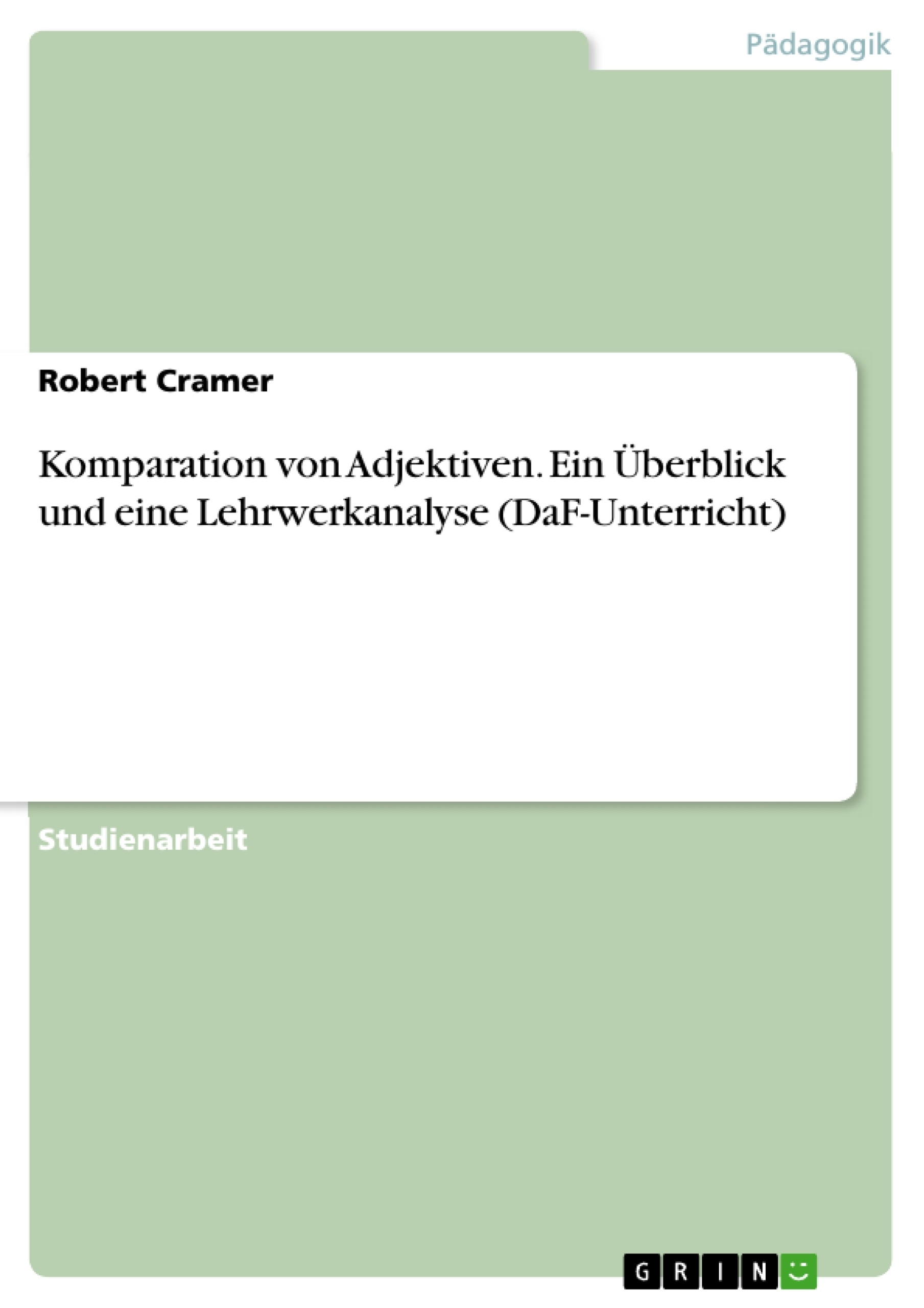Die zentralen Punkte dieser Hausarbeit sind die Komparation und die Didaktisierung der Komparation von Adjektiven. Dafür werden die Voraussetzungen beschrieben, die nötig sind, um die Komparation im Unterricht einzuführen. Außerdem werden zwei Lehrwerke untersucht, die die Komparation im DaF-Unterricht erstmalig thematisieren. Weiterhin geht es um die Bildung der verschiedenen Komparationsstufen und die Besonderheiten der Potenziatoren vor Adjektiven. Zu Beginn gibt es eine kurze Einführung zum Adjektiv, da die Hausarbeit sich ausschließlich mit dieser Wortart beschäftigt.
Adjektive sind im deutschen Sprachgebrauch nicht in jedem Kontext notwendig, aber beleben und konkretisieren Kommunikation oder Schriftsprache ungemein – mit ihrer Hilfe können eine Sache oder ein Merkmal näher beschrieben werden. Sie verwandeln ein Auto in das schnellste Gefährt und ein Grillhähnchen in ein schmackhaftes Erlebnis. Die meisten Adjektive können in ihrem Grad verändert werden, sind also skalar oder komparierbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Komparation - ein Überblick
- 2.1 Das Adjektiv
- 2.2 Die Komparationsstufen
- 2.2.1 Der Positiv
- 2.2.2 Der Komparativ
- 2.2.3 Der Superlativ
- 2.2.4 Der Elativ
- 3. Benötigte Vorkenntnisse und Referenzrahmen
- 4. Lehrwerkanalyse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Komparation von Adjektiven im Deutschen und deren Didaktisierung im DaF-Unterricht. Die Zielsetzung besteht darin, die Voraussetzungen für die Einführung der Komparation im Unterricht zu beschreiben und zwei relevante Lehrwerke zu analysieren.
- Die verschiedenen Komparationsstufen (Positiv, Komparativ, Superlativ, Elativ)
- Die Bildung der Komparationsformen und die Rolle von Potenziatoren
- Die grammatischen Eigenschaften des Adjektivs im Deutschen
- Analyse der Komparation in ausgewählten Lehrwerken
- Didaktische Implikationen für den DaF-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Adjektivkomparation ein und betont deren Bedeutung für die sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Sie hebt die zentrale Rolle der Komparation und ihrer Didaktisierung in dieser Arbeit hervor und skizziert den weiteren Aufbau, der die notwendigen Voraussetzungen für den Unterrichtseinstieg, sowie die Analyse von zwei DaF-Lehrwerken umfasst. Die Einleitung motiviert die Auseinandersetzung mit dem Thema, indem sie die sprachliche Bereicherung durch Adjektive verdeutlicht und den Fokus auf die Komparation als zentrales Element dieser Bereicherung lenkt. Der Bezug zu DaF-Lehrwerken etabliert gleichzeitig den praktischen Kontext der Arbeit.
2. Komparation - ein Überblick: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Komparation von Adjektiven. Zunächst wird das Adjektiv selbst definiert und in seine verschiedenen Kategorien und Verwendungsmöglichkeiten (attributiv, prädikativ, adverbial) eingeteilt, wobei der Duden als Referenz dient. Es werden verschiedene Arten von Adjektiven und ihre Eigenschaften beschrieben und differenziert. Anschließend werden die verschiedenen Komparationsstufen (Positiv, Komparativ, Superlativ, Elativ) erläutert und ihre Funktionen im Satzbau dargelegt. Der Abschnitt über Potenziatoren beleuchtet die Möglichkeiten der intensiven Steigerung von Adjektiven und die damit verbundenen Herausforderungen für Lerner mit unterschiedlichen Erstsprachen. Die wissenschaftliche Diskussion um die Frage, ob Komparation Flexion oder Wortbildung ist, wird kurz angerissen, um die Komplexität des Themas zu unterstreichen.
2.1 Das Adjektiv: Dieser Unterabschnitt definiert das Adjektiv und seine Funktionen. Es werden verschiedene Arten von Adjektiven nach dem Duden (1998) unterschieden (sensorisch, qualifizierend, relational, klassifizierend) und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten des Adjektivs (attributiv, prädikativ, adverbial) werden erklärt und mit Beispielen illustriert, die die unterschiedliche Flexion der Adjektive hervorheben. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der Komparation, indem er das Adjektiv als Wortart detailliert beschreibt und die Vielfalt seiner Anwendungsmöglichkeiten aufzeigt.
2.2 Die Komparationsstufen: Dieser Abschnitt erklärt die verschiedenen Stufen der Komparation (Positiv, Komparativ, Superlativ, Elativ). Es wird der Begriff der Skalarität eingeführt und erklärt, welche Bedingungen ein Adjektiv erfüllen muss, um kompariert werden zu können. Die einzelnen Komparationsstufen werden detailliert beschrieben, ihre Bildungsweise erläutert und anhand von Beispielen veranschaulicht. Der Abschnitt beleuchtet auch die Verwendung von Gradpartikeln zur Verstärkung oder Abschwächung des Ausdrucksgrads. Die Diskussion um die sprachwissenschaftliche Einordnung der Komparation als Flexion oder Wortbildung rundet den Abschnitt ab.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Komparation von Adjektiven im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Komparation von Adjektiven im Deutschen und deren didaktischen Umsetzung im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Sie analysiert die Voraussetzungen für die Einführung der Komparation im Unterricht und untersucht zwei relevante Lehrwerke.
Welche Komparationsstufen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt alle wichtigen Komparationsstufen: Positiv, Komparativ, Superlativ und Elativ. Es wird erklärt, wie diese gebildet werden und welche Funktionen sie im Satz haben. Die Rolle von Potenziatoren zur intensiven Steigerung wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Aspekte des Adjektivs werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt die grammatischen Eigenschaften des Adjektivs, einschließlich seiner verschiedenen Arten (sensorisch, qualifizierend, relational, klassifizierend) und Verwendungsmöglichkeiten (attributiv, prädikativ, adverbial). Der Duden dient dabei als Referenzwerk.
Wie werden die Lehrwerke in die Arbeit eingebunden?
Die Arbeit analysiert zwei DaF-Lehrwerke, um die didaktische Umsetzung der Komparation im Unterricht zu untersuchen. Die Analyse zeigt, wie die Komparation in den Lehrwerken behandelt wird und welche didaktischen Implikationen sich daraus ergeben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die Voraussetzungen für die Einführung der Komparation im DaF-Unterricht zu beschreiben und die Behandlung der Komparation in zwei Lehrwerken zu analysieren. Die Arbeit soll didaktische Implikationen für den DaF-Unterricht aufzeigen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Komparation - ein Überblick (mit Unterkapiteln zum Adjektiv und den Komparationsstufen), Benötigte Vorkenntnisse und Referenzrahmen, Lehrwerkanalyse und Fazit.
Wie wird die Komparation sprachwissenschaftlich eingeordnet?
Die Arbeit berührt die sprachwissenschaftliche Diskussion, ob die Komparation als Flexion oder Wortbildung einzustufen ist, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielen Potenziatoren?
Die Arbeit beleuchtet die Verwendung von Potenziatoren zur Verstärkung oder Abschwächung des Ausdrucksgrades bei der Komparation und die damit verbundenen Herausforderungen für Lerner.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für DaF-Lehrende, DaF-Lehramtsstudierende und alle, die sich für die Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die Grammatik des Deutschen interessieren.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Zusammenfassung der Kapitel im Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte und ihre Inhalte.
- Arbeit zitieren
- Robert Cramer (Autor:in), 2020, Komparation von Adjektiven. Ein Überblick und eine Lehrwerkanalyse (DaF-Unterricht), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/916685